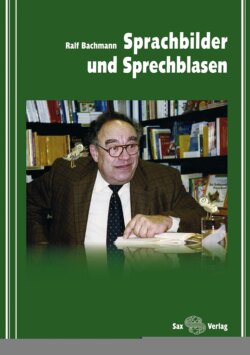Читать книгу Sprachbilder und Sprechblasen - Ralf Bachmann - Страница 8
ОглавлениеKapitel 1
Die Sache mit dem Sparschwein oder Der mühselige Weg über den Bemmen-Äquator
»... es sind die Wörter, die singen, die steigen und fallen ...
Vor ihnen werfe ich mich nieder. Ich liebe sie, ich schätze sie, verfolge sie, zerbeiße sie, lasse sie im Mund zergehen ... So sehr liebe ich die Wörter.«
Pablo Neruda
Im Bermudadreieck des Hochdeutschen zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz geboren, habe ich dort Sprechen, Lesen und Schreiben in einem ständigen Kampf zwischen Schul-, Straßen- und Familiendeutsch gelernt. Letzteres war nur eine Mischung aus Schule und Straße, anders ausgedrückt: ein Kompromiss zwischen Schädel, Birne und Nischel. Mein Weg zum Hochdeutsch war also – soll ich sagen steinig? Aber Stolpersteine im Bermudadreieck? Ein albernes Bild. Vielleicht eher windig. Oder voller Höhen und Tiefen. Schwer zu steuern. Jedenfalls ist mancher in diesem Kampf gescheitert und ward jenseits des Bemmen-Äquators nicht mehr für voll genommen und verstanden.
Das Problem beim Hochdeutschreden war für mich zunächst weniger, dass ich es nicht konnte, sondern dass ich es nicht durfte. Man wurde im südwestsächsischen Crimmitschau bei den Gleichaltrigen als erbärmlicher Streber angesehen, wenn man außerhalb der Schulstunde so redete, wie es die Lehrer verlangten. Schon in den Pausen akzeptierte ich den mir unvergesslichen Tadel eines Klassenkameraden als ehernes Gesetz: »Hasdu ehmd ›nein‹ gesaachd statts ›ne‹? Is denn hier ärchndwo ä Lehrer? Mich gönn die ma. Ich red offm Schulhof nich wie e feiner Binkl, sondern wie mer immr redn, wemmer under uns sin. Du hoffendlich ooch?«
Meine Eltern ermahnten mich manchmal milde, mich doch beim Reden nicht so gehen zu lassen. Aber viel mehr vermochten sie nicht zu tun, sie waren ja auch in diesem Revier aufgewachsen und konnten das all ihren Bemühungen zum Trotz nicht leugnen. Die Meinung gewisser Experten, dazu bedürfte es zunächst einer Kehlkopfoperation, teile ich allerdings nicht.
Vermutlich nur um einer angestrebten Karriere willen, für die einwandfreies Deutsch Bedingung war, überredete mich eines Tages mein sechs Jahre älterer Bruder zu einer finanziell unterfütterten wechselseitigen Sprecherziehungsmaßnahme: Wer im Gespräch die Regeln der korrekten Aussprache verletzt, muss für jede Sünde fünf Pfennige in ein gemeinsames Sparschwein stecken. Ein beiläufig gesprochener Satz »Määr als arbeeden gannsch ooch nich« kostete insgesamt zwei Groschen Strafe. Dazu kamen täglich die Bußgelder für »Gumma her«, »Sooch das nich«, »Geb mer eens«, »Das gammer nich gloom«, »Gwadsch«. Wir merkten bald, dass wir über unsere pekuniären Möglichkeiten sächselten und gaben auf, nicht das Sächseln, aber das Zahlen.
Zarte Liebeslyrik auf Sächsisch?
Immerhin übten wir dann und wann unentgeltlich weiter und lachten uns bei solchen Gesprächen wegen des beim jeweils Anderen gekünstelt anmutenden Klangs der »Hochsprache« gegenseitig aus. Allmählich erwuchs aus dem Spiel schließlich doch so etwas wie Sprachgefühl. Es kostete uns aber weiter Überwindung, gelegentlich »Keine blasse Ahnung« statt »Geen blassen Dunsd« zu sagen. Bis heute passiert es mir von Zeit zu Zeit, dass ich in unkontrollierten Momenten wohlig in die Sprache meiner Kindheit zurückfalle. Ich habe allerdings das Sächsisch, das wir in meiner Gegend sprachen, nie als schön oder gar liebenswert empfunden, sondern als quasi angeborenen Straßenjargon und oft nur als bequeme Schlamperei. Die deutsche Sprache wurde von Sächsisch seit Luther kaum bereichert. Die wenigen saxonischen Eigengewächse wie Bebbermumbe und Motschegiebschen, illern und didschn, Gelumbe und ei verbibbsch haben sich selten über Pleiße und Elster hinaus ausgebreitet. Für die literarische Erhöhung des Sächsischen habe ich nur in der Satire eines Hans Reimann (1889–1969), einer Lene Voigt (1891–1962), vielleicht noch einiger der besten Pfeffermühlen-Kabarettisten und natürlich auch des unvergessenen Sing-mei-Sachse-sing-Schöpfers Jürgen Hart Verständnis. Einen Naturhymnus oder zarte Liebeslyrik auf Sächsisch mag ich mir nicht einmal vorzustellen.
Ganz anders geht es mir mit dem Erzgebirgischen und dem Vogtländischen, deren Klang mir ebenfalls seit meiner Kindheit vertraut ist. Das sind eigene Dialekte mit streckenweise heiterer Exotik und derber Schönheit, die ich ins Herz geschlossen habe. Einmal, als wir von Crimmitschau nach Leipzig übergesiedelt waren, kam es in der Schule zu einem peinlichen Vorfall. Meine Mitschüler, mit dem anspruchsvollen Leipziger Sächsisch gesegnet, machten sich über meinen Chemnitz-Zwickauer Singsang lustig, und das auf der letzten Silbe betonte langgezogene »gellehee« (statt »nischwohr«) nach manchem Satz löste Lachsalven aus. Ich behauptete deshalb völlig zu unrecht, ich spräche eben eher Vogtländisch, weil meine Mutter von dort, aus Falkenstein, stamme. Gefährlich wurde das, als mir der zweifelnde Lehrer daraufhin auftrug, ein paar vogtländische Gedichte, die er gesammelt habe und mitbringen wolle, in der Originalaussprache vorzutragen.
Bemüht buchstabierte ich also in der nächsten Stunde, falls mich die Erinnerung nicht trügt: »Is des e schäss Fleckl, wie kaans af dr Welt, mirs nörgnst sue gut wie im Vuegtland gefellt ...« und »Dem Kanner, dem hamse sei Hosen gestuhln ...«, ein Gedicht, das auf die Lautverschiebung zwischen »a«, »o« und »u« in dieser Mundart abzielt, »wue de Hasen Hosen und de Hosen Huesen haaßen« (wobei man ue nicht als ü spricht, sondern das e nach dem u nur anhaucht). Meine Falkensteiner Freunde mögen Fehler verzeihen, es ist über 70 Jahre her. Ich habe mich wohl trotzdem ganz geschickt aus der Affäre gezogen, denn ich bekam ein Lob.
Warum ich nicht Schauspieler wurde
Aber während ich das Vogtländische bei aller Liebe nie zu lernen vermochte, wurde mir der Großstadtjargon so schnell vertraut wie das Gimmelgörnergaun. In Leipzig näherte ich mich dann auch dem Hochdeutschen an. Die beiden Gründe dafür hießen Oberschule und Größenwahn. In der privaten »Teichmannschen Oberschule für Jungen«, die ich besuchen musste, weil nur sie noch bereit war, »Halbjuden« wie mich aufzunehmen, überwogen in der Schülerschaft Söhne von Fabrikbesitzern und Professoren. Sie waren zwar in der Mehrzahl miserabel erzogen und schrecklich überheblich, sprachen aber selbst auf der Toilette fast akzentfrei, da sie es von zu Hause nicht anders kannten. Ich musste mich dem anpassen, wenn ich mich nicht blamieren wollte. Ohnehin wurde Deutsch bald zu meinem Lieblingsfach, weil ich einmal in einer Stunde zwei Aufsätze statt des einen schrieb, der gefordert war, und für beide »sehr gut« erhielt.
Darüber hinaus lernte ich ziemlich mühelos Gedichte auswendig und meldete mich munter zum Rezitieren. Eine Zeit lang träumte ich, ein großer Schauspieler zu werden. Dieser Traum platzte, als wir mit verteilten Rollen den Osterspaziergang lasen und ein anonymer Mitschüler meinen Part in der Pause danach so an die Tafel schrieb: »Dursch des Frihlinks holten beläbenten Plig.« Das war eine hundsgemeine Übertreibung. Doch sie war tödlich für meine künstlerischen Phantastereien. Ich beschloss auf der Stelle, nur ein gewöhnlicher Schreiber zu werden, bei dem es auf die Rhetorik nicht ankommt.
Kurz vor Kriegsende war wohl ein Lied (Näheres in Kapitel 3) der Anlass dafür, dass ich von der Schule flog, ohne einen Abschluss zu haben. Trotzdem bewarb ich mich 1945 gleich nach der Befreiung als Volontär bei dem Lokalblatt »Nachrichten für Grimma«. Die ersten journalistischen Erfahrungen blieben bescheiden, da die sowjetische Besatzungsmacht, als sie die amerikanische nach ein paar Wochen in Westsachsen ablöste, keine deutsche Lokalzeitung duldete. Noch bis 1948 sollte es dauern, bis ich mein Volontariat in einer »richtigen« Redaktion, der der Leipziger Volkszeitung, fortsetzen konnte. Ungeschult und aus der Provinz kommend fühlte ich mich im Kreise gestandener Journalisten sehr unwohl. Da gab es Meister des Worts wie die späteren Schriftsteller Erich Loest, Bruno Apitz und Carl Andrießen, Redakteure, die schon in der Weimarer Republik, einer sogar im Kaiserreich, an Arbeiter- und Gewerkschaftszeitungen tätig waren, junge Leute mit Uniabschluss oder wenigstens Einserabitur – ich kam mir anfangs vor, wie sich ein Regionalligist unter Bundesligaprofis fühlen mag, schwor mir aber, fleißig zu lernen und zu üben.
Anfänger und Ausbilder zugleich
Doch es blieb keine Zeit für lange Lehrjahre. Ich musste mich von Anfang an jeden Tag bei kleinen und größeren Lokalterminen bewähren: Auftritt des Zauberers Marvelli in der Kongresshalle, Eröffnung einer Zierfischschau, Tauschbörse der Philatelisten, Besuch in einem Metallbetrieb, um für den von Schulabgängern abgelehnten, aber volkswirtschaftlich wichtigen Beruf des Formerlehrlings zu werben, Reportage über den Publikumsverkehr in der größten Leipziger Bibliothek. Wie man Nachrichten und Berichte schreibt, konnte ich nirgendwo nachlesen, sondern nur bei den anderen abgucken oder mir selbst beibringen. Als Lehrbücher dienten mir die zahlreichen Korrekturen der jeweiligen Redaktionsleiter an meinen Manuskripten. Mehr und mehr konnte ich mich aber auch auf meinen Sprachinstinkt und meine Phantasie, meine Freude am Feilen von Formulierungen verlassen. In jeder freien Minute las ich alle Bücher, die mir in die Hände fielen. Mit der gleichen Inbrunst, mit der ich als Schüler die Abenteuer Karl Mays, Jack Londons und Friedrich Gerstäckers und den Liebeskitsch von Hedwig Courths-Mahler und ihrer Tochter Friede Birkner verschlungen hatte, studierte ich nun auf Empfehlung unseres Kulturredakteurs Alfred M. Uhlmann den Stil und die Wortkünste der Romantiker Eichendorff, Novalis und Stifter, vor allem aber die Novellen von Gottfried Keller und immer wieder die Balladen von Goethe und Schiller.
Die Zeitung litt unter Redakteurmangel. Von denen, die in den Nazizeitungen gedient hatten, kam niemand mehr in Frage, die meisten waren ohnehin längst im Westen. Aber auch unter den neuen Redakteuren galten strenge »Kaderkriterien« der Partei (die LVZ war von Anfang an ein Organ der SED): keine Konzentration von Kleinbürgern, keine Konzentration von Intellektuellen, keine Konzentration von früheren Sozialdemokraten und Westemigranten. Bei den Säuberungen wurden immer wieder begabte Journalisten ausgesondert. Der Ersatz sollte nach den Vorgaben der Parteiführung aus der Arbeiterklasse, vor allem aus dem Kreis der »Volkskorrespondenten«, kommen. So ergab sich, dass ich, ehe ich michs versah, vom Anfänger zum Lehrmeister wurde, indem ich einen Traktoristen, eine Putzmacherin und einen Modellbauer in die Geheimnisse des journalistischen Handwerks und der journalistischen Sprache einweihen musste, die ich doch selbst noch nicht richtig beherrschte.
Glücklicherweise zeigte sich, dass in ihnen Talent steckte. Allen Unkenrufen zum Trotz wurden sie mit meiner Hilfe früher oder später tüchtige Redakteure. Darauf war ich als gerade mal 18-jähriger Ausbilder stolz. Es störte mich wenig, dass sie die zahlreichen Fertigteile der marxistisch-leninistischen Parteisprache am schnellsten verinnerlichten. Die brauchten sie ja schließlich. »Unter Führung der siegreichen Sowjetunion und unserer leninistischen Kampfpartei schlagen wir die amerikanischen Imperialisten und Kriegstreiber und ihre westdeutschen Handlanger und eilen einem neuen Morgen in einer Welt des Friedens und des Wohlstands entgegen, in der kein Platz für Ausbeuter und Unterdrücker ist.« Wenigstens diese eine Kostprobe soll hier nicht fehlen, sie hat ja schon wieder Unterhaltungswert. Damals war diese Sprache zu schreiben eine Qual nicht nur für mich. Freiwillig redet und schreibt wohl kein normaler Mensch in dieser Art. Aber wie sich zeigt, verlernt man es auch nicht.
Die Sprache ist eine lebendige Sache
Beim Fernstudium an der journalistischen Fakultät der Leipziger Universität Mitte der 1950er Jahre wurde mir ein theoretisches Gerüst für das verpasst, was ich schon fast zehn Jahre in der Praxis getrieben hatte. In Erinnerung geblieben sind mir Buchtitel wie »Wörter und Wendungen« oder »Stilistische Mittel und Möglichkeiten«. Manche davon stehen noch in meinem Bücherschrank. Ich lese schon lange nicht mehr darin, wie sehr es mir damals auch geholfen hat. Die Sprache ist eine lebendige Sache, verändert sich Tag für Tag, bricht, wenn es sein muss, alle Regeln, oft auch dann, wenn es nicht sein muss. Die stilistischen Korsettstangen dagegen bleiben steif und bleiben zurück. Als Zeitungsschreiber darf man nicht konservativ sein, sondern muss seine Schreibe in der Art weiterentwickeln wie das Volk spricht.
Nicht anders ist Luthers berühmte Forderung zu interpretieren, man solle »dem gemeinen Mann auf dem Markt auf das Maul sehen« (Sendbrief vom Dolmetschen 1530). Dem Sinne nach riet das auch die Moskauer Germanistikprofessorin Elise Riesel, eine damals anerkannte Lehrmeisterin der DDR-Stilkundler, in ihrem Werk »Abriss der deutschen Stilistik«. Seinerzeit war es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich ihre Wertskala der Stilebenen gelesen hatte. Auch beim Wiederlesen staunte ich jetzt ein wenig. Vieles von dem, was sie geschrieben hatte, war gültig wie einst. Aber die international angesehene Philologin war noch in ihrem 1954 erschienenen Buch offenkundig zu einer Ergebenheitsadresse gegenüber dem 1953 gestorbenen großen Stalin genötigt worden.
Schon im ersten Absatz versichert sie, Stalins Arbeit »Der Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft« zum Ausgangspunkt aller Begriffsbestimmungen gemacht zu haben. Dieses längst vergessene »geniale Werk des großen Lenkers des Weltproletariats« ist insofern bemerkenswert, als es Ende 1950 auf dem Höhepunkt des kalten Krieges erschienen war und alle Welt, die sozialistische voller Hoffnung, die westliche voller Unruhe, auf ein Wort Stalins zu den aktuellen Sorgen der Menschheit um Krieg und Frieden gewartet hatte.
Stattdessen äußerte er sich mit sehr zweifelhaften Thesen – etwa mit der Behauptung, Russisch werde das Englische als Weltsprache ablösen, weil es die fortgeschrittenere Gesellschaftsordnung verkörpere - zu einem in dieser Situation so nebensächlichen Gebiet wie der Linguistik. Ich erwähne das nur deshalb, weil es ein Schock für mich und gewiss auch für die Professorin war. Wenn sich Stalin zu Wort meldete, war das so wichtig und sakrosankt, als habe Gottvater über ihn eine dritte Gesetztafel mit den Geboten 11 bis 15 auf Erden geschickt. Aber was sollte denn das jetzt bedeuten? Jedenfalls mussten alle DDR-Zeitungen den Wortlaut veröffentlichen und jeder Genosse dazu im Parteilehrjahr begeistert Stellung beziehen. Es war eine irre Hoch-Zeit des Dogmatismus, und wir wurden uns dessen nicht einmal so recht bewusst.
Vom Dogmatismus geprägt waren auch manche Lehrmaterialien der Fakultät. Wie sollte man zum Beispiel ein wissenschaftliches Lehrbuch über die 15 Phasen beim Schreiben eines Artikels ernst nehmen? Kein Journalist denkt bei der Arbeit auch nur einen Augenblick über Phasen nach, eher schon über Phrasen. In einem Beruf, in dem es um Schnelligkeit, Beobachtungsgabe und Sprachbeherrschung geht, ist gekonnte Improvisation statt Schreibbürokratismus gefragt.
Das Hohelied auf den Dozenten Bach
Gott sei Dank hatte ich im Fach Deutsch einen Dozenten namens Bach, der die von mir als Fernstudent und Mann der Praxis eingeschickten Texte über mehrere Semester hinweg stets mit feinem Sprachempfinden und pädagogischem Geschick kommentierte. Seine handschriftlichen Anmerkungen habe ich mir aufgehoben. Bachs kritische Hinweise waren fast zärtliche Ohrfeigen. Mit etwas Schmeichelei schmackhaft gemacht, wirkten sie lebenslang nach. Nur drei Beispiele: »Die Lösung der Aufgabe hält sich fern von trockener und abstrakter Diktion. Aber warum am Anfang die Substantivierung ›Das Lesen‹? In Ihrem Text passt hier: ›Die Lektüre‹.«, »Ihr kritisches Stilempfinden steht auch hier auf gewohnter Höhe – bis auf den Satz ›Das erfordert einen besonders lebendigen, lebensvollen Stil ...‹, wäre nicht besser: ›lebensnahen, realistischen Stil‹?«, »Sie schreiben ›sein Hohelied‹. Die nach Duden richtige Form ist ›sein Hoheslied‹. Da aber das ›S‹ das Wort spaltet, bevorzugt man die unflektierte Form, die mit dem bestimmten Artikel gebildet werden kann: das Hohelied.« (Nach der jüngsten Rechtschreibreform wird in dem Fall Getrenntschreibung empfohlen, also »sein Hohes Lied«. – R. B.) Vielleicht bin ich über Bach endgültig in die Fänge der schönen Sprache geraten.
Modeworte begleiten unser ganzes Leben, die meisten bleiben nicht lange, sie kommen und gehen oder sie verändern ihren Sinn. Kurt Tucholsky hat eine Art Nekrolog auf knorke geschrieben. Das Wort tauchte 1916 zum ersten Male in Berlin auf. Woher es kam, ist umstritten. Wie eine Sturmflut überschwemmte es die Stadt. Alles Schöne wurde knorke: knorke Sache, knorker Kerl, knorke aussehen. Nein, nur fast alles. Denn – so Tucholsky – ein ganz kleines Kind ist nicht knorke, ein Marienkäfer ist auch nicht knorke. Knorke ist nicht winzig, sondern bunt, laut, glänzend. Eines schönen Tages verstummte knorke. Lebe wohl, ruhe sanft, verabschiedete es Tucholsky 1924. »Hab keine Angst: Deine Familie stirbt nicht aus. Du bekommst Nachfolger.«
Er irrte sich zwar wegen des Endes von knorke. Das Wort war nur scheintot, es ist bis in die Gegenwart in Wellen wiedergekehrt. Aber recht hatte er, dass es ihm an Nachfolgern nicht fehlen würde, so wie er übrigens auch Vorgänger nennt: dobje, schnieke. Beinahe jedes Jahr danach hat vor allem die Jugendsprache neue Modewörter geboren. Einige davon sind: dufte, prima, urst, sagenhaft, irre, geil, super, galaktisch, Waahnsinn, das ist so was von in, tierisch angesagt, einfach hype. Solche Wörter sind zeitweise derart besitzergreifend, dass man belächelt wird, wenn man andere an seiner Stelle zu benutzen wagt. Aber so stark wie ihre Aggressivität ist auch ihre Vergänglichkeit. Nichts klingt schaler als verblühte Modeworte. Man kann sie weiter verwenden. Jeder versteht sie, ist aber peinlich berührt, dass man dieses angeschimmelte Wortgut noch in den Mund nimmt. Was ist denn das für ein weltfremder Mensch? Hat der nicht mitgekriegt, dass »galaktisch« längst ziemlich out ist?
Wörter, die man nicht mehr braucht
Die Wortwahl wandelt sich nicht allein mit der Mode, sondern auch mit dem Lebensalter, mit dem vorherrschenden Medienjargon, mit den politischen Systemen und Ideologien. Aber Wörter verschwinden auch, wenn kein gesellschaftlicher Bedarf mehr besteht. Das Wort Panzeralarm steht nicht einmal mehr im Duden. 1945 war es das wohl lebenswichtigste Wort für uns. Wenn die Sirenen auf den Dächern, die normalerweise Fliegerangriffe ankündigten, auf eine bestimmte Weise zehn Minuten lang heulten, hieß das: Alliierte Panzer rollen auf die Stadtgrenze vor, aber gleichzeitig: In ein paar Stunden ist der Krieg zu Ende.
Als der Frieden einzog, verschwanden die meisten Kriegsgeburten aus dem Sprachgebrauch. Wer redete noch vom Heldentod für Führer und Vaterland, von Stukapiloten, Gefrierfleischorden, wie die Betroffenen die Auszeichnung für die Teilnahme am Winterfeldzug gegen die Sowjetunion zu nennen pflegten, Kesselschlachten und verbrannter russischer Erde. Auch der Luftschutzkeller und der NS-Blockwart verloren ihren Rang. Der Christbaum war wieder ein reines Weihnachtsattribut und nicht mehr die Gruppe von Leuchtkugeln, mit der die Bombergeschwader ihr Zielgebiet absteckten. Einige Jahre darauf konnte man Lebensmittelkarten, Kleiderkartenpunkte, Bezugsscheine oder Tabakwarenzuteilung aus den Wörterbüchern streichen.
Nach Victor Klemperers berühmter Analyse der Nazisprache »LTI« (Lingua Tertii Imperii – Die Sprache des Dritten Reiches) »glitt ... der Nazismus in Fleisch und Blut der Menge« durch »die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden«. Der Nazijargon lebte folgerichtig noch so lange fort wie die Naziideologie in den Köpfen. Als die Menge aus dem Wahn erwachte, befreite sie sich auch sprachlich. Allmählich entledigte sie sich solcher Denkkategorien und Parolen wie Untermenschentum, Rassenschande, Vaterlandsverräter, Judenschule, Etappenschwein. Überflüssig wurden auch die Bezeichnungen Sturmbannführer, Pimpf, Führerbefehl, Braunhemd, Ariernachweis.
Die Nachkriegsperiode gebar neue Probleme und Wörter. Organisieren, das im Krieg einen ganz neuen Sinn erhalten hatte, wurde das meistbenutzte Tätigkeitswort für das Heranschaffen von allem Möglichen – Kartoffeln, Schubkarren, Kohlen, Künstlern, Alkohol –, meist auf krummen Touren oder mit Vitamin B (Beziehungen). Manch einer »organisierte« sich auch einen Persilschein. So nannte man schriftliche Bestätigungen dafür, dass man eine ganz weiße Weste hat, sich in Nazireich und Krieg nie etwas zu Schulden kommen ließ und deshalb nicht entnazifiziert werden muss. Aktive waren nicht die Aufbauhelfer, sondern Zigaretten aus der Schachtel, im Gegensatz zu den aus Kippen, Eigenbau oder Rauchertee selbstgedrehten. Sowjetsoldaten rauchten meist grob geschnittenen Machorka und stritten, ob sich als Papier dafür besser die »Prawda« oder die »Iswestija« eignet.
Zur Gegenwartssprache verweise ich auf Dutzende Beispiele für das Kommen und Gehen von Vokabeln in den 20 Lektionen »German for Sie«. Ich werde sie mir hier ersparen. Aber der aufmerksame Leser wird merken, dass zu einigen Themen schon wieder neue Wortsterne am Sprachhimmel erstrahlt sind, die dort fehlen, weil sie noch nicht geboren waren. Genannt seien nur Tsunami, Vuvuzela, Geodienste, Apps, googeln, twittern und guttenbergen.
Nie wieder Repermentieren
Die einzige Sportart, die ich mein Leben lang geliebt und betrieben habe, ist die Wortakrobatik. Wortspielereien sind mindestens so alt wie die Narren an den Höfen und die Streiche des Till Eulenspiegel. Wortwitze können sehr geistreich, sehr albern und sehr gequält sein, für die Macher mindestens ebenso unterhaltsam wie Kreuzworträtsel. Was haben wir in feuchtfröhlichen Stunden nach Redaktionsschluss nicht alles ersponnen oder wenigstens kolportiert: Misswahlen in der DDR. Miss Wirtschaft war Frau Mittag, Miss Bildung war Frau Honecker, aber es gab auch eine Miss Ernte, eine Miss Geburt, eine Miss Stimmung, eine Miss Billigung, eine Miss Etat, eine Miss Verhältnis und so fort. Dann kamen die Erfinderwitze in Mode: Garibaldi wurde zum Erfinder des Schnellkochtopfes, Puccini Erfinder des Staatsstreiches, Brecht-Schwiegersohn Schall sollte das Echo, Eisenhower den Schlaghammer entdeckt haben. Die zu DDR-Zeiten viel diskutierte Zittauer Aktivistin Frida Hockauf hielt jemand für die Schöpferin des Plumpsklos. Ihren Lehrsatz »So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben« wandelten wir ab in »So wie wir heute arbeiten, möchten wir morgen gewiss nicht leben«. Sehr beliebt war auch das Ausdenken von Sprüchen über Politiker, bei denen sich jeder denken konnte, was er wollte: Stoph bleibt Stoph, Erich währt am längsten, Sindermann macht’s möglich, Kulturpolitik macht Hager, Grotewohl ist mir am Abend.
Ein besonderer Spaß war die Bereicherung der Sprache durch frei erfundene Wörter wie Flatterbusen oder auch Schni (für die Abschalttempoquote bei gewissen TV-Sendungen wie Schnitzlers »Schwarzem Kanal«). Das Wort Ökologik entstand durch einen Schreibfehler und hat als Zufrühgeburt nicht überlebt, heutzutage wäre es vielleicht Kandidat für das »Wort des Jahres«. Die nicht existierende Muzope machten wir zu einem DDR-Produkt und brachten sie in mehreren Zeitungen unter. Dazu verweise ich auf Kapitel 2 meines Buches »Ich habe alles doppelt gesehen« (Seite 31 ff.). Bei der Erfindung eines so geheimnisvollen Vorgangs wie der reinen Phantasiegeburt »Repermentieren« gab es einen gewissen politischen Zusammenhang. Könnte das nicht nach einer neuen »Abweichung« klingen und wachsamen Gemütern Angst machen? »Beinah hätten se uns nun beim Repermentieren erwischt«, »Der Parteitag hat doch eindeutig Stellung gegen das Repermentieren bezogen«, »Der braucht sich nicht zu wundern, dass er in die Wüste geschickt wird, wenn er dauernd repermentiert«. Wir waren innerlich stolz, schüttelten aber scheinbar bedenklich den Kopf, wenn einer zugab, davon nie gelesen zu haben und gar nicht zu wissen, was das ist.
Manche machten ihre Wortspielchen in Form von »anonymen« Redensarten, die nur aus häufig benutzten Phrasen bestanden, aber Prädikat und Thema ganz wegließen: »Kaum dass se nun, wer’mer doch nich schon wieder«, »Wenn die das nun noch, hamm se uns alle am Arsch«, »Hat der doch glatt, und dann schämt er sich nicht mal«. Das waren manchmal hinterlistige Anspielungen, die Insider verstanden und zu ergänzen vermochten. Meist war es überhaupt nicht zweckbestimmt, kein versteckter Protest, sondern Sprach- und Hirnakrobatik. Oder war es nicht einmal das, sondern einfach nur Geblödel?
Heim ins Bermudadreieck
Will man am Schluss eines Kapitels, das mit dem Widerstreit zwischen Dialekt und Hochdeutsch begann, noch einen Blick auf die Zukunft der Sprache werfen, so ist die Frage erlaubt, ob Deutsch überhaupt eine Überlebenschance hat. Man warte mit dem kollektiven Aufschrei »Selbstverständlich!« ruhig einen Moment. Mehr und mehr Kinder in Europa – Deutschland ist da noch weit zurück – lernen bereits im Kindergarten als Zweitsprache spielend Englisch, schon um später die Cover auf den DVDs lesen zu können. Es wird keine hundert Jahre dauern, bis man in Italien Italienisch und Englisch, in Griechenland Griechisch und Englisch, in Polen Polnisch und Englisch, in der Schweiz Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch fließend spricht. In Deutschland wird Deutsch mit Englisch nicht allein bleiben können. Über 15 Millionen Menschen auf dem Territorium unseres Landes haben schon heute ihre sprachlichen Wurzeln anderswo, allein an die 2,5 Millionen im Türkischen. Kann das Sprachelernen da immer nur die anderen angehen?
»Der deutschen Sprache wird also einiges zugemutet«, fasst der Germanist Karl-Heinz Göttert in »Deutsch – Biografie einer Sprache« die Problematik zusammen. »Von außen kommt das Englische, von innen steht es mit zahlreichen Sprachen aus Europa und der Welt im Wettbewerb.« Aber welche Wettbewerber haben die besten Chancen? Die Muttersprachen von Özil, Podolski und Robben besitzen zumindest keine Vorteile gegenüber der von Müller und Ballack auf dem Weg in ein vielsprachiges Europa und ein mehrsprachiges Deutschland. Göttert ist der Überzeugung, dass Deutsch gut gerüstet in den Sprachenwettbewerb geht, wenn es sich ihm stellt und sich noch mehr für das Neue, für das »Fremde« öffnet.
Vielleicht bringt die Mehrsprachigkeit der globalisierten Welt auch dem Sächsischen, dem Bayrischen, dem Schwäbischen und dem Plattdeutschen Vorteile. Die Rückkehr zu den heimischen Dialekten, wo man die »Nestwärme der Regionalität« findet, wird zunehmen. Also »Heim ins Bermudadreieck«, wenigstens nach Feierabend, und lassen wir uns nicht verdrießen, wenn sich Lene Voigt über unsere »scheißliche Ausschbrahche« und unseren »ähländn Dialäggd« beschwert. Morgen früh bei Arbeitsbeginn heißt es ja doch wieder »Yes, we can« – auch Hochdeutsch.