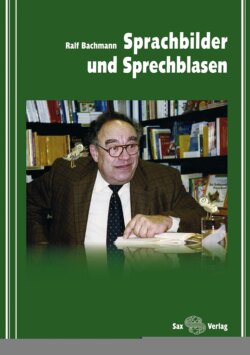Читать книгу Sprachbilder und Sprechblasen - Ralf Bachmann - Страница 9
Kapitel 2 Ist der Übersetzer der Chef vom Untersetzer?
ОглавлениеGedanken über das Wunder der Sprachbilder und über Stilvarianten der Unzucht im Heidekraut
»Jede Sprache, die sich frei betätigen darf, dient allen menschlichen Bedürfnissen, sie dient der Vernunft wie dem Gefühl, sie ist Mitteilung und Gespräch, Selbstgespräch und Gebet, Bitte, Befehl und Beschwörung.«
Victor Klemperer
1945 stand ich als blutjunger Volontär der »Nachrichten für Grimma« hinter unserem ebenerdigen Verlagsschaufenster und wunderte mich über einige Knaben, die obszöne Gesten in unsere Richtung machten und sie mit ebensolchen Rufen begleiteten. Als des Rätsels Lösung erwies sich eine kleine Notiz auf der Lokalseite: »In der Handschuhfabrik M. & P. Händel brach gestern ein Feuer aus, das aber noch vor Eintreffen der Feuerwehr von den männlichen Gliedern der Belegschaft gelöscht werden konnte.« Alles an diesem Text stimmte, nur das Bild nicht. So kam ich eines Tages auf die Idee, komische Bildstörungen zu sammeln und blieb dabei bis heute.
Im Bild sein ist immer, in der Sprache aber besonders wichtig. Die bildliche Wendung ist ihr emotionalster und schönster Teil, vielleicht die ursprünglichste Form der Menschen, sich künstlerisch zu artikulieren. Allerdings kann man sich auch mit kaum etwas so leicht lächerlich machen wie mit dem Verstümmeln und Verdrehen bildhafter Redewendungen, seien sie noch so abgenutzt und verblasst. In der ARD-Dauerserie »In aller Freundschaft« dient ein Pfleger Brunner zeitweise als Witzfigur, weil er alle Sprichwörter verballhornt. (Der tüchtige Buchdrucker Johann Ballhorn, der im 16. Jahrhundert in Lübeck wirkte, ist übrigens ganz ungerechtfertigt zum sprichwörtlichen Urvater aller Verschlimmbesserungen gemacht worden.) Brunner sagt, wenn den Autoren nichts Besseres einfällt, »Schmiede das Glück, so lange es heiß ist« oder »Morgenstunde ist aller Laster Anfang« oder »Steter Tropfen höhlt den Fluss«. Ein beliebter ausgedachter Bildwitz ist: Das schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht. Ein Klassiker meiner Sammlung übertrifft ihn: Der Zahn der Zeit, der so manche Träne getrocknet hat, wird auch über diese Wunde Gras wachsen lassen.
Trainer unter Zugzwang und eine Nase im Ring
Meist entstehen solche Zerrbilder aber unabsichtlich durch Versprecher oder Denkfehler. Als die reizende TV-Moderatorin Caren Miosga von einer »kläffenden Wunde« sprach, dachte sie vielleicht eher an »klaffende Hunde«. Unter Zugzwang litt als damals Stuttgarter Fußballtrainer Markus Babbel mit der Forderung: »Wir müssen uns selbst bei den Haaren aus dem Schopfe ziehen.« Sein Amtskollege bei der Potsdamer Frauenmannschaft, Bernd Schröder, dämpfte Befürchtungen mit der Versicherung: »Unsere Spielerinnen sind so konstruiert, dass sie nicht in den Himmel wachsen.« Bruno Labbadia aus der nämlichen Zunft schränkte aber mit Recht ein, das dürfe man nicht hochsterilisieren. Franz Müntefering wiederum verwahrte sich im Fernsehen energisch dagegen, die »SPD mit der Nase durch den Ring zu ziehen«. Er hat wohl allzu viele Boxübertragungen gesehen. Das echte Sprachbild geht auf einen anderen Ring zurück, den Ring durch die Nase, mit dem einst Schausteller Tanzbären auf den Jahrmärkten vorführten.
Münteferings Version klingt ähnlich sonderbar wie die Sache mit dem Kamel, das laut Matthäus 19.24 eher durch ein Nadelöhr kommen kann als ein Reicher in den Himmel. Müsste sich ein halbwegs aufgeweckter Leser nicht fragen, wie der begnadete Redner Jesus darauf gekommen sein sollte, ausgerechnet das völlig ungeeignete Wüstentier für so eine Gegenüberstellung zu wählen? Doch Luther bemerkte vielleicht nur bei der Bibelübersetzung nicht, dass da vermutlich ein Schreibfehler unterlaufen war. Die alten irischen Mönche, auf deren Bibelabschrift sich Luther stützte, erkannten wohl als ausgesprochene Landratten die Bedeutung des griechischen Wortes kamilos nicht und lasen es als kamelos, Kamel. Kamilos heißt »Seil«, »Schiffstau«. So ein dicker Strick passt zwar nicht durch ein Nadelöhr, dafür umso besser zu dem biblischen Vergleich. Eine andere, weniger originelle und wahrscheinliche Erklärung bezieht sich auf ein für Kamele zu kleines Tor in der Jerusalemer Stadtmauer.
Auch eine Berliner Tageszeitung ist einmal an einem Sprachbild gescheitert, an »einer Katze, die sich selbst in den Sack beißt« (statt, wie sich’s gehört, in den Schwanz). Vielleicht war die Autorin Feministin und wollte nicht, dass Sprichwortkätzinnen weiter verwehrt bleibt, was Kater seit jeher können, wenn sie nur schmerzresistent sind.
Chinesisch als böhmisches Dorf
Die Schreiber dürfen sich trösten. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Selbst Große verirren sich im dichten Sprachwald dann und wann. Goethe, der im »Faust« den goldenen Baum des Lebens grün sein ließ, schrieb in seinem »Werther«: »Das waren dem Gehirne spanische Dörfer.« In seinem Gehirne hatten sich zwei Redensarten verheddert, wie der Sachse sagt. Da können einem böhmische Dörfer schon mal spanisch erscheinen. Die »Berliner Zeitung« wurde von dem geflügelten Wort zu kühnen geografischen Phantasien angeregt: »Darüber hinaus ist Chinesisch für Mitteleuropäer eher ein böhmisches Dorf.« In Spanien sagt man übrigens: Das kommt mir sehr chinesisch vor.
Gefährlich sind Alltagssprachbilder, deren ursprünglicher Sinn kaum noch wahrgenommen wird. Wer denkt beim Wink mit dem Zaunpfahl noch an einen Zaun – und doch ist es nüchtern betrachtet albern, wenn man das schnurrende Betteln der Katze um einen Leckerbissen als Wink mit dem Zaunpfahl bezeichnet. Komisch wirkte auch, als ein Rundfunkreporter auf einem Schriftstellerkongress bemerkte, dass ein Redner mit einer bestimmten These »die schlafenden Hunde geweckt« habe. Welche Autoren danach zu bellen begannen, erfährt man nicht. Noch schöner war im selben Text: Ihm lag ein flammender Protest bleiern auf der Zunge. In einem Reisefeature aus dem Thüringer Wald meinte der offenbar sehr tierliebende Journalist mitleidig: »Zugpferde im verschneiten Wald sind im Grunde arme Schweine.« Wie wahr! Aber im Schlachthof träumen die armen Schweine davon, wie schön es wäre, lieber Zugpferde im verschneiten Wald zu sein.
Bei mancher Redensart kann man erraten, wie sie entstanden sein dürfte. Hört man »Das ist für die Katz«, so fällt einem ein, wie nutzlos es ist, Katzen zu füttern und nicht Kühe oder Schafe: Katzen legen keine Eier, geben keine Milch, liefern keine Wolle, eignen sich für keinen guten Braten. Bewiesen ist diese Herkunft nicht, dafür erscheint sie logisch. Wer hat sich aber schon einmal den Kopf darüber zerbrochen, was unsere Sprache alles mit der Leber anstellt. Ich denke nicht an »Die Leber wächst mit ihren Aufgaben«, womit Eckart von Hirschhausen die Sprachbilderkette bereichert hat. Da ist der Ursprung klar. Aber warum reden wir – ausgerechnet – frei von der Leber weg? Warum hat jemand etwas auf der Leber? Warum ist ihm eine Laus über die Leber gelaufen? Warum war selbst die beleidigte Leberwurst einst nur eine gekränkte Leber? Warum hängen wir das in drei Teufels Namen nicht der Niere, dem Magen, vielleicht noch der Seele an? Die Leber ist doch eigentlich im Volksmund für Alkoholverarbeitung zuständig – siehe Hirschhausen oder Redensarten wie: Er hat eine trockene Leber, eine Schluckleber usw.
Die Antwort fand ich im vorzüglichen Lexikon »Sprichwörtliche Redensarten« von Lutz Röhricht. In der mittelalterlichen Medizin galt die Leber als der Sitz der Lebenssäfte und des Temperaments, also auch leidenschaftlicher Empfindungen wie des Zorns. Frei von der Leber weg reden ist also eigentlich ein Anachronismus, diese Funktion haben heute nach unserem Empfinden ganz andere Organe. Erst wenn wir unserem Herzen Luft machen und wenn uns die Galle überläuft, sind wir sprachmedizinisch auf der Höhe der Zeit oder, wie man auf Deutsch sagt, up to date.
Zumindest höherer Blödsinn
Ein weiteres markantes Ausdruckselement der Sprache ist der Klang der Wörter. Als Kinder hatten wir in Leipzig eine Geheimsprache: »Dielefi ilefist dulefumm.« Beherrschte man die stereotype Machart, verstand man das Gemeinte auch ohne Dechiffrierung, denn: »Wilefir silefint gelefescheilefeit.« Vor etlichen Jahren las ich, wie ein Gedicht des britischen Kinderbuchautors Lewis Carroll (»Alice im Wunderland«) neu übersetzt worden ist:
Verdaustig wars, und glasse Wieben
Rotterten gorkicht im Gemank;
Gar elump war der Pluckerwank,
Und die gabben Schweisel frieben.
Gereimter Quatsch? Vorsicht. Die wichtigsten Wörter sind zwar ersponnen, aber der Text löst trotzdem Empfindungen aus, er klingt, als ob sich jemand in einer miesen Situation – im Sumpf? – elend fühlt. Wie kommt das? Da sind Laute, da sind Ähnlichkeiten mit Sinnvollem. Zumindest höherer Blödsinn also. Vokale und Buchstabengruppen können hart oder weich, lockend oder drohend, angenehm oder unappetitlich klingen, jeder weiß, dass ein »Aaah« das Gegenteil von einem »Äääh« ist, dass »Oooh« Freude und »Öööh« Protest ausdrückt. Ganz unabhängig von der Bedeutung hört sich Mutschekuh lieb und Ochsenschleim eklig an. Gute Werbeleute wissen und nutzen das.
Der zu Unrecht fast vergessene Dichter und Epigrammschöpfer Friedrich von Logau (1604 –1655) rühmte die Breite der Klangpalette unserer Muttersprache:
Kann die deutsche Sprache schnauben,
schnarren, poltern, donnern, krachen,
kann sie doch auch spielen, scherzen,
lieben, kosen, tändeln, lachen.
Was ist das Gegenteil von a priori?
Aber aufgepasst! Der Klang und andere Ähnlichkeiten können auch irreführen. Dolmetscher sind damit so oft auf die Nase gefallen, dass sie von »falschen Freunden« sprechen. Wie nahe sind sich Amor und Amok. Wie hässlich klingt Gemeinnutz, wie schön dagegen Grünspan und Blausäure. Das Gegenteil von Antithese ist nicht Prothese, der Übersetzer nicht der Chef des Untersetzers. Cappuccino kann man nicht den Kapp-Putsch ankreiden, und der Weg vom Exhibitionisten zum Ausstellungsleiter ist weit. Als mein Sohn mit fünf Jahren zum ersten Male von Aftershave hörte, grinste er hintergründig. Auf die Frage, ob er denn wisse, was das ist, antwortete er prompt: »Na klar, was Scharfes für’n Hintern.« Meine Tochter reagierte im gleichen Alter auf das Wort Kotflügel mit einem spontanen »Iiih!«. A priori bedeutet von vornherein, aber apropos mitnichten von hinten hinein. Genug der Beispiele.
Wer schon mal einen Anzeigentext aufsetzen musste, weiß: Umgangssprachliche Wörter sind dafür meist unbrauchbar. Warum? Es gibt Stilebenen mit vielen Abstufungen: die stilistische Null-Färbung, den gehobenen Stil, die Vulgärsprache. Nehmen wir eine Todesanzeige. Da steht vom so plötzlich Dahingeschiedenen, vom teuren Toten, den der Herr zu sich genommen hat, der von schwerem, tapfer ertragenem Leiden erlöst wurde, der ewig in unserem Gedächtnis leben wird. Das sind die feierlichen Varianten. Der ist krepiert, verreckt, abgenippelt, den hat der Teufel geholt, dem tut kein Zahn mehr weh, der hat ins Gras gebissen, seinen Löffel abgegeben. So hört es sich vulgär an. Neutral wäre gestorben, verschieden, einer langen Krankheit erlegen, den letzten Atemzug getan.
Nicht nur Humoristen leben von der Vermischung der Stilebenen. In der Laienspielgruppe übten wir: Der Riese sprach mit dröhnender Stimme: »Mama, ich muss mal pullern.« Oder nehmen wir bei Kurt Tucholsky die Unterhaltung des Dieners mit der Hausherrin: »Meinen Frau Gräfin nicht auch, dass dies ein rechtes Scheißwetter sein dürfte?« Ein einziges Wort aus dem Gassenjargon verwandelt die höfisch formulierte Frage in einen Witz. Auf einer ähnlichen Basis beruht die Wirkung von Joschka Fischers berühmten Zwischenruf im Bundestag (1984): »Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.«
Wenn Regierungspolitiker von etwas reden, das ihnen gründlich in die Hose gegangen ist, verwenden sie gern die euphemistische Floskel »Es war suboptimal«, die Opposition spricht dagegen von »kläglichem Scheitern«, das Volk denkt an die Hose und wertet klar und deutlich: »Absolut beschissen«. Einschränkend sei bemerkt, dass die Grenzen nicht selten fließend sind. Manchmal ist vom vulgären Anmachgruß »Eh du« zum schwärmerisch gehobenen »Mein Mäuseschwänzchen« inhaltlich und zeitlich nur ein winziger Abstand.
Drei Birken, drei Tage, drei Stile
Wie unterschiedliche Stilebenen die Schilderung des gleichen Vorgangs bis fast zur Unkenntlichkeit zu verändern vermögen, kann man am Beispiel eines Vorkommnisses demonstrieren, das auf das Ende des 19. Jahrhunderts datiert wird. Nehmen wir zunächst die Notiz einer zeitgenössischen Lokalzeitung in relativ emotionsloser, neutraler Form, die gestelzt, aber stilistisch ungefärbt klingt. Dann folgt eine mit Vulgärelementen durchsetzte umgangssprachliche Darstellung. Version drei dürfte zumindest für ältere Leser zum Déjà-vu-Erlebnis werden. So ist das Ereignis in der lyrischen, gehobenen, freilich nicht unumstrittenen Sprache des Natur- und Heimatdichters Hermann Löns in die Literatur eingegangen und wird als Lied noch heute von Fischer- und anderen Chören geschätzt.
Sittenskandal in der Heide – Exklusivbericht des »Lüneburger Stadtanzeigers«
Von unserem Gesellschaftsreporter Graf Otto von Knochenmarck
Im niedersächsischen Amtsbezirk Celle sah sich Mitte Mai der für die öffentliche Ordnung in den nicht landwirtschaftlich genutzten Bereichen der Lüneburger Heide verantwortliche Polizeibeamte gezwungen, ein Pärchen wegen sittenwidrigen Verhaltens und Erregung öffentlichen Ärgernisses festzunehmen. Es hatte bei einer Gruppe von sieben Birken gelagert (in seiner Aussage räumte der inhaftierte Mann nur drei ein, was aber für die Bewertung des Vorfalls nicht von Belang sein dürfte) und unter freiem Himmel wiederholt diverse obszöne Sexualhandlungen vollzogen. Nach drei Tagen geduldiger Beobachtung hielt es der Vertreter der Staatsmacht für unumgänglich einzuschreiten, zumal in dieser Gegend nicht selten Kindergruppen mit ihren Gouvernanten zu wandern pflegen, die möglicherweise unfreiwillig Zeugen der schamlosen Exzesse geworden wären.
Der Ordnungshüter nahm das Paar in vorläufigen Polizeigewahrsam und wies es bis zur Klärung der Identität in das Gefängnis der Stadt Celle ein. Das minderjährige, aber auffallend entwickelte und körperlich frühreife Mädchen wurde sogleich wieder entlassen und in die Obhut seiner besorgten Eltern, Besitzer der in Celle und Umgebung sehr renommierten Nachtbar »Zur scharfen Erika«, gegeben. Sie hatten des Verschwindens ihrer Tochter wegen umgehend Anzeige erstattet. Dagegen wurde der höchst ungepflegt aussehende und gekleidete Mann, der als fahrender Geselle keinen festen Wohnsitz oder Arbeitsplatz anzugeben vermochte, im Schnellverfahren zu einer mehrtägigen Haftstrafe verurteilt.
Der Heidepolizist beobachtete ihn im Spätherbst noch einmal bei der besagten Gruppe von drei bzw. sieben Birken, wo er offenkundig vergeblich ein Wiedersehen mit dem Mädchen erhoffte. Die Enttäuschung über dessen Ausbleiben, verstärkt noch durch die herbstlich triste Witterung und den öden Anblick des leeren Gezweigs lösten bei ihm eine verzweifelte Stimmung und wohl sogar Suizidgedanken aus, wofür der Ausruf »Mein Schatz, ich seh’ dich niemals mehr« sprechen könnte, den der Beamte gehört haben will.
Die wirkliche Wahrheit über die Birkenorgie
Erzählt von Fietes bestem Freund Schnuckenede
Mein alter Kumpel Wacholderfiete, der versaute Bock, hatte nach etlichen Pleiten eine sexversessene Kneipiersgöre aufgegabelt. Beim Kippenstechen an einer Penne hatte er gemerkt, dass ihm ein kesser frühreifer Fratz geile Blicke zuwirft. Da war ihm scheißegal, dass er in der Pause auf dem Schulhof von lauter Bälgern umringt war. Er schmiss sich an die Puppe ran und säuselte: »Um Sechse bei den drei Birken.« Sie wusste auf Anhieb, was das heißt und wo das ist und nickte heftig, ohne rot zu werden.
Die Kleene kam pünktlich und war bloß in einen dünnen Fetzen gehüllt. Fiete hatte sich aber schon oft die Pfoten verbrannt. Er machte aus Daffke erstmal Taschenkontrolle bei ihr. Dabei griff er aber bloß zwei schäbige Zehner, einen Flachmann mit irgendwelchem Fusel, eine Tüte Blaubeeren, ein süß riechendes Parfüm, fünf Gummiüberzieher und, weiß der Deubel wofür, einen feuchten Waschlappen und eine Rotzfahne – alles unverdächtig. Es konnte losgehen. Sie rissen sich hastig die Klamotten vom Wanst und wälzten sich bei Sonnenschein und Vögelgesang vor Wollust im Heidekraut. Großmäulig prahlt Fiete seitdem von seinen drei B-Tagen: nur Beeren, Bechern und Bumsen.
Im Suff, wenn er um anzugeben wie ein Schentelmän quatscht, redete er spitzmäulig von »Schlafen bei Mutter Grün«. Als wir daraufhin laut losbrüllten, kotzen täte er aber im Scheißhaus von Mutter Blau, mimte er auf einmal den großen Manitu: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ihr seid zu doof, das grüne Wunder zu begreifen. Klugscheißen kann Fiete nämlich, wenn er Lust hat, ganz gut. Grün ist Hoffnung, Grün ist Zukunft, einmal wird Grün die Welt regieren, um sie zu retten, blökte er uns wutschnaubend an. Wir haben uns ausgeschüttet über sein Geschwätz. Mensch, dachten wir, ist der im Tran!
Aber zur Sache: Die drei Birken, der Gerichtshof machte Riesenzoff, weil es vor dem letzten kalten Winter sieben gewesen sein sollen, und die Wacholdersträucher schützten die Beiden, wie Fiete glaubte, ganz gut vor Feindeinsicht. So hätten sie ihre neckischen Sauereien auch länger als 72 Stunden abgezogen, wäre nicht plötzlich ein Bulle mit Pickelhelm aufgekreuzt, dem die Eltern wohl mit Knete Beene gemacht hatten. Er haute Fiete eins aufs Maul, wie er sagte in vorbeugender Notwehr, und packte ihn und das Madamchen brutal am Genick. Abhauen war also nicht. Ehe sie sichs versahen, hatte er ihnen Handschellen angelegt und sie in den Celler Knast abgeschleppt. Das Gör wurde von den Alten schon erwartet und mit viel Gesums und »Armes Kind«-Gejammer weggeschleift.
Fiete aber merkte, dass er wieder einmal mit bloßen Fingern in brauner Stinkbrühe steckte. Mag das Mädchen weiter geil wie Schifferscheiße gewesen sein, nun hatte sie zu Hause verschärften Stubenarrest und er in der Zelle auch. Ein Schnellrichter verknackte ihn wegen Landstreicherei und versuchter Unzucht mit Kindern. Strafverschärfend war, dass er keine Bude und keine Penunzen, dafür aber die große Schnauze hatte und randalierte. Sogar gegen den Befehl, Zelle und Exkrementeneimer selber sauber zu halten, protestierte er großfressig. Das wäre »mittelalterliche Zwangsarbeit« giftete er ganz kommunistisch und: »Scheiße ist Volkseigentum und muss auch vom Volk weggeräumt werden.«
Nach langem Dummtun machte die Exjungfer ihren Erzeugern ein Friedensangebot, das die annahmen. Sie hatten Schiss um ihren schwer bezahlten Bonzenplatz in der ersten Kirchenbank und um die Absatzchancen auf dem Heiratsmarkt. Wenn sie sich für Fietes Freilassung engagierten, könnte sie schwören, dass sie auf ihn künftig pfeift, dass alles fast platonisch war und sie jeder gut betuchte Freier noch unbefleckter als die Jungfrau Maria kriegen würde.
Erst im Herbst ging Fiete wieder mal zu den Birken. Die feixten über das Zifferblatt des alten Sacks: in Falten gelegt wie ein Plisseerock und angesäuert wie ein Rollmops. Na ja, er war frei, aber diese fiese Junghure hatte es doch tatsächlich fertiggebracht, einen Kerl wie ihn sitzen zu lassen. Dazu das Mistwetter hier, das Gezweig kahl wie Kinderarsch und kein neues Heideliebchen weit und breit. So hängte er seine langen Löffel in den Wind, um mitzukriegen, was die Birken rauschten, verstand aber nur: Der Schatz ist verduftet, den siehste nie mehr.
Es stehn drei Birken auf der Heide
Von Hermann Löns (1866 –1914)
1. Es stehn drei Birken auf der Heide,
valleri und vallera,
an denen hab ich meine Freude,
juppheidi heida;
die Lerche sang, die Sonne schien,
da schliefen wir bei Mutter Grün.
2. Drei Birken sind es und nicht sieben,
valleri und vallera,
ein schönes Mädchen tat ich lieben,
juppheidi heida;
drei Tage lang auf grüner Heid,
da war sie aus, die schöne Zeit.
3. Es kam der Spitzhut angegangen,
valleri und vallera,
er hat uns beide eingefangen,
juppheidi heida;
zu Celle steht ein festes Haus,
mit unsrer Liebe ist es aus.
4. O schönes Mädchen, meine Freude,
valleri und vallera,
es stehn drei Birken auf der Heide,
juppheidi heida;
doch ihr Gezweig ist kahl und leer,
o Schatz, ich seh dich niemals mehr.
Der »fremde Etrangeer« aus Treuenbrietzen
In unserer schweren Zeit wird allenthalben zur Sparsamkeit ermahnt, warum nicht auch beim Wortgebrauch? Doppelt moppeln ist eine Sprachuntugend, die vor allem im Berlinischen durch die Mischung des Adelsfranzösisch mit dem heimischen Dialekt eine lange Tradition hat. Wer erkennt noch an »mutterseelenallein«, dass der erste Wortteil den zweiten überflüssig macht. »Mutterseel« ist nämlich dem Klang von »moi tout seul« nachgebildet, was nichts anderes als »Ich ganz allein« heißt.
Ein noch hübscherer Pleonasmus, wie man die weißen Schimmel wissenschaftlich nennt, findet sich in einem Originaltext des beliebten Berliner Küchenlieds: »Sabinchen war ein Frauenzimmer gar hold und tugendhaft.« Dort hieß es nämlich über den Schurken, der »silberne Blechlöffel« klaute: »Da kam aus Treuenbrietzen ein fremder Etrangeer«, also ein fremder Fremder. Der Grund für derlei Doppelungen ist leicht zu erraten: Man wollte so sprechen wie die feinen Herrschaften, hatte aber Angst, es nicht richtig zu können und nicht verstanden zu werden. Also fügte man vorsichtshalber die Erklärung hinzu. Dem gleichen Topf sind »infame Gemeinheit«, »konträres Gegenteil« und »gegenwärtig nicht momentan« entnommen. Wie konstatiert der Berliner Lokaldichter und Erfinder des Eckenstehers Nante, Adolf Glaßbrenner: »Tugend ist nur Mut zur Courage.«
In der ehemaligen DDR spöttelte man gern: »Spare mit jedem Pfennig, koste es, was es wolle.« Ehemalige DDR? Das hätte nur Sinn, wenn irgendwo eine zweite herumläge, die noch existiert. Aber manche haben Angst, als Nostalgiker zu gelten, wenn sie etwas von früher erzählen und dabei einfach DDR sagen, so wie sie in Berlin gar die Erdachse wenden und vom ehemaligen Ostteil der Stadt reden. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck liebt »einander gegenseitig«. Das ist genauso eine Tautologie wie bei RTL das Versprechen der Regierung, einen »neuen Start anzufangen« und im Inforadio Berlin-Brandenburg »der frühere Ex-Präsident Clinton«. Das ZDF berichtet über »gescheiterte Testversuche« von BP im Golf von Mexiko. Kanzlerin Merkel verkündet, Europa sei in der Realität der Wirklichkeit angekommen. Hoffentlich erkennt es dort die tatsächlichen Fakten. Bundespräsident Wulff versichert vor einer Japanreise, es gehe dabei um Zusammenarbeit, gar – welche Sensation – um gemeinsame Zusammenarbeit, wo man doch im Normalfall, schon um Streit zu vermeiden, nur mit sich selbst zusammenarbeitet.
Wenn wir schon bei den Sprachsünden des Alltags sind, sei auch ein Wort zur sogenannten Überfremdung gesagt. Wird die Sprache verhunzt, wenn sie Fremdes aufnimmt? Schon im 17. Jahrhundert entstanden Sprachgesellschaften wie die »Teutschgesinnte Genossenschaft«, die der sich erst herausbildenden deutschen Nationalsprache als einem die ganze Nation umschlingenden Band huldigten und Fremdwörter als Gefahr bekämpften. Das war ein zweischneidiges Schwert. Einerseits war die sprachliche Einheit tatsächlich eine schützenswerte, noch zarte Pflanze, andererseits waren die Nachbarländer wie Italien und Frankreich auf vielen Gebieten Deutschland weit voraus und ein Anschluss an die internationale Entwicklung ohne die Übernahme fremden Sprachguts undenkbar.
Die Bemühungen um »Sprachreinigung« waren also eine Gratwanderung. Mit Spott wurde schon damals auf Übertreibungen wie die Ersetzung von Urne durch Leichentopf, von Fieber durch Zitterweh, Nase durch Gesichtserker, Fenster durch Tageleuchter und Nonnenkloster durch Jungfernzwinger reagiert. Zur Goethezeit wollten »Puristen« Schalkernst für Ironie, Süßchen für Bonbon, Lotterbett für Sofa einführen. Lächerlich waren die Überspitzungen, nicht aber die Bemühungen. Die vernünftigen Vorschläge blieben erhalten, oft neben dem kritisierten Ursprungswort: Abstand und Distanz, Anschrift und Adresse, Mundart und Dialekt, Bücherei und Bibliothek, Zerrbild und Karikatur, Stelldichein und Rendezvous, Feingefühl und Takt. Goethe sah die Sache so: »Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern dass sie es verschlingt.«
Geschlechtsleben hat gegen Sex keine Chance
Das gilt heute mehr denn je. Es lohnt sich, um unseren Sprachschatz zu kämpfen. Ob der Kampf Erfolg hat, hängt meiner Meinung nach nicht nur von der Mode, sondern bei jedem Wort vor allem von drei weiteren Faktoren ab: Verständlichkeit, Wohlklang und auch moderne Sprachökonomie. Das langatmige Geschlechtsleben hat am Ende gegen den kurzen und gut klingenden Sex keine Chance. Einchecken ist hässlich, ersetzt aber einen ganzen Satz. Job ist griffiger und knapper als Berufsarbeit. Man muss trotzdem nicht tatenlos zusehen, wie aus ehrlicher Arbeit jobbender Einheitsbrei wird und am Ende alle jobben: der Straßenfeger und der Lyriker, der Zuchtbulle und der Kurienkardinal. Selbst das Kitakid, das einst ein Kindergartenkind war, wird nach dem Topfgang für guten Job gelobt. Bei schlechtem Job halten wir es weiter mit der vertrauten und klangstarken deutschen Scheißarbeit. Die Kitakinder sind da aus Gründen der Logik ein Sonderfall.
Die sogenannte Reinheit der deutschen Sprache zu wahren ist eine schier unlösbare Aufgabe, weil sie selbst darauf pfeift. Die Umgangssprache schnappt alles auf, was ihr über den Weg läuft und gefällt. Kaum sagt einer cool, schon greift sie danach. Dann folgt crazy und sexy, Shopping und Date, Fast Food und Superhit, Event und Homepage, gecastet und gemailt, ausbaldowern und roboten, online und Software. Manches Wort ist so schnell wieder weg, wie es kam, manches wird, wie es Goethe empfohlen hat, einverleibt, bis nichts mehr fremd an ihm klingt.
Auf der vorletzten Seite war von der Zeit die Rede, als Preußens französisch sprechende Adelshäuser – selbst der große Friedrich musste zugeben »Deutsch kann ich nicht gut« – und die Hugenotten, die eine so zahlreiche Minderheit waren wie jetzt die Türken, später auch Napoleons Besatzer in Berlin für eine Frankofonie sorgten, die dem Denglisch von heute durchaus vergleichbar war. Behalten haben wir etwa Bulette und Erbspüree, Filet und Roulade, Bluse und Kostüm, Toilette und elegant, Balkon und Chance, Revanche und Milieu, Malheur und Mayonnaise (die man neuerdings auch Majonäse schreiben darf), Salon und Sabotage, da und dort sogar Esprit. Wir sagen bis heute Charité, Gendarmenmarkt, Budike, Fete, Promenade. Die Berliner fanden Spaß daran, ihre eigenen Wörter mit Endungen zu französisieren: Kneipier, Stellage, Kledasche, schikanös. Bei manchem Wort errät keiner mehr die Herkunft – Grieben (gribelettes), Kinkerlitzchen (quincailleries – wertlose Kleinigkeiten), Muckefuck
(mocca faux = falscher Kaffee). Manches korrigierte das Leben, so wurde aus dem Billett das (englische) Ticket, das wiederum mit der Fahr- und der Eintrittskarte koexistiert. Die deutsche Sprache hat alles überlebt, nichts eingebüßt und sogar noch gewonnen.
Ohne Wortimporte weder Perestroika noch Schokolade
Ein knappes Drittel des deutschen Wortbestands hat einen Migrationshintergrund, wie man heute so korrekt wie unschön sagt. Manches importierte Wort ist ein Schmuckstück unserer Sprache geworden. Wer möchte schon auf Perestroika und Glasnost verzichten, die wir den Russen verdanken, auf den Tollpatsch, der aus Ungarn stammt, die Schokolade, der man Altmexiko nicht mehr ansieht, und gar die Hängematte, gegen die wohl nicht einmal die »Teutschgesinnten« etwas einwenden würden. Das, was sie bezeichnet, ist jedem bekannt. Aber wer weiß, dass die aufgehängten Schlafnetze eine Erfindung der Eingeborenen der karibischen Inseln sind, die von den nässe-, ratten- und mäusegeplagten Matrosen des Kolumbus vor 500 Jahren begeistert aufgegriffen wurde. Bei den Indianern hießen sie »hamaca« (in den karibischen Sprachen heute noch), die Holländer machten daraus zunächst Hangmac, was die Volkssprache der Logik wegen in Hangmat verwandelte. Nun blieb zur deutschen Hängematte nur noch ein Schritt. Ich gestehe gern, dass ich von alledem keine Ahnung hatte, bis ich die spannende Einsendung von Ulrich A. Schmidt aus Castrop-Rauxel im von Prof. Dr. Jutta Limbach herausgegebenen Buch »Eingewanderte Wörter« lesen konnte.
Zusammenfassend darf man für alle ängstlichen Gemüter konstatieren, unsere Sprache wäre arm ohne Griechen (Demokratie, Parallele, Patriot, Philosoph, Muse, Fantasie), Lateiner (Amulett, Zettel, Wein, Lokus, Tempo, Fenster), Italiener (Kredit, Giro, Mosaik, Posse, Adagio, Pizza, Kohlrabi, Trüffeln), Franzosen (Dessous, Pantoffel, Boutique, Resümee, Bonbon, Negligé, Rendezvous, Gourmet), Juden (Dalles, Massel, meschugge, Mischpoche, Schlemihl, beschickert), Russen (Sputnik, Datsche, Apparatschik, Kosmonaut, Wodka, dawai, nitschewo, in der DDR auch in der pikanten Variante Weltnitschewo), Türken (Sofa, Papagei, Tasse, Limonade, Fanfare, Spinat, Jogurt) und all die anderen. Mag mancher Politiker tönen, Multikulti sei endgültig gescheitert – die moderne deutsche Sprache atmet den Geist eines gesunden Multikultismus.
Sie wäre weltweit isoliert, würde sie auf die Anglizismen verzichten. Karl-Heinz Göttert spricht in seiner schon in Kapitel 1 zitierten Biografie der deutschen Sprache von einer Brückenfunktion des Englischen, sie sei eine »Lingua franca«, eine freie Sprache, geworden. Englisch verbindet als internationales Sprachwechselgeld die Kontinente und stellt in manchen Bereichen der Wissenschaft das dar, was früher Latein war. Göttert geht noch weiter. Er schreibt: »Englisch i s t das neue Latein.« Wer hätte die Chance, Computer durch elektronischer Tischrechner zu verdrängen, Link durch Verbindungsstück zu anderen Internetseiten, Laptop durch tragbarer Personalcomputer.
Auch im Zeitungsdeutsch kommt man ohne Anleihen bei Fremdsprachen nicht aus. So hieß es im Wissenschaftsteil einer Zeitung: »Die Simulation bestätigte, dass das Universum zu 70 Prozent aus ›dunkler Energie‹ besteht, einem mysteriösen Kraftfeld, dessen Struktur man noch nicht erfassen kann.« Wäre das klarer mit Nachahmung, Weltall, Antriebskraft, geheimnisvoll und Zusammensetzung? Es wäre nur deutscher. Der Sprache ist das egal. Sie hat kein Nationalgefühl. Wir sind nicht ausländerfeindlich, auch unsere Sprache nicht. Übrigens: Viele der übernommenen Wörter sind in Wahrheit Internationalismen. Und 80 Prozent der sogenannten Anglizismen wurzeln laut Göttert selbst im Griechischen, Lateinischen oder Romanischen.
Zum Orogasmusu nach Nippon
Wir sollten also, wenn wir gescheit sind, die fremden Sprachen vorbehaltlos nutzen, soweit sie Besseres als die eigene bieten. Wie aber ergeht es der deutschen Sprache jenseits der Grenzen, ohne die wärmende Obhut der Sachsen und der Schwaben? Das erwähnte Buch über Wortimporte hat einen Zwillingsbruder. Er heißt »Ausgewanderte Wörter« und bringt eine Auswahl aus 6000 Einsendungen und Belegen aus aller Welt zu einer Ausschreibung des Deutschen Sprachrates, bei der nach deutschstämmigen Wörtern in anderen Sprachen gefragt worden war. Das Lesen dieses Buches macht aus manchen Gründen Freude, nicht zuletzt, da es zeigt, dass unsere schöne Sprache kein Auslaufmodell geworden ist, nur weil man sich in allen Kontinenten vornehmlich des Englischen bedient. Herausgeberin Jutta Limbach bemerkt in einem Vorwort, die deutsche Sprache habe sich »mit ihren einfallfreudig zusammengesetzten Wörtern für andere Sprachen immer wieder als eine reichhaltige Fundgrube erwiesen«. Sie nennt als Beispiele solcher »Kombi-Wörter«, die sich in vielen Sprachen wiederfinden, Fingerspitzengefühl, Zeitgeist, Gratwanderung und Leitmotiv.
Wenn die meisten Einsendungen zu Deutschexporten aus dem englischamerikanischen und dem slawischen Sprachraum kommen, verwundert das kaum. Aber es gibt auch »exotische« Exempel. So ist es doch hübsch, auf Estnisch Lips für Schlips und Naps für Schnaps zu hören. In die westafrikanische Sprache Wolof hat man lecker übernommen. Und was könnte wohl aus unserer Sprache bis nach Japan gekommen sein? Nun zum Beispiel arubaito für Teilzeitarbeit, kirushuwassa für Kirschwasser, noirooze für Neurose und, siehe da, orogasmusu mit der gleichen Bedeutung, wie sie der eine oder andere von uns in Erinnerung hat.
Und nach Israel? Etwa Wischer (Mehrzahl: Wischerim) für Scheibenwischer, Schlafstunde für Siesta und Strudel für das @-Zeichen. Vigéc nennen die Ungarn die Hausierer. Die Redewendung »Was ist das« ist komischerweise zweimal ausgewandert, einmal nach Frankreich, wo es Dachfenster, Oberlicht, Türspion bedeutet, vielleicht eine Erinnerung an die auf der deutschen Rheinseite üblich gewesenen Guckfenster, durch die man vor dem Öffnen der Tür fragte: »Wer ist da? Was ist?« In der ungarischen Umgangssprache dagegen benutzt man es im Sinne von keine Kunst »Ez olyan nagy was-ist-das?«, wenn man fragen will: Was ist das schon? Ist das so schwer?
Auch wer was wo erfunden hat, erkennt man am Sprachgemisch. Wie es damit im Tschechischen aussieht, findet man in Lektion 12 des Kapitels »German for Sie«. Die Ukrainer trauen uns das feijerwerk zu, die Bulgaren den schteker, die Russen den schlagbaum und schtrejkbrechery , dazu buterbrody, rjukzak, galstuk (für Schlips / Halstuch), brandmauer (deutsch firewall), buchgalter und zejtnot (beim Schach). Für die Finnen sind wir der Prototyp des besservisseri und versessen auf kahvi paussi, für die Polen hochsztapler oder szlafmyca, womöglich gar im szlafrok, für die Serben štreber. Die Franzosen nennen einen Spaßvogel loustik, den Handball handball, Kitsch kitch und Nudeln nouilles, kennen aber auch le képi, le schnorchel, les neinsager und le waldsterben . Praktisch sind deutsche Wörter in der ganzen Welt kleben geblieben. In der südbrasilianischen Großstadt Blumenau saß ich im Lokal »Frohsinn« und fand zum Oktoberfest auf der brasilianischen (also portugiesischsprachigen) Karte Eisbein mit Sauerkraut. Man könnte einwenden, hier handle es sich um eine einst deutsche Siedlung. Jedoch Oktoberfeste, sznizil (das ist die türkische Schnitzelvariante), Kuchen, Zwieback, Kümmel und Schnaps kennt man wie Gneis und Zink, Nickel und Quarz auch anderswo, natürlich in unterschiedlicher Schreibweise.
In lederhosen zum beer fest
Dass Deutschland Exportweltmeister ist (besser: war), kann man für die Sprache trotzdem leider nicht sagen. Zwei von Deutschland ausgehende Weltkriege und die Hitlerei sind nicht ohne Folgen für die einst zumindest in Nord-, Ost- und Südosteuropa sehr beliebte Sprache geblieben. Aber zum Trost für jene, die wegen Denglisch um unsere Muttersprache bangen, darf man feststellen, dass selbst in den USA gern auf einige deutsche Vokabeln zurückgegriffen wird. Vom Zeitgeist war die Rede. Mit autobahn und fahrvergnügen, fraulein und fuehrer, pilsner und leberkaes mit sourkraut, waldmeister und pretzel, muesli und pumpernickel braucht man kein wunderkind zu sein, um selbst in lederhosen mit rucksack gemütlich zum coffee-klatsch oder zum beer fest zu gelangen, nicht wahr? Der Ruf »Gesundheit!« gilt in den Staaten als vornehmere Variante zu »bless you«.
Wie finden Sie die folgenden amerikanischen Sätze: »I cannot schlepp your luggage«, »There is a poltergeist in the house.« Bei der Präsidentenwahl 2004 in den USA hielt ein Kandidat dem anderen vor: »You are too wischiwaschi.« Im Time-Magazin hatte man für Bush zum Abschied das Wort shwindler parat. Der Fleischer an Portugals Südwestzipfel, dessen Bude die Aufschrift »Letzte Bratwurst vor Amerika« trägt, informiert unvollständig. Er sollte ehrlich zugeben: An bratwursts wird es in New York nicht fehlen.
Es liegt nahe, dass man vermeintlich typisch deutsche Eigenschaften und Produkte auch im Ausland deutsch benennt. Gemütlichkeit natürlich, und dazu Angst, Schadenfreude, Fernweh, Wanderlust, Weltanschauung, Wirtschaftswunder, Leberwurst, Zwieback, Wiener, Gasthof. Nachdenklich sollte stimmen, dass in diese Reihe auch Blitzkrieg, Übermensch, Lumpenproletariat, Hinterhalt und Berufsverbot gehören. Erwähnenswert erscheint mir auch, dass im Englischen wie im Russischen deutsche Befehlsworte für die Hundekommandos bevorzugt werden: Hier! Platz! Hopp! Aus! Sitz! Pass auf! Pfui! Such!
Rettet den Hubschrauber vor dem Helikopter!
Keine Angst also vor dem Sprachcocktail. Was nach dem Turmbau zu Babel geschah, war nur als Übergangslösung gedacht. Auf die Palme bringen sollten uns nur Verletzungen der Sprache durch Modetorheiten, Prahlsucht, unverdaute Sprachbrocken und inhaltloses Geschwätz. Warum aus den Flugzeugentführern Hijacker werden müssen, der Friseur an der Ecke neuerdings »Cut & Go« (ohne zu zahlen?), der Konditor »Coffee to go« (zum Weglaufen?) anbietet, warum man downloadet statt herunterzuladen und mental pusht statt geistig in Schwung zu bringen, warum ein richtiger Verlierer ein Loser sein muss und ein Spielgewinner ein Matchwinner, warum es keine Freilichtveranstaltungen mehr gibt, sondern nur noch Openair-Events, warum die Direktion die gute alte Putzkolonne in einem großen Berliner Hotel durch ein Cleaningteam ersetzt, wüsste ich schon ganz gern. Und ich wünsche mir sehr, dass der bildhafte Hubschrauber nicht mit dem technokratischen Helikopter totgeschlagen wird.
Meist geht es nur darum, mit Wortbombast kleine Sprachfürzchen zu Donnerschlägen aufzublasen. Besonders beliebt ist das in Parlamentsreden. O-Ton: »Gerade im Angesicht der Komplexität der aktuellen Situation sollten wir keine hektische Betriebsamkeit auf diesem abschüssigen Terrain generieren.« Gemeint ist: »Ehe wir in ein Fettnäpfchen treten, machen wir lieber gar nichts.« Der Chef des Marburger Bundes verkündete vor einem Ärzteausstand: »Die Ärzte wollen eine Streiksituation gestalten.« – »Die Ärzte wollen streiken« hätte auch genügt. Auf der Fanmeile zur Fußball-EM wollten die Händler »im Vorfeld der Veranstaltungen« die Riesenbratwürste nicht schlicht anbieten, sondern »zum Verzehr bringen«. Das teilten sie Journalisten nicht etwa mit, nein, sie brachten es ihnen zur Kenntnis. Nach einigen Spielen gab es Zwischenfälle, die von der Polizei »einer Untersuchung zugeführt« wurden. Manchmal wurden sie auch einfach untersucht. Nicht die Zahl der möglichen Nutzer, sondern »die Größe der Community – möchte ich mal sagen« will die Leiterin einer bedeutenden Berliner Bibliothek den Gebühren für die Buchausleihe an Universitätsinstitute zugrunde legen.
Vom Stadionausrufer bis zum Regierungssprecher
Ist es Ignoranz oder Angeberei, wenn »Ich erinnere mich« von manchen Prominenten durch »Ich erinnere« ersetzt wird, wohl weil im Englischen »I remember« genügt? Im Laufe meines langen Journalistenlebens habe ich Hunderte von Leuten interviewt, die überflüssigerweise meine Fragen bewerten wollten. Ich hörte: Das ist eine schwierige Frage, eine schöne, eine kluge, eine dumme, eine nachdenklich stimmende, eine raffinierte, eine selten gestellte und mehr. Diese Zeiten sind vorbei, all das wird durch die Modefloskel »Das ist eine gute Frage« ersetzt, auch wenn dem Interviewpartner nur keine Antwort einfällt und er zugeben müsste: »Das weiß ich nicht.«
So und ähnlich gestanzt und gestelzt reden sie nun fast alle und fast immer: vom Stadionausrufer bis zum Regierungssprecher, vom Betriebsrat bis zum Minister, vom Bürgermeister bis zur Kanzlerin. Ist es wirklich schon 130 Jahre her, dass ein Münsteraner Pfarrer als Neujahrsgebet sagte: Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Herr sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen. Aber nicht sofort.