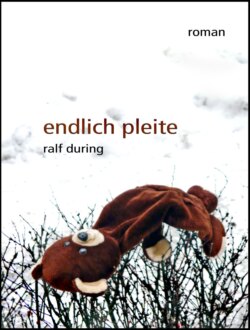Читать книгу endlich pleite - Ralf During - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Notfallplan
ОглавлениеMeine persönliche Krise kündigte sich mit einem gebrochenen Zeh und einer Krankschreibung an. Doch begonnen hatte es mit der Idee, Gold zu kaufen. Darauf brachte mich ein Werbespot im Frühstücksfernsehen, in dem ein Typ mit dem Charme eines GEZ-Gebühreneintreibers die Nation aufrief, ihm gegen Bargeld altes Gold, Schmuck oder sogar goldenen Zahnersatz in einem Kuvert zuzuschicken. Das ließ meine Alarmglocken schrillen, waren sich doch alle Wirtschaftsweisen einig, dass die einzig sichere Anlageform in Krisenzeiten Gold wäre. So schlecht wie dieser Spot produziert war, musste es der Auftraggeber sehr eilig gehabt haben, die letzten Goldreste aus verstaubten Schubladen einzusammeln. Das klang nach kurz vor Zwölf und plötzlich hatte auch ich es eilig, schnappte mir mein letztes sauberes Hemd, wand mir noch im Gehen eine Krawatte um und betrat wenige Minuten später meine Hausbank. Das Büro musste heute auf mich warten.
In der Bank herrschte kurz nach Neun ein eher gemächliches Treiben. In den Kassenhäuschen zählten müde dreinblickende Damen das Wechselgeld und der Sicherheitstyp im Eingangsbereich gähnte mürrisch, als ich den Schaltervorraum betrat. Nach einigem Suchen wandte ich mich an einen der herumstehenden Anzugträger, der so aussah, als ob er direkt von der Grundschule zur Bank gewechselt wäre. Fast hätte ich ihn geduzt und gefragt, ob denn heute keine Schule sei, als mir der Grund meines Besuches wieder einfiel.
»Sie wollen Gold kaufen?«, schaute er mich gelangweilt an und machte selbst auf mein eifriges Nicken hin keine Anstalten, in den Tresorraum zu eilen und die erwünschten Barren herbei zu holen. »Ich weiß gar nicht, ob Sie das hier können.«
Erwartungsfroh hoffte ich, die Frage von ihm beantwortet zu bekommen, doch weit gefehlt. Erst nach einigen Minuten peinlichen Schweigens bequemte sich mein Finanzdienstazubi und zeigte ins Innere der Bank.
»Wenden Sie sich mal an den Herrn dort drüben mit der roten Krawatte, der müsste sich auskennen.«
Unsicher, welcher der drei Herren mit einheitlich roter Krawatte auf hellblauem Hemd gemeint war, wollte ich meinem Banker des Vertrauens danken, doch der hatte sich bereits zu seiner Kollegin umgedreht und erzählte von seinem gestrigen Partyabsturz. Da wollte ich nicht stören und begab mich in den Kundenbereich der Bank, tastete mich von Servicepoint zu Servicepoint, hinter denen vereinzelt Bankangestellte saßen und so intensiv auf ihre Bildschirme starrten, dass ich mich nicht traute, sie dabei zu stören. Schließlich machte einer der roten Krawattenträger den Fehler, den Blick zu heben und mich just in dem Augenblick anzusehen, in dem ich vor seinem Schreibtisch stand. Man konnte ihm die Enttäuschung förmlich ansehen, als er mich fragte, wobei er mir helfen könne. Ich nahm erst einmal Platz, was seine Miene um eine weitere Nuance verfinsterte.
»Ich würde gern mein Sparguthaben in Gold tauschen.«
Schweigen.
»Ja nun, ich dachte, ich frag mal nach einer alternativen Anlage in Gold oder so.«
Noch lauteres Schweigen.
»Immerhin hört man ja hier und da, dass die Wirtschaftskrise noch nicht vorüber wäre und bevor wir eine Inflation bekommen, wäre Gold doch sicher keine schlechte Idee.«
Das Schweigen hallte in meinen Ohren wider.
Doch irgendwann schienen meine Worte bei meinem Gegenüber angekommen zu sein, zumindest wandte er seinen fragenden Blick von mir ab und starrte erneut in seinen Bildschirm, nicht ohne zuvor mit seinem rechten Zeigefinger suchend einzelne Tasten seiner Tastatur betätigt zu haben.
»Also, wir verkaufen Gold nur als Barren. An welchen Betrag hatten Sie denn gedacht?«
»Na ja, ungefähr das, was mein Girokonto hergibt.«
»Der Kurs steht aber nicht besonders günstig.«
»Da hatten andere wohl die gleiche Idee«, schmunzelte ich, doch mein Berater verzog keine Miene.
»Mag sein, vielleicht aber treibt auch die Nachfrage aus Fernost die Preise an. Die brauchen Gold für ihre Computerchips.«
»Glauben Sie nicht daran, dass die Leute sich vor einer Inflation schützen wollen?«
»Welcher Inflation?«, sah er mich fragend an.
»Die, mit der wir angesichts der Staatsverschuldung rechnen müssen.«
»Also unsere Bank hat kein Geld von der Regierung bekommen, wenn Sie darauf anspielen.«
Kommt schon noch, dachte ich, antwortete aber, dass ich an die Verschuldung ganz allgemein dachte.
»Allein in diesem Jahr 80 Milliarden. Das spielen die da oben doch nur ein, wenn sie den Euro abwerten, oder was meinen Sie?«
»Keine Ahnung«, zuckte der Kassenwart mit den Schultern. »Ich verkaufe hier Bausparverträge. Was gehen mich die Staatsschulden an?«
Vernünftige Einstellung für einen Banker, dachte ich noch, bevor mich der Vertreter der noch existierenden Mittelschicht nach meiner Kontonummer fragte.
»Und das wollen Sie in Gold anlegen?«
»Ja, den ganzen Betrag.«
»Davon ging ich aus, abzüglich der Bearbeitungsgebühr.«
»Bleibt dann noch was übrig?«, scherzte ich beim Unterzeichnen des Auftrages, doch der nachdenkliche Gesichtsausdruck meines Beraters beendete mein Schmunzeln.
»Ich weiß nicht, ob wir Barren in dieser Größe vorrätig haben. Haben Sie noch andere Konten bei uns?«
Ich verneinte und mein Gesprächspartner erhob sich stöhnend mit dem Hinweis, er käme gleich wieder. Auf dem – wie ich annahm – Weg zum Tresor, blieb er kurz bei einem seiner Kollegen stehen und wies flüsternd mit dem Kopf in meine Richtung. Grinsend gingen die beiden Männer auseinander.
Minuten später kam mein Berater zurück, doch statt eines, von mir erwarteten Mahagonikästchens hatte er ein Kuvert in der Hand. Aus diesem schüttelte er ein schmales Goldplättchen auf die Schreibtischunterlage und wies mit der Hand darauf.
»So, das wäre Ihr Barren.«
»Barren?«
Ich hielt sekundenlang die Luft an, aus Angst, das Plättchen versehentlich einzuatmen.
»Nun, ich sagte Ihnen ja, der Goldpreis steht gerade nicht besonders günstig. Aber mehr gab Ihr Girokonto nicht her. Wollen Sie es gleich mitnehmen oder soll ich ein Schließfach eröffnen?«
»Ich glaube, das lohnt den Aufwand nicht. Vielleicht sollte ich mir das mit dem Umtausch doch noch mal überlegen.«
»Wie Sie wollen, Sie zahlen die Gebühren. Soll ich den Barren wieder Ihrem Konto gutschreiben?«
Zwei Unterschriften später und zu einem deutlich schlechteren Ankaufspreis ging ich lediglich um Erfahrungen reicher zurück ins Büro.
Dort ignorierte ich meinen seit Tagen auflaufenden Poststapel und recherchierte nach alternativen Goldquellen im Netz. Dabei stieß ich auf eine Internetseite, auf der ein findiger Ex-Banker Auswege aus der unvermeidlichen Finanzkrise versprach und vom Zehn-Punkte-Plan bis zum solarbetriebenen Atombunker allerlei Überlebenswichtiges anbot. Eine clevere Geschäftsidee mit der Angst, aber auch die einzige Quelle für Antworten auf meine vielen Fragen zu dieser plötzlichen Schieflage der westlichen Welt.
Alles klang nach einem lang angelegten Plan, an dessen Ende eine Weltregierung unter dem Vorsitz der National Bank of America, kurz der FED, stehen sollte, die mittels Diktatur in den einzelnen früheren Nationalstaaten die Geschicke der Erde bestimmt. Ein beruhigendes Szenarium, hatte ich doch bisher die Angst, die Chinesen könnten zeitgleich in die Höhe springen und die Weltmacht durch den dadurch verursachten Tsunami übernehmen. Nun aber war die Gelbe Gefahr gebannt und alles blieb dort, wo ich die Weltregierung seit langem vermutete, in Amerika, und die gehörten seit den Rosinen-Bombern 1945 über Berlin zu den Guten.
Doch auch der Verfasser dieser investigativen Rette-Dich-Selbst-Seite riet angesichts einer unvermeidlichen Geldentwertung zur Anlage in Edelmetalle, allem voran in Gold, womit ich wieder beim Anfang des Tages landete.
Als nächstes aber empfahl die Internetseite: drohende Versorgungsengpässe zu überbrücken, solange es die entsprechenden Überlebensgüter noch zu kaufen gäbe.
Vorratswirtschaft also. Das kannte ich aus den Erzählungen älterer Kollegen, die bis heute nichts wegwerfen können. Eine dem Artikel angehängte Frageliste unterstrich die Brisanz dieses Ratschlages für den Tag X, an dem es Nacht in Deutschland werden würde:
Was tun Sie, wenn
- der Strom ausfällt?
- das Handy nicht mehr funktioniert?
- es Probleme mit der Trinkwasserversorgung gibt?
- es zu einer Panik kommt?
- Geschäfte schließen oder die Regale leer sind?
Besorgen Sie sich jetzt wichtige Ausrüstungsgegenstände, um externe Versorgungsrisiken abfangen zu können.
Und genau das hatte ich vor, als ich mir den restlichen Tag frei nahm, meinen Zimmerkollegen irgendetwas vom 60. Geburtstag einer Nachbarin erzählte und mir von unserer Teamassistentin zwei große IKEA-Taschen lieh, die sie in ihrem Kleiderschrank bunkerte. Heute endlich sollten die ihren Zweck erfüllen. Mein Ziel hieß Metro-Großmarkt und der Widerstand hatte begonnen. Mich würde diese Weltregierung nicht bekommen, eher ginge ich in den Untergrund und wenn es das Letzte wäre, das ich in diesem Leben noch tat.
Der Geschäftsstellenleiter des Großmarktes betrachtete skeptisch das Passbild auf meiner Einkaufskarte, ohne die Nichtgewerbetreibende keinen Zutritt zu dem Konsumtempel unserer zivilisierten Welt hatten. Es galt Großpackungen zu erwerben, rechnete ich doch mit mindestens zwei Jahren Ausnahmezustand und Hungersnot. Den zur Einkaufsberechtigung notwendigen Gewerbeschein hatte ich mir noch im Büro aus dem Internet herunter geladen und zusammen mit einem eingescannten Passbild meines Kantinenausweises ausgedruckt. Sah täuschend echt aus und überzeugte schließlich sogar die Oberaufsicht über die bunte Warenwelt der Familiepackungen.
Zum Glück bekommt man in der Metro Einkaufswagen, in denen ich wohnen könnte oder bald müsste, wenn ich nicht rechtzeitig meine vier Wände zu einer Festung gegen Plünderer umbauen würde. Die Verpflegung für eine längere Belagerung sollte ich hier in ausreichender Menge finden. Aber wie viel Reis braucht der Mensch täglich? Wie viele Nudeln, Trockenobst und eingelegtes Gemüse? Kann man Brot zwei Jahre einfrieren oder sollte man lieber die Backzutaten bunkern? Was aber, wenn es keinen Strom für Herd und Kühlschrank mehr gäbe? Dann bräuchte ich noch Heizöl für ein Notstromaggregat. Doch das gab es hier nicht. Stattdessen füllte ich meinen Wagen mit zwei 15 Kilosäcken Reis, ähnlich vielen Nudeln, 80 Konserven Gulasch, Fisch, Ravioli, Gemüse und Pilzen. Außerdem Magermilchpulver und Honig, als ob es kein Morgen gäbe, und Toilettenpapier für die nächsten zwei Jahre. Zusätzlich packte ich noch eine Getreidemühle in den Korb, sackweise Gerste, Roggen, Dinkel und Hafer und jede Menge Brotaufstriche, Knäckebrot, Nüsse, Gewürze, Öl, Essig, Fertigsuppen und Süßigkeiten. Den Schluss bildeten Kaffee, Tee, diverse Hygieneartikel und eine ganze Wasseraufbereitungsanlage für knapp 500 Euro. Das hierfür nötige Wasserstoffperoxid hatte ich ebenso wie mehrere Flaschen Chlorreiniger, Zitronensäure und gefrorenes Saftkonzentrat zuvor im Internet bestellt, da mir der Transport dieser Stoffe zu gefährlich schien.
An der Kasse war ich froh, meinen Goldbarren wieder zurückgetauscht zu haben. Denn so wie der Kassierer meinen bis zum Rand gefüllten Einkaufswagen musterte, bezweifelte ich, dass die hier auf Gold herausgegeben hätten.
»Türkische Hochzeit oder wandern Sie aus?«, fragte er mich ohne den Anflug eines Lächelns.
»Weder noch, ich sorge nur vor.«
»Natürlich, man kann ja nie vorsichtig genug sein. Zum Schluss ist plötzlich Sonntag und man hat nichts zu essen daheim.«
Seine Kollegin an der Nachbarkasse kicherte, doch mein Kassierer verzog noch immer keine Miene.
»Ich möchte Sie ja nicht verunsichern, aber in Notzeiten hat man besser ein paar Reserven zuhause«, versuchte ich mich zu rechtfertigen.
»Verstehe, aber wenn das mit den Notzeiten noch auf sich warten lässt, empfehle ich Ihnen die Eröffnung eines Lokals, genug Vorräte hätten Sie ja jetzt.«
Ich fühlte mich nicht ernst genommen. Doch damit befand sich der muntere Bursche mit der schicken, blauen Metro-Weste in guter Gesellschaft, wenn ich an meine Kollegen und nicht zuletzt Tessa dachte, die mir gestern erst empfohlen hatte, mal Urlaub zu machen, am besten allein und in Griechenland, um meinen Beitrag zur Rettung der griechischen Wirtschaft zu leisten.
»Nehmen Sie auch Goldbarren?«, versuchte ich zu scherzen, doch auch hier erwies sich mein Gegenüber als humorresistent.
»Da muss ich den Geschäftsführer fragen.«
Noch bevor er zum Mikrofon greifen konnte, zog ich meine EC Karte und reichte sie ihm.
»Nur keine Umstände.«
Gefühlte 30 Minuten später stand ich mit meinem Einkaufswagen von der Größe eines Kleinwagens und zwei IKEA-Tüten voller Toilettenpapier vor dem Einkaufszentrum und wusste nicht weiter. Einer der wenigen Momente in München, in dem ich bedauerte, kein Auto zu haben. Das Taxi, das mich und meine Einkäufe schließlich nach Hause brachte, rundete meine bisherigen Ausgaben auf den nächsten Hunderterbetrag auf. So langsam gestaltete sich die Rettung meiner Existenz teurer, als ich gedacht hätte. Noch ein paar Monate ohne Finanzkrise und ich wäre pleite.
Zuhause packte ich erst einmal sämtliche Lebensmittel, den ganzen Hygienekram und die Wasseraufbereitungsanlage in den Keller. Allerdings kam man jetzt weder an die Räder noch den Staubsauger heran. Doch das eigentliche Chaos herrschte im Hausflur, wo unser Vermieter diverse Baumaterialien gelagert hatte und mir völlig unbekannte Menschen die Möbel der verstorbenen Schmidt in einen vorm Haus stehenden Container schleppten.
Tessa war noch nicht daheim, als ich mich in unserer Wohnung nach Stauraum für die gerade gekauften Notreserven umsah. Unsere Schränke waren voll mit Dingen, die uns in der Krise kaum behilflich sein würden. Im Gegenteil, Tessas gesammelte Stofftiere und Kinderbücher, kistenweise Schulhefte, in die sie nie wieder schauen würde, sowie den Dekorationskram für Weihnachten, Ostern und Halloween würden wir in schlechten Zeiten kaum vermissen.
So nutzte ich die Gunst der Stunde und begann all das lediglich sentimentalen Erinnerungen geschuldete Zeug in den Speermüllcontainer vorm Haus zu entsorgen. Dabei achtete ich peinlich darauf, an der übrigen Wohnung nichts zu verändern, um Tessa schonend mit meinen Plänen der Selbstversorgung vertraut zu machen. Nach und nach schaffte ich so Platz für all die Dinge in den Schränken, die unser Überleben sichern halfen. Tessa würde Augen machen.
Und Tessa machte Augen und ein riesen Fass auf. Man musste sie bis ins Dachgeschoss gehört haben. Zum Glück hämmerten und bohrten die Bauarbeiter auf dem Außengerüst bis spät in die Nacht, so dass lediglich mir die Ohren glühten. Doch nicht der von mir entsorgte Kram hatte sie explodieren lassen, sondern eine von mir trotz aller Vorsicht versehentlich zerbrochene Vase. Ein überaus hässliches Exemplar, das seit Tessas Einzug auf unserer Flurkommode stand und deren Scherben nun im Müll lagen. Mit ihnen ein Haufen Dreck, bei dem es sich, wie ich jetzt erfahren musste, um die sterblichen Überreste ihrer eingeäscherten Tante handelte.
In dieser Nacht schlief ich abermals auf der Gästecouch, von deren Existenz ich angesichts unserer Zweiraumwohnung bis vor wenigen Tagen noch gar nichts wusste. Nun war also unser durchgesessenes Sofa unsere Gästecouch. Machte das das Wohn- zum Gästezimmer?
Tessa aber schien das weder logisch noch komisch zu finden, als sie mir statt einer Antwort die Schlafzimmertür vor der Nase zuschlug. Da stand ich nun im Schlafanzug, allein mit meinem Bettzeug im Arm und wusste nicht, ob ich nochmals klopfen sollte, als sie unvermittelt die Tür ein weiteres Mal aufriss, mir mein Schlafkissen vor die Füße schleuderte und die Tür erneut ins Schloss warf. Damit war wohl alles gesagt. Doch wie wir Männer nun einmal sind, musste ich Gewissheit haben, weshalb ich leise klopfte.
»Hey Tess, mach mal halblang. Du glaubst, unser Vermieter hat die alte Schmidt um die Ecke gebracht und tust nichts. Aber wenn ich mal Ordnung mache, fliege ich fast raus. Klingt irgendwie unfair, meinst du nicht?«
Ob fair oder nicht, mir froren im ungeheizten Flur die Füße ab, während ich barfuss auf ihre Antwort wartete.
Doch die kam nicht. Auch nicht am nächsten Morgen, als ich mich mit stechenden Rückenschmerzen vom Sofa mühte. Tessa hatte sich im Bad eingeschlossen, mir blieben nur die Gästetoilette und der Friedensversuch in Form frisch gebrühten Kaffees, den Tessa unbeachtet in der Küche stehen ließ. Als sie schließlich grußlos die Wohnungstür hinter sich zuzog, ahnte ich, irgendetwas falsch gemacht zu haben.
Zum Glück hatte ich ihr nichts von den mit unseren Klamotten gefüllten Müllsäcken auf dem Balkon erzählt. Einem Ort, den Tessa bei Temperaturen knapp über Null kaum betreten würde. Allerdings hatte ich mich auf die Sachen beschränkt, von denen Tessa immer behauptete, sie nie wieder anziehen zu wollen. Manchmal musste man Prioritäten setzen und ich war mir sicher, Tessa würde es verstehen, wenn erst Horden marodierender Plünderer von Haus zu Haus zögen, um alles mitzunehmen, was nicht niet- und nagelfest wäre. Dann nämlich würde auch sie nicht mehr vor die Tür wollen, weshalb es am Vorabend drohender Unruhen Reserven anzulegen und vorzusorgen galt. Tessa konnte sich auf mich verlassen. Ich hatte die Überlebensstrategien meiner neu angeschafften Krisenratgeber verinnerlicht und wusste, was als nächstes zu tun war.
In einer Krise würde es zuerst in den Migrantenhochburgen der Großstädte krachen. Die dort entstandenen Parallelgesellschaften hingen weitgehend von der sozialen Stabilität des Gastgeberlandes ab. Fehlt diese, zerbräche auch das fragile Geflecht zwischen staatlicher Fürsorge und dem gewachsenen Anspruch auf Versorgung. Ein Pulverfass, das unsere Kultur hinwegsprengen könnte.
Autoren, die das schrieben, dachten dabei wohl an die Jugendgang, die immer vor dem jugoslawischen Lokal in unserer Straße herumlungerte. Tessa kassierte hier regelmäßig Pfiffe und anzügliche Bemerkungen. Etwas, was ich seit kurzem auch von unserem morgendlichen Bauarbeiter kenne, dem wir nun schon seinen Kaffee aufs Gerüst stellen, sobald er uns beim Frühstück begrüßt. Falls der auch Migrationshintergrund hatte, schien er sich angesichts seines ausgeprägt schwäbischen Dialektes hervorragend assimiliert zu haben.
Mochte die Krise nur kommen. Während andere in Kürze mit Händen voller Geld vor verschlossenen Supermärkten stehen würden, hatten wir auf Monate genug Essen im Keller und ausreichend Bücher im Schrank, um uns eine Zeit lang zu beschäftigen. Doch im Keller waren die Vorräte nicht sicher.
Also rief ich im Büro an, erfand eine plötzliche Magen-Darm-Grippe und begann, weiter in der Wohnung Platz für die noch nicht verräumten Einkäufe zu schaffen.
Als erstes entsorgte ich die Kleidersäcke vom Balkon, denn dort plante ich, die Wasseraufbereitungsanlage aufzustellen. Danach machte ich mich daran, die Küche auszumisten. Es schien irgendein Naturgesetz zu geben, wonach man zwar nie ein vollständiges Service, aber stets zu viele Tassen in allen erdenklichen Formen, Aufdrucken und Farben hatte, von denen aber selten zwei zusammenpassten. Ähnlich verhielt es sich mit Gläsern, wobei in den meisten Saftgläsern früher einmal Senf war. Nach der Anzahl unserer Saftgläser im Schrank zu urteilen, mussten wir seit Tessas Einzug nichts anderes als Senf gegessen haben. Da dem aber nicht so war, würde auch niemand diese Gläser vermissen. Entsprechend füllten sich die Abfallbeutel und mit ihnen die Sperrmülltonne vorm Haus.
Heute war es auffällig ruhig auf der Baustelle. Da ich keinem der Bauarbeiter im Hausflur begegnete, wagte ich einen Blick hinter die nur angelehnte Wohnungstür der verstorbenen Frau Schmidt. Zu meiner Überraschung war die gesamte Einrichtung verschwunden. Mit ihr einige Wände, so dass nur ein einziger großer Raum voller Bauschutt und aus der Wand hängender Kabel übrig geblieben war. Dafür türmten sich Zementsäcke, Isoliermaterial und Kupferdrahtrollen vor den von der Tapete befreiten Wänden.
Unsicher, was der Vermieter mit der Totalentkernung beabsichtigte, verließ ich die Wohnung und trug zwei weitere Mülltüten zu den Sperrmüllcontainern vorm Haus. In den Tüten waren unsere Grünpflanzen, denn künftig würden wir Wasser für Wichtigeres als zwei Zimmerpalmen und einen Benjamini benötigen. Tessa würde das verstehen.
Vermutlich auch, dass ich zwei Koffer voller Bücher neben die Papiertonne stellte, denn selbst, wenn wir zwei Jahre kaum noch vor die Tür gingen, würde Tessa ihre alten Jugend- und Studienbücher sicher nicht mehr lesen.
So arbeitete ich mich langsam durch unsere Zimmer und sammelte all das noch Übrige ein, was uns zum Überleben in Zeiten der Not Platz stahl. Vermutlich würde in der Krise auch kein Strom mehr fließen, weshalb Tessa auf ihren alten Videorekorder und die vielen, nie mehr angeschauten Kassetten sicher gern verzichtete. Von einem Verkauf bei Ebay sah ich ab, denn Geld wäre das Letzte, was wir nach einem Finanzcrash brauchen würden. Auch verwarf ich die Idee, mit einer Tauschbörse im Internet reich zu werden. Bis die anlief, würde das world wide web Geschichte sein. Ja, manchmal kamen einem die besten Ideen einige Jahre zu spät. Doch jetzt galt es, sich aufs Überleben zu konzentrieren. Als ich letzte Nacht auf dem viel zu weichen Sofa keinen Schlaf fand und stattdessen in meinen neu gekauften Büchern über die Vorzeichen der Krise las, war ich noch voller Sorgen. Doch wie ich mich in unserer Wohnung nun umsah, legte sich die Anspannung allmählich wieder. Zahlreiche Schränke, Schubladen und die Fächer unserer Abstellkammer waren nun mit den Einkäufen aus der Metro gefüllt. Der Rest blieb erstmal im Keller. Aber es fehlte immer noch einiges, um monatelang hinter verschlossener Tür auszuharren. Als nächstes brauchte ich Medikamente, Schutzgitter für die Fenster und Waffen, um – wie mein Internetratgeber eindringlich schrieb – Plünderer abzuwehren.
Die Apothekerin kannte mich noch von dem Versuch, für meine Freundin eine Pilzsalbe zu besorgen. Sie hatte mich damals vor der gesamten Kundschaft laut gefragt, wo sich der Pilz genau befände. Das letzte Mal, dass mir etwas so peinlich war, kaufte ich eine Großpackung Tampons für Tessa, aber die Extrasaugfähigen. Frauen können sich da nicht hineinversetzen, aber ich spreche höchst ungern über den Intimbereich meiner Freundin in Gegenwart zahlreicher fremder Menschen und einer bildhübschen Azubine.
Heute musste ich diese Sorgen nicht haben, denn Tessas Monatshygieneartikel hatte ich bereits gestern im Großmarkt gekauft und war mir sicher, dass 30 Packungen Antibiotika kein vergleichbares Problem wie eine Vaginalsalbe darstellten. Und doch taten sie es.
»Junger Mann, ohne Rezept kann ich Ihnen die unmöglich geben. Auch 25 Packungen Schmerzmittel sind eine höchst ungewöhnliche Menge. Muss man sich Sorgen machen?«
Und ob, wollte ich spontan erwidern, antwortete aber, noch immer über die Anrede Junger Mann erbost, dass ich wohl kaum 30 Packungen Antibiotika von einem Arzt verschrieben bekommen würde.
»Genau deswegen kann ich Ihnen die ja auch nicht geben«, sah mich die Apothekerin ratlos an.
»Gibt es keine Ausnahmeregelung für Notzeiten?«, versuchte ich es auf der sachlichen Ebene und scheiterte.
»Solche Regelungen sind mir nicht bekannt. Außerdem, welche Notzeiten? Aber immerhin ein origineller Versuch.«
Letzteres richtete sich an eine wartende Kundin, die ungeduldig auf ihre Uhr sah und nun über die Bemerkung der Apothekerin schnippisch kicherte. Doch das forderte mich nur noch mehr heraus.
»Keine zwei Monate mehr und wir versinken in Anarchie. Dann kommt keiner mehr, um Ihre Medikamente zu bezahlen, dann rückt der Mob an und plündert. Also wollen Sie mir jetzt die paar Schachteln verkaufen oder nicht?«
»Nein, will ich nicht«, schüttelte der ondulierte Weißkittel von meiner Rede unbeeindruckt seinen Kopf und wandte sich der immer noch kichernden Kundin hinter mir zu. Ich war Luft und musste unverrichteter Dinge wieder gehen.
Der erste Rückschlag. Doch der zweite folgte, als ich versuchte, bei meinem Hausarzt einen Termin zu bekommen. Mit hektisch aufgesprochener Stimme ließ mich dessen Sprechstundenhilfe vom Anrufbeantworter aus wissen, dass Herr Dr. Eberl verreist sei und der Praxisbetrieb spätestens im Mai wieder aufgenommen würde. Heute war der erste April, dennoch entpuppte sich diese Ansage bei meinem Versuch, persönlich vorbei zu gehen, leider nicht als Aprilscherz.
Doch bis Mai konnte ich unmöglich warten, hatte ich doch heute Morgen im Radio von erneuten Angriffsplänen der USA auf den Iran gehört und wusste, der Krieg ums Öl ging in die nächste Runde. Doch anders als einst der Irak würde der Irre von Persien nicht tatenlos zusehen, wie sich der große Weltenrichter die Rohstoffe unter den Nagel riss. Es würde Krieg geben im Nahen Osten, in den sich auf der Seite Israels auch die europäischen Staaten einschalten müssten. Die Folge wäre ein Djihad der arabischen Welt und damit auch der in Europa netzwerkartig verbreiteten Araber. Ich sah es deutlich vor mir und wusste plötzlich, was der türkische Ministerpräsident Erdogan damit gemeint hatte, als er seine Moscheen mit Kasernen und deren Minarette mit Bajonetten verglich.
Der Feind saß im eigenen Land und würde nicht zögern, gegen seinen Gastgeber ins Feld zu ziehen. Wie oft hatte ich mich hierüber schon mit Kollegen, Tessa und dem armenischen Pärchen in der Wohnung über uns gestritten, die mich für einen rechtspopulären Spinner hielten. Dabei habe ich noch nie etwas anderes als die CSU gewählt.
Auf dem Rückweg von Dr. Eberls Praxis kam ich an einem allevitischen Kulturzentrum vorbei und stolperte über eine Werbetafel, auf der ein neu eröffnetes Kampfsportstudio um Neuanmeldungen warb. Wie hatte noch mal der Autor meines Internetratgebers geschrieben?
Halten Sie sich fit und bereiten Sie sich auf körperliche Auseinandersetzungen vor, wenn Ihnen die Polizei wegen Überlastung nicht mehr helfen können wird.
Es war ein Wink des Schicksals, dem ich zu einer Treppe in den Keller unterhalb eines Matratzengeschäftes folgte. Der dort mit Neonröhren erhellte Raum war mit Matten ausgelegt, während Spiegel an den Wänden über dessen mickrige Ausmaße hinweg täuschten. In der Mitte des Studios standen sich zwei in weiße Kutten gehüllte Gestalten gegenüber und verbeugten sich. Einem kurzen Schrei, der mein Herz aussetzen ließ, folgte eine Fußbewegung des einen, die der andere mit seiner rechten Hand abwehrte. Dann verharrten die beiden wieder. Eine kurze Verbeugung, ein Schrei und das Schauspiel begann von vorn.
Ich war fasziniert, wie einfach Kampfsport schien. Die Anmeldung war reine Formsache. Einzig, sich für eine Verteidigungsart zu entscheiden, dauerte eine Weile. Schließlich wählte ich Mixed Martial Arts, eine Kombination aus verschiedenen Stilelementen asiatischer Kampfkunst. Da ist für jeden was dabei, meinte einer der Umstehenden und grinste seinen Vereinsfreunden zu.
Kaum hatte ich meine Sportsachen von zuhause geholt und die Einführung meines neuen türkischen Trainers über mich ergehen lassen, war ich bereit für meine erste Lektion. Die jedoch bestand zu meiner Enttäuschung in Gymnastikübungen zu Musik. Den Gesichtsausdruck des neben mir turnenden Demir werde ich nicht so schnell vergessen, als ich ihn flüsternd fragte, ob sie jedes Mal mit solchen schwulen Übungen anfangen würden.
Diesen Gesichtsausdruck hatte mein Kampfsportkollege auch noch, als ich ihm schließlich für eine erste Sparringrunde gegenüber stand. Da ich neu sei und lieber erst Schrittfolgen und Bewegungsabläufe lernen sollte, hatte sich mein Trainer anfänglich gegen eine solche Übungseinheit ausgesprochen. Doch ich gab dem lebenden Sixpack mir gegenüber Recht, als der verkündete, dass man nur im Wasser schwimmen lernt. Im Wasser hätte ich mir allerdings kaum den großen Zeh gebrochen, als mich Demir aufforderte, ihn anzugreifen. Meiner mutigen Handbewegung in Richtung seines Kopfes folgte eine feige Drehung meines Gegenübers, bei der er seinen Fuß hob und mir frontal auf den Brustkorb trat.
Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einem Kreis grinsender Jugendlicher, die sich gemeinsam mit meinem Trainer über mich beugten und in einer mir unverständlichen Sprache diskutierten. Den Schmerz im Fuß bemerkte ich erst, als sich allmählich das dumpfe Brennen unterhalb meines Brustbeins legte. Mein Sparringpartner
hatte mir vorsorglich vor seinem Tritt den anderen Fuß auf meinen großen Zeh gestellt, damit ich nicht aus dem Ring flöge, wie er mir später erklärte. Die Folge seiner Rücksichtnahme war allerdings, dass mein Zeh hinter meinem sich fortbewegenden Körper zurückblieb und der Knochen nachgab.
So kam ich an diesem Tag doch noch zu einem Arzt, wenngleich sich der als Orthopäde weigerte, mir 30 Packungen Antibiotika für meinen Fuß zu verschreiben.