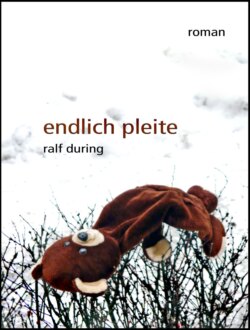Читать книгу endlich pleite - Ralf During - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hausbesuche
ОглавлениеAls ich bandagiert und mit einer Gehhilfe unterm Arm vom Arzt zurückkam, stand Tessa mit dem Pärchen von nebenan vor unserem eingerüsteten Haus. Sie bemerkte mich erst, als ich mit meiner Krücke winkend über den Parkplatz lief und mich fragte, wieso sich im Eingangsbereich Kisten und Koffer stapelten. Wie sich herausstellte, zogen unsere Nachbarn gerade aus. Der Vermieter hatte ihnen wegen Eigenbedarf gekündigt und wollte ihre Wohnung mit den Räumen der darüber verstorbenen Frau Schmidt zu einer Maisonette verbinden. Leonie, unsere Nachbarin, hatte schließlich das Handtuch geworfen und ihren Freund Paul bekniet, dem Druck nachzugeben und auszuziehen.
»Langsam kommen uns die Nachbarn abhanden. Wahrscheinlich sitzen wir als nächstes auf der Straße«, ärgerte sich Tessa, als wir unsere Wohnung betraten.
Angestrengt von dem ungewohnten Laufen auf Krücken nahm ich stöhnend in unserer Küche Platz und streckte meinen bandagierten Fuß aus.
»Ich glaube nicht, dass unser Vermieter auch noch in diese Wohnung einziehen will«, erwiderte ich und war froh, dass Tessa nach unserem Streit wieder mit mir sprach.
»Sei nicht albern, darum geht’s doch gar nicht. Der saniert die Bude doch nicht zum Spaß. Wenn irgendwer unsere Wohnung kauft, sind wir schneller draußen, als du in die Luft springen kannst.«
»Danke, aber das kann ja noch eine Weile dauern«, warf ich einen mürrischen Seitenblick auf meinen Fuß.
»Ach ja, richtig. Bist du im Büro vom Stuhl gefallen?«
»Nein, aber beim Gießen meiner Büropflanzen ausgerutscht, weil ich mir Kaffee über den Fuß geschüttet hatte.«
»Tut mir leid. In jedem Fall mache ich mir langsam Sorgen, wie es hier weitergehen soll.«
Tessa hatte mir diesen Unsinn tatsächlich abgenommen.
»Denkst du wirklich, ich tue den ganzen Tag im Büro nichts anderes als Blumengießen und Kaffeetrinken?«
»Nein, aber beim Zeitunglesen wirst du dir kaum den Fuß verletzt haben.«
»Wenn du’s genau wissen willst, ich wurde niedergeschlagen und brach mir dabei den großen Zeh.«
»Niedergeschlagen?«
»Nun, nicht absichtlich, ich war nur zu langsam, als mich der Kick traf.«
»Der Kick?«
»Eine Kampfsportbewegung, bei der der Gegner mit dem Fuß seinen Trainingspartner zu treffen versucht. In meinem Fall direkt aufs Brustbein.«
»Ben, mal ehrlich, bist du auf den Kopf gefallen oder muss ich mir Sorgen machen?«, fragte sie und fuhr mir zärtlich mit der Hand über den Brustkorb. »Was heißt hier Kampfsport und wieso lässt du dich aufs Brustbein treten?«
Da berichtete ich Tessa von meinem Besuch in der Bank, dem Einkauf in der Metro und dem Entschluss, dem allevitischen Kampfsportzentrum beizutreten, um mich dort auf drohende Bürgerunruhen vorzubereiten. Die Entrümpelung unsere Wohnung übersprang ich anlässlich Tessas gestriger Reaktion auf die zerbrochene Urne.
»Aber sonst geht’s dir gut?«, lachte sie, als ich mit meiner Erzählung fertig war. »Oder hörst du vielleicht Stimmen, die dich bitten, die Welt zu retten, in dem du dich niederschlagen lässt?«
Sie nahm mich offensichtlich nicht ernst.
»Auch wenn du’s spaßig findest. Wenn aber erst die Banken die Regierung übernommen haben, vergeht dir das Lachen.«
»Ach, die Banken übernehmen jetzt also die Regierung?«, fragte sie mit gespieltem Erstaunen. »Dann war’s ja nicht so clever vom Staat, die erst vorm Konkurs zu retten.«
»Genauso sehe ich das auch«, ignorierte ich ihren ironischen Unterton. »Erst lassen sich die Banken die Spekulationsverluste mit zinslosen Staatskrediten abkaufen, dann bieten sie dem Staat hochverzinsliche Darlehen an, damit der seinen sozialen Verpflichtungen nachkommen kann. Das nennt sich Verschuldung und bedeutet steigende Steuern, damit der Staat, also wir, den Banken die Zinsen zurückzahlen können. Und sobald das System pleite ist, übernehmen die Banken die Führung.«
Tessa sah mich weiterhin amüsiert an.
»Hmm, und deshalb hast du deine Kohle in Gold umgetauscht und dich beim Kampfsport niederschlagen lassen? Das hat den Banken sicher einen riesen Schreck eingejagt und die Verschuldung aufgehalten.«
»Mach dich nur lustig«, entgegnete ich reserviert. »Aber wir müssen uns auf schlechte Zeiten einstellen.«
»Indem du säckeweise Reis und Nudeln anschleppst? Was kommt als nächstes? Kartoffeln auf dem Balkon?«
»Gute Idee, aber nein, ich versuche nur zu überleben, wenn andere Hunger leiden oder obdachlos sind.«
»Apropos obdachlos. Ich habe heute mit dem Immobilienbüro Donnersberg telefoniert und eine Liste von Häusern bekommen, die zum Verkauf stehen.«
»Sobald ich wieder laufen kann, gerne«, versuchte ich mich mit schwachem Protest gegen Tessas Ignoranz aufzulehnen, aber keine halbe Stunde später saßen wir in der S-Bahn auf dem Weg nach Vaterstetten, wo Tessa ein fünfzig Jahre altes Reiheneckhaus anzuschauen gedachte.
Mich schauderte, als ich vor dem klinkergedeckten, gelblich blassen Fassadeneinerlei am Ende einer tristen Häuserzeile stand. Die hühnerstallartig aneinander gereihten Eingänge erinnerten eher an englische Arbeitersiedlungen, als an ein Wohnen im Grünen. Das einzig Grüne waren neben den entsprechend farbigen Papiertonnen die akkurat auf Hüfthöhe gestutzten Hecken und das Handtuch von Rasen, das sich verschämt von der Gartentür bis zum Hauseingang erstreckte. Platz genug für zwei ausgewachsene Meerschweine, nicht aber für eine Familie mit Hund und zwei Kindern.
»Wollen wir uns wenigstens das mit dem Hund nicht noch einmal überlegen?«, versuchte ich die Sache mit Humor zu nehmen, doch Tessa schien ganz angetan.
»Ach was, hinterm Haus wird Hector schon ausreichend Platz finden.«
»Noch ein Kind?«
»Nein, der Hund, oder hast du was gegen Hector?«
»Nein, ich habe nur etwas gegen diese Friedhofsatmosphäre hier draußen.«
»Warte nur, bis Philipp und Marie über den Rasen toben. Dann sehnst du dich nach der Stille hier zurück.«
»Genau das habe ich befürchtet«, murmelte ich noch, doch Tessa hatte bereits an der Gartentür geklingelt.
»Jetzt sei nicht so negativ. Das kann doch ganz hübsch werden. Und bei deinen Bürgerunruhen sind wir hier wenigstens weit ab vom Schuss«, zwinkerte sie mir noch zu, bevor sich die Haustür öffnete und ich dem Kommenden entgegen sah.
Das hatte vier Füße und fauchte. Eine fette, gelbrote Hauskatze schob sich durch den Türspalt, streckte uns ihre Krallen entgegen und zeigte die Zähne. An ein Streicheln war nicht zu denken.
»Keine Sorge, die will nur spielen«, rief uns eine unbekannte Stimme den meistgehasstesten Satz von Joggern im Stadtpark entgegen, bevor eine blondierte Frau in den Vierzigern im Hausanzug und Kuhkopfpantoffeln vor die Tür trat. Sie nahm den Mitleid erregenden Bettvorleger von einem Haustiger auf den Arm und bat uns einzutreten.
»Sie kommen auf die Anzeige?«
»Nein, Herr Hertling von der Agentur Donnersberg hat mir Ihre Adresse gegeben und gemeint, wir könnten jederzeit mal klingeln.«
»Da hat er Recht, aber kommen Sie erst mal rein. Was kann ich Ihnen anbieten?«
»Eine ungefähre Jahreszahl, wann Heizung und Dach das letzte Mal erneuert wurden«, kam es mir spontan über die Lippen, wofür ich Tessas Ellbogen in den Rippen spürte.
»Hören Sie nicht auf meinen Freund, ein Glas Wasser wäre nett«, entschuldigte sich Tessa bei der Gastgeberin und funkelte mich, als diese in der Küche verschwunden war, wütend an. »Schon mal was von guter Kinderstube gehört, du Trampel?«
»Nein, aber von den Kosten, die ein renovierungsbedürftiges Dach und eine marode Heizung verursachen, wenn ich dich mal an das Alter dieser Hütte erinnern darf.«
»Wenn wir uns einen Neubau leisten könnten, wären wir nicht hier. Also hör auf zu motzen oder such dir ’nen besseren Job«, presste meine Freundin zwischen den Zähnen hervor, als die Hausbesitzerin mit den Getränken zurückkam.
Fünfzig Minuten und eine Hausbesichtigung später ging Tessa schweigend neben mir zurück zur S-Bahn. Das Haus war in besserem Zustand, als ich befürchtet hatte, doch aus uns unerfindlichen Gründen hatten die Architekten bei der Hausplanung eine geräumige Küche ebenso wie ein Bad, in dem sich mehr als eine Person drehen konnte, für entbehrlich gehalten. So fehlte es nicht nur an einer Badewanne, auch ein Gemüsebrett wäre größer als die Arbeitsfläche in der Küche gewesen. Hier konnte man den Begriff Kochnische wörtlich nehmen.
»Ja, grins nur«, fuhr mich Tessa mit einem Seitenblick an, der mich zum Widerspruch reizte.
»Das ist nur der Schmerz. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber mit einem gebrochenen Zeh sollte ich nicht in fremden Häusern herumsteigen.«
»Schon gut. Dass ihr Männer aber auch immer nur jammern könnt.«
Ohne darauf zu antworten, las ich mir die nächste Hausbeschreibung auf dem Rückweg zur S-Bahn durch.
»Wo bitte liegt denn Gröbenzell?«
Tessa nahm mir die Anzeige aus der Hand, überflog sie kurz und tippte schließlich auf den unteren Absatz.
»Hier steht’s doch, im Westen von München, noch vor Fürstenfeldbruck.«
»Bruck? Nicht dein Ernst? Also, ich würde nie mit einem FFB Kennzeichen herumfahren. Kennst doch den Spruch: Hüte dich vor Eis und Schnee, EBE und FFB.«
»Darf ich dich mal daran erinnern, dass wir gar kein Auto haben und außerdem weiß ich gar nicht, was Gröbenzell für ein Kennzeichen hat.«
Missmutig folgte ich Tessa zum S-Bahn-Plan und versuchte heraus zu finden, wie viele Streifen ich zu meinem Isarcard-Abo hinzulösen musste. Trotz Abitur und einem Ingenieurstudium war es mir nicht möglich, anhand des Ringplans der Münchener Verkehrsbetriebe hierauf eine Antwort zu finden. Schließlich kauften wir uns jeder ein Singleticket und hofften, nicht kontrolliert zu werden.
Vom Gröbenzeller Bahnhof führte ein Weg direkt zur Hexe, einer Kneipe, die ironischerweise in der Kirchenstraße lag. Mir hing der Magen in den Kniekehlen, als wir vor der Wirtschaft auf ein Schild mit der Aufschrift: Riesenschnitzel mit Pommes stießen.
Das Lokal war schwach besucht. Zwei Männer hockten an der Theke und würfelten mit der Wirtin um Schnäpse. Ein anderer saß auf einer kleinen Bühne am Klavier und versuchte sich mehr recht als schlecht an Für Elise, während sich ein Pärchen auf der Bank am Fenster küsste. Aus dem Nebenraum hörte ich Billardkugeln aneinander stoßen, begleitet von Rock Antenne, die blechern aus gammeligen Boxen oberhalb der Theke wimmerte. Tessa wollte gleich wieder gehen, doch völlig ausgehungert zog ich sie an einen der freien Tische.
»Schnitzel, Pommes und ein Helles«, diktierte ich der wenige Minuten später an unseren Tisch getretenen Wirtin in den Bestellblock und sah Tessa erwartungsvoll an. »Und meine Freundin möchte…«,
»nichts«, beendete diese mürrisch meinen Satz, ohne dabei aufzusehen.
»Ein kleines Wasser«, korrigierte ich und trat unterm Tisch gegen Tessas Schienbein. »Uns hier Häuser anzusehen, war deine Idee. Da wird doch eine kurze Pause drin sein.«
»Ist ja gut. Ich find’s halt nicht besonders gemütlich hier. Vor allem der Typ drüben am Klavier nervt.«
Seufzend erhob ich mich und ging aufs Klo. Dort las ich stehend die über die Urinale gehängten Comics und beschloss, mich nicht von Tessas schlechter Laune anstecken zu lassen.
Zurück am Tisch fand ich mein Bier und eine in die Hausanzeige vertiefte Freundin vor, die mich plötzlich anstrahlte und auf die zweite Seite des Maklerschreibens tippte.
»Schau mal, das nächste Haus hat sogar einen Pool und im Keller eine Sauna.«
»Mir würde schon genügen, wenn es einen Keller hat und ein bisschen mehr Grün als die letzte Absteige.«
»Komm, so schlecht war das Haus gar nicht. Wenn nur Küche und Bad nicht so winzig gewesen wären. Das Zimmer unterm Dach war doch voll kuschelig.«
Bei dem Wort kuschelig überlief es mich kalt, doch zum Glück kam mein Schnitzel und die Welt wurde in Licht getaucht.
»Wissen Sie zufällig, wo es von hier zur Auenstraße geht?«, erkundigte ich mich wenig später beim Bezahlen der Rechnung. Die Wirtin kratzte sich mit ihrem Kugelschreiber am Kopf, wiegte ihr Doppelkinn und fragte schließlich die beiden Typen an der Theke, ob die wüssten, wo die Auenstraße läge. Mit zwei unterschiedlich vagen Wegbeschreibungen und einem ersten zweifelhaften Eindruck von den Eingeborenen Gröbenzells zogen wir in die anbrechende Dämmerung auf der Suche nach einem neuen Zuhause.
Die zur Besichtigung anstehende Doppelhaushälfte lag an einer Wendeschleife und damit einiges ruhiger als das Reiheneckhaus in Vaterstetten. Soweit so gut.
Weniger gut verhielt sich ein Audi-Cabrio Fahrer, der, als wir die Straße zum gesuchten Haus überqueren wollten, aus seiner Einfahrt schoss. Ich konnte Tessa gerade noch auf den Fußweg zurückzerren, als der Wagen mit quietschenden Reifen neben uns zum Stehen kam und der Fahrer uns aus dem geöffneten Verdeck heraus zurief, dass wir Arschlöcher uns von der Straße scheren sollten. Ein Kreischen der Gangschaltung später röhrte der Motor wieder auf und wir blieben mit offenem Mund in einer Abgaswolke stehen.
»Volldepp«, rief ich dem um die Kurve biegenden Wagen hinterher, begleitet von meinem, in die Höhe gereckten Mittelfinger.
»Dem hast du’s aber gegeben«, grinste Tessa und schaute sich nach der gesuchten Hausnummer um.
Das Objekt unserer Begierde entpuppte sich als die rechte Hälfte des Hauses, aus dem der Inbegriff deutschen Proletariats vor einer Minute gefahren kam. Das ließ auf eine entsprechend harmonische Nachbarschaft schließen.
Diesmal öffnete ein älteres Ehepaar, dem man glaubhaft abnahm, dass sie die steilen Stiegen in die oberen Stockwerke nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen konnten. Doch bevor wir uns über die Hintergründe des Verkaufs unterhalten sollten, folgte die obligatorische Hausführung durch den Ehemann, während seine Frau in der diesmal etwas geräumigeren Küche die Getränke herrichtete. Zum Glück hatte ich kein Bier bestellt, denn das wäre angesichts der auf Anschlag gedrehten Heizung und der Geschwindigkeit, mit der wir durch die übrigen Räume geführt wurden, bei unserer Rückkehr körperwarm gewesen.
Die einzelnen Zimmer waren klein, verlebt und voller Erinnerungen an ein Leben, als man sich in Deutschland noch auf Silvester freute, weil es jedes Jahr ein bisschen aufwärts ging, die Löhne stiegen und die Preise sanken, Gründerzeit. Es fühlte sich gemütlich an, weshalb ich bereit war, den Schimmel an den Kellerwänden ebenso zu ignorieren wie die seit zwanzig Jahren ins Parkett gebohnerten Schmutzreste. Das Haus selbst verströmte den vertrauten Geruch von alter Wäsche, feuchten Spätsommertagen und Erde.
»Wollen Sie ein Stück Kuchen, selbstgebacken?«, fragte die Gastgeberin meine Freundin, die zurück auf der Fernsehcouch verträumt in ihrem dampfenden Pfefferminztee rührte. Tessa sah überrascht auf, fasste sich und schüttelte den Kopf.
»Ich aber würde gern ein Stück nehmen«, antwortete ich angesichts des enttäuschten Blicks der alten Frau. Freudestrahlend brachte sie mir wenige Minuten später einen Rührkuchen, der noch aus Zeiten stammen musste, als deren Kinder im Sandkasten vorm Haus spielten. Tapfer kämpfte ich gegen den drohenden Erstickungstod mit Leitungswasser an, das mir der Herr des Hauses großzügig nachschenkte.
»Sie suchen also ein Haus?«, eröffnete er dabei das Gespräch. Ich nickte und versuchte vergeblich gegen den Würgereiz anzuschlucken.
»Hmmf gnnng ohhmm«.
»Was mein Freund vermutlich sagen will«, unterbrach Tessa meinen Versuch, mit vollem Mund zu antworten. »Wir schauen uns gerade ein wenig nach etwas um, wo Kinder noch ungestört im Grünen spielen können.«
Beglückt schlug das Mütterchen die Hände zusammen und ihr Mann wiegte anerkennend das kahle Haupt.
»Schön zu hören, dass es noch immer junge Menschen gibt, die sich trauen, Kinder in diese Welt zu setzen.«
»Heinz, fang nicht schon wieder an«, unterbrach ihn seine Frau, doch ich war hellhörig geworden.
»Was meinen Sie mit dieser Welt?«, wandte ich mich an Heinz. »Ich frage mich nämlich auch, ob man Kindern ein Leben in diesen Zeiten noch zumuten sollte.«
»Sie brauchen doch nur mal raus zu schauen«, antwortete mir der alte Herr mit zittriger Stimme. »Mord und Totschlag, Krisen, wo man hinsieht. Und dann dieser Europawahnsinn. Das kann doch nicht gut gehen.«
»Ganz meine Meinung. Vor allem, wenn wirtschaftlich alles den Bach runter geht«, pflichtete ich ihm bei und ignorierte Tessas entnervtes Augenrollen.
»Wen wundert’s. Jeder denkt doch nur an sich. Wenn wir damals ‘45 auch so gedacht hätten, würde Deutschland noch immer in Schutt und Asche liegen.«
»Wenn ich mir manche Innenstädte so ansehe, sind wir nicht mehr arg weit davon entfernt.«
»Genau. Wenn aber die Türken erst in der EU sind, geht’s hier richtig rund. Eure Generation kann einem nur leid tun«, brummte Heinz grimmig. Seine Frau hüstelte verlegen, doch ihr Mann war nicht zu bremsen. »Ist ja auch kein Wunder, wenn uns Steinewerfer und Kommunisten regieren. Das reinste Tollhaus da in Bonn.«
»Berlin«, flüsterte Tessa, aber mein Blick ließ sie verstummen.
»Ja, vor der Islamisierung Europas habe ich auch Angst«, nickte ich nachdenklich.
»Kein Wunder, wenn die da oben jeden Ziegenficker zu uns reinlassen und überall Moscheen hochziehen. Bald muss man als Christ Angst haben, auf die Straße zu gehen. Wo man hinschaut, Ausländer und Terroristen«, redete sich der alte Mann jetzt richtig in Rage.
»Heinz, ich bitte ich«, zischte seine Frau, als sich Tessa räusperte.
»Ihr Nachbar kommt dann vermutlich auch nicht aus Deutschland?«, unterbrach sie unseren Gastgeber, der seiner Frau gerade widersprechen wollte. Das Ehepaar wechselte einen erschrockenen Blick.
»Ich frage ja nur, weil uns dieser Terrorist vor Ihrem Haus fast umgefahren hätte.«
»Der junge Mann von nebenan hat es manchmal ein wenig eilig. Ich denke, das war keine Absicht«, antwortete das Mütterchen zögerlich.
»Ach, dann habe ich die uns zugerufenen Beleidigungen sicher auch missverstanden?«, bohrte Tessa weiter in der Wunde. »Weiß der eigentlich, dass Sie Ihr Haus verkaufen wollen?«
Wieder schauten sich die alten Leute an, bis schließlich Heinz langsam den Kopf schüttelte.
»Ich glaube nicht.«
»Sie haben wohl nicht viel Kontakt zu Ihren Nachbarn?«
»Hin und wieder. Mit denen von gegenüber sitzen wir manchmal im Sommer zusammen im Garten, grillen oder trinken Kaffee.«
»Ja, man kann es sich nicht immer aussuchen, wer neben einem wohnt«, wollte ich den zwei alten Leutchen zur Seite springen, denen Tessas Nachfragen offensichtlich unangenehm waren.
»Ach, meist bekommen wir von denen gar nichts mit«, versuchte uns Heinz zu beruhigen, als dessen Frau plötzlich in Tränen ausbrach und schluchzend erzählte, dass die Nachbarsfamilie sie seit Jahren terrorisiere und sie keine Kraft mehr hätten, das noch länger auszuhalten. Beruhigend streichelte der alte Mann seiner Frau die Hand.
Als wir uns wenige Minuten später verabschiedeten, sah uns Heinz nicht in die Augen. Ich spürte seine Enttäuschung. Vermutlich waren wir nicht die ersten, die von einem Kauf zurückgetreten waren.
»Woher wusstest du, dass die mit ihren Nachbarn im Krieg leben«, fragte ich Tessa, nachdem wir eine Weile stumm nebeneinander her gelaufen waren.
»Hast du dir mal den Gartenzaun zwischen den Grundstücken angesehen?« Ich verneinte.
»Eben, weil es gar keinen gibt. Nur eine Mauer. Und wer bitte errichtet im Garten zwischen zwei Doppelhaushälften eine Mauer? Sicher niemand, der am Wochenende mit seinem Nachbarn grillt.«
»Da ist was dran«, stimmte ich nachdenklich zu.
»Außerdem würde ich nie in so eine Nazi-Hütte einziehen wollen«, beendete Tessa die Hausbesichtigung in Gröbenzell. Damit scheiterte auch unser zweiter Versuch, meinem Wunsch nach Selbstversorgung näher zu kommen.
Dennoch folgten in den nächsten Tagen weitere Besichtigungen, die Tessas ganze Aufmerksamkeit beanspruchten. Anders konnte ich mir das ausbleibende Donnerwetter angesichts meiner Entrümpelungsaktion in unserer Wohnung nicht erklären. Stattdessen schleppte ich mich auf eineinhalb Füßen durch winzige Vorgärten mit Spielzeugrutschen, von staubigen Dachböden hinunter in noch staubigere Kellerlöcher, durch Küchen mit Linoleumböden und zurück in plüschige Wohnzimmer aus dem letzten Jahrhundert. Ja, in unserer Gehaltsklasse standen Neubauten nicht gerade auf einer der vorderen Plätze unserer Immobilienliste. Und ähnlich wie bei der Odyssee durch den Münchener Wohnungsmarkt holte uns die Realität von einem Traum mit Häuschen am Waldesrand bald wieder auf den Laminatboden unserer Mietswohnung zurück. Der Wald bestand zumeist aus den unvermeidlichen Koniferen der Nachbargärten oder von Parasiten befallenen Obstbäumen, deren Laub uns die zweite Jahreshälfte beschäftigen würde. Hingegen stellte das von angrenzenden Grünflächen entgegen wuchernde Unkraut kein Ersatz für die zur Selbstversorgung nötigen Beete dar. Den Rest bildeten Maschendrahtzäune, Carports und Feuerstellen, deren Qualm eigenes Grillen überflüssig machte.
Auf einigen dieser Besichtigungstouren wurden wir von Gero von Donnersberg, dem Inhaber der gleichnamigen Immobilienagentur und dem Inbegriff eines Selfmademillionärs, begleitet. Tessa hasste den Traum aller Schwiegermütter. Sie mochte es nicht, wenn Männer glaubten, ihnen gehöre die Welt und alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, verriet sie mir nach einem unserer letzten Termine und dem ernüchternden Ergebnis, dass Häuser gar nicht alt genug sein konnten, um für uns immer noch unerschwinglich zu sein.
»Also, die Idee von dem Donnersberg, für Trinkwasser und Bewässerung Kanäle durch Wohnsiedlungen zu legen, wäre in Krisenzeiten ein echter Vorteil. Stell dir mal vor…«
»Dann zieh doch mit deinem neuen Freund in irgendeines seiner scheiß Ökohäuser«, unterbrach mich Tessa genervt.
»Jetzt mach mal halblang«, antwortete ich eine Spur zu laut und fuhr leiser fort. »Ich meine doch nur, dass ich gerne an einem Fluss wohnen würde.«
Tessa grummelte irgendetwas Unverständliches, das ich als Entschuldigung gelten ließ. Beide waren wir von der bislang vergeblichen Suche nach einem neuen Heim frustriert.
Plan B konnte demnach nur lauten, unsere heimischen vier Wände krisensicher zu machen und mit der eigenen Vorsorge fortzufahren. Hierzu hatte ich mir aus der Tageszeitung eine Anzeige für eine Informationsveranstaltung zum Thema:
Überleben in der Großstadt
ausgeschnitten. Der Vortrag versprach neue Strategien gegen die zunehmende soziale Verwahrlosung deutscher Städte. Das klang nach Abenteuer und einer Alternative zu meinem kläglichen Versuch der Selbstverteidigung, an den mich mein schmerzender Zeh tagtäglich erinnerte.