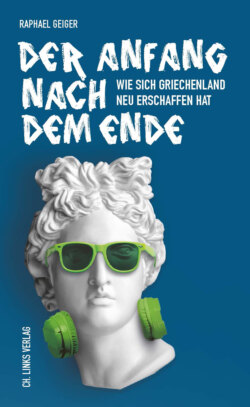Читать книгу Der Anfang nach dem Ende - Raphael Geiger - Страница 5
KRISE, DIE Was heißt das eigentlich?
ОглавлениеIst es zu früh für dieses Buch? Die Frage stellte ich mir, als ich mit dem Schreiben anfing. Es waren die Wochen, als Covid-19 noch eine chinesische Angelegenheit war. Das kleine Land am Rande Europas, über das ich hier schreibe: Griechenland, fand langsam heraus aus seiner quälend langen Krise.
Während ich schrieb, wurde eine Zwischenkrisenzeit daraus. Die Frage ist jetzt: Wie schlimm wird die neue Krise ausfallen? Diesmal ist sie global. Und dieses Buch hier ist vielleicht aktueller als gedacht: Die Coronakrise verändert das Leben der Menschen überall auf der Welt, sie greift in unseren Alltag ein, in unsere Pläne, unsere Freiheiten. Sie stellt die Antworten infrage, an die wir gewohnt waren. Wir spüren, wie eine neue Zeit anfängt.
Genau das ist in Griechenland passiert, in dem langen Jahrzehnt, das mit der Finanzkrise 2008 begann. Andere Länder fanden damals schnell zurück zu Wachstum, zu Stabilität. In Griechenland ging die Krise einfach immer weiter. Die Menschen hier lebten im permanenten Krisenmodus. Kaum eine Biografie ohne Bruch, ohne Suche nach einem Neuanfang.
Für viele stand irgendwann fest, dass es nach der Krise nicht mehr so weitergehen kann wie vorher. Sie stellten sich, gezwungenermaßen, jahrelang ähnliche Fragen, wie sie in Deutschland schon nach wenigen Wochen der Kontaktsperre auftauchten: Was für ein Land soll das hier sein, wenn das alles einmal vorbei ist? Wird danach alles anders?
Die Griechen wurden andere, während sie sich all das fragten. Sie sind heute krisenerfahrener als wir Deutsche, und die eigentliche Frage ist jetzt die: Was können wir von den Griechen lernen?
Dieses Buch ist eine Reise in die griechische Realität. Eine Reise in ein Land, das die schwerste Wirtschaftskrise in Friedenszeiten seit der amerikanischen Depression durchgemacht hat, also seit 1930. Und die griechische Krise war deutlich länger. Sie ist einzigartig: Niemals hat sich ein Industrieland von einem dermaßen tiefen Sturz so lange nicht erholt.
Vor dem Virus betrug die Arbeitslosenquote immer noch 16 Prozent, und die Einkommen lagen um 22 Prozent unter dem Niveau vor der Krise. Die Griechen waren deutlich ärmer als im Jahr 2002, dem Jahr der Euro-Einführung. Damals hatte das Land auf eine Party gehofft, ein Wirtschaftswunder, aber damit war es schnell vorbei. Und das 21. Jahrhundert begann in Griechenland mit dem Kollaps der ganzen Gesellschaft.
Dieses Buch erzählt deswegen, fürchte ich, weniger darüber, wie man mit einer Krise umgeht, sondern mehr davon, wie man es besser nicht macht. Am Ende erzählt es hoffentlich beides. Vor allem hoffe ich, dass es eine Warnung ist: Nach der griechischen Krise sollte niemand mehr das Leid unterschätzen, das eine Rezession auslösen kann. Eine Krise dieser Dimension tötet sogar, weil die Suizide zunehmen und weil die Menschen an behandelbaren Krankheiten sterben. In Griechenland ist die Säuglingssterblichkeit gestiegen, die Lebenserwartung sank.
Auch wenn es vor dem Virus einen ganz zarten Aufbruch gab: Vorbei war diese Krise nie. Ich müsste nur jetzt gerade, während ich am Schreibtisch in meiner Athener Wohnung sitze, aufstehen und hinaus auf den Balkon gehen, hinunterschauen auf unsere Straße und die offenen Mülltonnen gegenüber beobachten. Ganz sicher würde jemand auftauchen, der sich einmal kurz umsieht, ob ihn jemand bemerkt. Ein älterer Mann vielleicht, einer jener Rentner, die jetzt, in den letzten kalten Tagen, in einem alten Wolljackett und Hut durch unser Viertel gehen, womit ihnen das Kunststück gelingt, mit Eleganz ihre Armut zu verbergen.
Er würde sich vorbeugen, seinen Kopf über unsere Mülltonne halten und etwas darin suchen. Solche Szenen wiederholen sich ständig. Es sind Menschen aus der, wie wir sagen, Mitte der Gesellschaft, die von Tonne zu Tonne zu gehen, auf der Suche nach Verwertbarem.
Jedes Mal, wenn ich vor Corona an unserer Bushaltestelle vorbeiging, sah ich die Frau, die in ihr lebte, umgeben von Plastiktüten, in die sie ihren Besitz gepackt hatte. Eine von denen, die irgendwann in diesen Jahren abgestürzt waren, und die es nicht mehr schafften. Die Zeit ging über sie hinweg, die Gesellschaft vergaß sie.
Da saß sie nun, während die Menschen morgens vor ihr in den Bus stiegen, zur Arbeit fuhren, sie saß da, abends, wenn sie wieder zurückkamen, sie starrte vor sich hin, stumm, wie eine Zeugin, die etwas zu sagen hätte, der aber niemand mehr zuhört.
Nein, sie war nie vorbei, die Krise. Die Fassaden sind noch immer zu verrußt, zu viele Läden verwaist, die Gehsteige zu kaputt, die Straßen zu löchrig. So sieht es aus, wenn sich der Staat jahrelang zurückzieht, nur noch das Allernötigste macht. Ganze Viertel von Athen waren sich selbst überlassen, an vielen Ecken wirkte es, als würde sich niemand mehr um die Stadt kümmern. Als hätte es nicht mehr nur am Geld gefehlt, sondern auch an Kraft.
Die Stadt spiegelte wider, wie es in den Menschen drinnen aussah. Sie waren gebrochen. Ein Schatten ihrer selbst. Ich bilde mir ein, die Krise in den Gesichtern zu sehen. Nicht in allen, natürlich. In vielen. In ihren Gesichtszügen liegt eine Schwere. Eine Härte. So sehen jahrelang enttäuschte Menschen aus, die nichts mehr erwarten, die sich verschlossen haben, um sich vor weiteren Enttäuschungen zu schützen. Wer einen Krieg durchgemacht hat, kommt davon nicht mehr so einfach los. Die Erfahrung prägt fürs Leben, der stärkste Mensch kommt dagegen nicht an. In Griechenland ist kein Krieg passiert, sicher, aber was, wenn die Krise die Gesellschaft ähnlich tief getroffen hätte?
Ich lebe in Pangrati, einem zentralen, früher eher unauffälligen Stadtteil. Athener würden sagen: Wenn die Krise irgendwo zu Ende ging, dann hier. Pangrati ist in den letzten Jahren hip geworden. Es begann mit ein paar Cafés und Bars, Restaurants, die Wohnungspreise stiegen, der Trend befeuerte sich selbst. In unserer Straße, in der manche Läden seit Jahren leer stehen, komme ich jetzt am Showroom eines Modedesigners vorbei, gegenüber ist ein Startup eingezogen. Selbst in der grauen Hauptstraße, die ins Zentrum führt, entdecke ich jetzt eine neue Bar, und dann noch eine. Eine Galerie hat eröffnet: die Gemäldesammlung einer Reederdynastie.
Es ist die neue Zeit, die vor Corona anfing, an der Oberfläche erst mal, im Straßenbild. Die Krisenjahre, in denen es nur bergab ging, als niemand noch an eine Zukunft glaubte, sie schienen vorbei. In unserem Viertel zumindest. Für einige zumindest. Oder waren es nur wenige? Oder schon viele?
Jetzt steigt die Arbeitslosigkeit wieder. Corona trifft vor allem den griechischen Tourismus, der vielen im Sommer zu Saisonjobs verhalf. Gerade den Jüngeren. Jenen, die geblieben sind; anders als die über 500 000 Griechen, die irgendwann in den letzten Jahren einen Flieger ins Ausland nahmen. Der griechische Finanzminister hat, anders als der deutsche, keine Bazooka zur Verfügung, die er auf den Tisch legen könnte. Auch er verkündete ein Rettungspaket, aber es fiel kleiner aus. Corona traf auf einen verwundbaren Staat, dessen Rücklagen im März 2020 nur für drei Monate reichten. Danach hätte er vor der Pleite gestanden.
Corona traf auf eine verwundbare Gesellschaft. Auf knapp elf Millionen Menschen mitten in einem Neuanfang. Wie reagiert jemand, der nach einer langen Depression einen neuen Job findet und ihn nach kurzer Zeit wieder verliert? Erlebt er einen Rückfall? Oder kommt er vielleicht besser klar mit dem neuerlichen Schlag, weil ihn die Krise robuster hat werden lassen?
Ein neues Land ist um Athen herum entstanden. Oder es entsteht gerade. Eins, in dem die Menschen danach suchen, wer sie sein wollen. Für was sie stehen wollen. Ständig versichern mir die Menschen hier, die Krise habe ihr Gutes gehabt. Die Jungen zählen die Fehler ihrer Eltern auf, sie sehen klar, was schiefgelaufen ist. So gut wie jeder hier hat sich jahrelang mit den Fehlern, mit den Unzulänglichkeiten des Landes beschäftigt, sich über sie geärgert. Und viele haben sich geschworen: Wir machen es besser.
Irgendwann vergangenes Jahr, in der virenfreien Zeit, ging ich durch die kaputten Straßen in die Innenstadt, wo ich einen Interviewtermin hatte. Zwei junge Gründer wollte ich treffen, die an eine Idee glaubten. Obwohl alles in ihrem bisherigen Leben dagegensprach, an überhaupt irgendetwas zu glauben.
Das Interview fand in einem Dachterrassencafé in Monastiraki statt, dem Viertel unterhalb der Akropolis. Wir saßen in der Sonne und tranken Freddo Espresso, den griechischen Eiskaffee. Wir schauten auf den Parthenon-Tempel und auf die Stadt zu den Füßen des Felsens und sprachen über die Zukunft, die gerade anfing. Die beiden glaubten an diese Zukunft, sie redeten gegen meine Skepsis an. Im Reden waren sie, wie fast alle Griechen, ziemlich talentiert. Eine neue Generation, sagten sie. Eine neue Mentalität. Eine wirkliche Katharsis, eine Reinigung.
Auf dem Hügel neben der Akropolis, dem Areopag, sahen wir die Touristen, kleine Punkte im grellen Licht. In der Antike tagte dort der oberste Rat, das Gericht. Die alten Griechen erfanden hier, um die Akropolis herum, die Rhetorik, die Demokratie. In der Nähe lehrte Aristoteles, dessen Denken den ganzen Westen bis heute prägt. Die fünf Millionen Besucher, die Athen 2019 zählte, kamen wegen dieser Geschichte: weil hier alles begann.
Was beginnt hier jetzt, in Athen, zweieinhalb Jahrtausende später, nach einem Jahrzehnt Krise? Was haben die Griechen uns heute zu sagen, in einer Zeit, in der wir alle eine Krise durchleben, die uns verändern wird?
Davon handelt dieses Buch.