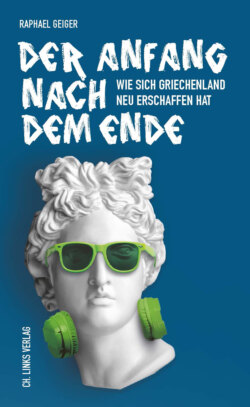Читать книгу Der Anfang nach dem Ende - Raphael Geiger - Страница 9
SCHULD Warum Griechenland so tief fiel oder Besuch bei drei Finanzministern
ОглавлениеVielleicht lag es am Ende daran, dass viele, die ans Rechthaben gewöhnt waren, zu lange nicht einsahen, dass sie sich irrten. Und selbst wenn, oft weitermachten wie zuvor. In dieser Krise ging es um viele Egos, und jeder versuchte, etwas zu retten: sein Amt, sein Geld oder wenigstens sein Gesicht. Die Sturheit auf allen Seiten verlängerte die Krise. Die Lautstärke machte sie schlimmer.
In den Nachtsitzungen in Brüssel, Welten entfernt von der griechischen Straße, ging es um Kompromisse, um den kleinsten gemeinsamen Nenner der Staats- und Regierungschefs. Alle waren müde. Worauf sie sich gegen Morgen einigten, war meistens nicht das, was die Griechen gebraucht hätten.
Am Anfang reagierte Europa in Panik, trotzdem erwartete niemand, dass die Krise so lange dauern würde. Auf falsche Diagnosen zur griechischen Realität folgten falsche Rezepte. Im ersten, zweiten und dritten Memorandum. Immer noch mehr von derselben Medizin: Austerität, also: Sparsamkeit, Haushaltsdisziplin.
In Griechenland glaubte niemand an deren Wirkung, über die politischen Lager hinweg, es war eine von außen beschlossene Politik, die das Volk von Anfang an nicht mitnahm. Wahrscheinlich war sie schon allein deswegen zum Scheitern verurteilt.
Yanis Varoufakis glaubt, dass sich die Sparpolitik im Lauf der Jahre verselbstständigte. Ihre Verfechter konnten nicht mehr anders, selbst wenn sie gewollt hätten. In Ländern wie Deutschland und den Niederlanden glaubten die Bürger, sie müssten für die Griechen zahlen, eine harte Linie gegen die Tsipras-Regierung war populär. Von »Machtlosigkeit im Zentrum der Macht« sprach Varoufakis im Rückblick. Selbst mächtige Akteure wie Wolfgang Schäuble oder Christine Lagarde, die IWF-Chefin, hätten nichts mehr ändern können. »Auch Wolfgang fühlte sich hilflos«, sagte Varoufakis.
Im Sommer 2015 ging es dann weniger um Lösungen für die griechischen Probleme, sondern mehr um einen Ausweg für jene, die in Brüssel am Tisch saßen. Alle waren des Themas müde. Die Griechen mussten endlich zu einem Kompromiss gezwungen werden, zu harten Zugeständnissen, damit die Vertreter der EU-Länder ihren Wählern weitere Kredite für Athen erklären konnten. Aus der Wirtschaftskrise war ein Nervenkrieg geworden, ein Nord-Süd-Duell, Berlin gegen Athen, ein Spiel mit Klischees und nationalen Befindlichkeiten. Es war, in einem Wort: irrational.
Aber von vorn.
Natürlich gab es Gründe dafür, dass es Griechenland so hart getroffen hatte. Wahrscheinlich war der Beitritt zur Euro-Zone schon der Erste. Er kam zu früh für das Land. In Deutschland war oft zu lesen, dass die Griechen ihre Zahlen gefälscht hatten, um überhaupt aufgenommen zu werden. Und es stimmte ja. Andererseits: Der Rest Europas war nicht naiv. Die Politiker der 90er-Jahre machten sich keine Illusionen über die griechische Wirtschaft, sie wussten vom ineffizienten Staatsapparat, von der Korruption, von der fehlenden Industrie. Aber sie wollten es: Sie wollten, dass Griechenland auch den nächsten Schritt der europäischen Integration mitgeht.
Den eigentlichen Fehler machten sie alle zusammen: Der gemeinsamen Währung folgte keine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Die deutsche Wirtschaft tickte weiterhin anders als die portugiesische, die finnische anders die griechische. Und manchen Ländern half der Euro mehr als anderen: Deutschland zum Beispiel profitierte als Exportwirtschaft besonders, es flutete die Eurozone mit Waren. Gerade in der Krise machte der schwache Euro die deutschen Waren global billig und die Bundesregierung profitierte von den extrem niedrigen Kreditzinsen. Für Griechenland dagegen war der Euro zu stark.
Aber die Probleme wurden erst deutlich, als es nicht mehr lief. Am Anfang schenkte der Euro auch den Griechen ein Wirtschaftswunder. Sie hatten auf einmal eine harte Währung in der Hand, zahlten ähnliche Zinsen wie die Deutschen. Das Geld war billig wie nie, für den Staat, für Firmen und für die Bürger. Die ersten Jahre des neuen Jahrtausends müssen in Athen eine große Party gewesen sein. Das Land erlebte einen Bauboom, der neben dem Tourismus das Wachstum trug. Es richtete die Olympischen Spiele aus, im selben Jahr gewann es tatsächlich die Fußball-EM. Eine Griechin erzählte mir später, sie habe in der Zeit sieben Kreditkarten besessen; ein anderer meinte, er habe gespürt: Das kann nicht gutgehen.
Noch 2007 aber gingen die Ratingagenturen davon aus, dass die griechische Wirtschaft weiterhin wachsen würde. Die Schulden waren zwar hoch, sie waren über Jahre immer weiter gestiegen. Aber auch die Wirtschaft wuchs zuverlässig, und so blieb die Schuldenquote, also die Staatsschulden in Relation zur Wirtschaftsleistung, stabil.
Heute lässt sich leicht sagen, dass das griechische Wachstum der Nullerjahre nicht real gewesen sei, auf Pump, nicht nachhaltig. Das mag sein. Aber ohne die Finanzkrise 2008 wäre die Party wohl noch weitergegangen. Der Auslöser für die griechische Krise kam also von außen: aus dem US-amerikanischen Immobilienmarkt, der die Finanzkrise über die Welt brachte. Die traf in Griechenland, wie beschrieben, auf einen verwundbaren Staat, auf verwundbare Banken. Die Wirtschaft war nicht robust genug für den Sturm. Das Wachstum stoppte, die Wirtschaft brach ein. Die Regierung versuchte die Banken zu retten, die Staatsschulden schnellten in die Höhe. Das Kartenhaus fiel in sich zusammen.
Hätte man es wissen müssen? Die Frage ist: wer? Die Griechen, die Kredite aufnahmen, oder die deutschen und französischen Banken, die ihnen die Kredite genehmigten? Beide Seiten glaubten an die Party. Beide dachten, es gehe so weiter. Und sie hatten Gründe dafür. Zahlen. Prognosen. Das eben, was Banken sich anschauen, wenn sie über Kredite entscheiden. Nein, die griechische Krise war kein Erwachen aus einem Traum. Weder Banker noch Politiker waren naiv.
Klar hatte es in Athen politisches Versagen gegeben. Bad governance, schlechtes Regierungshandwerk. Viel zu wenig kümmerte sich Griechenland um Strukturpolitik, also darum, Betriebe anzusiedeln, zu überlegen: Was kann das Land herstellen und exportieren? Die Wirtschaft war nicht innovativ, und sie setzte mit Bau und Tourismus auf zwei besonders instabile Branchen.
Die Politik ließ die Bürger mittels Stellen im öffentlichen Dienst am Erfolg teilhaben, der Staatsapparat wuchs, und wer diese Stellen bekam, entschied sich mehr über Kontakte als über Qualifikation. Es war ein System, in dem man weiterkam, wenn man keine Scheu davor hatte, sich Vorteile zu verschaffen. Klientelismus, Ineffizienz und eine Selbstbedienungsmentalität auf allen Ebenen: Alles das trug dazu bei, dass Griechenland anfällig war.
Alles das stimmt. Aber es erklärt nicht, warum das Land in den freien Fall überging, und das jahrelang.
»Das meiste, was die Gläubiger vorschlugen, musste getan werden«, sagte der Mann, den wir im Frühjahr 2015 in seinem Haus in einem Athener Vorort besuchten. Wir saßen im Garten, seine Frau brachte Kaffee. Er lächelte und sagte: »Thank you so much.«
Giorgos Papakonstantinou war der erste Finanzminister der Krise, von 2009 bis 2011, die Griechen kennen ihn als den Mann, der die Troika ins Land holte. Das ist ein bisschen unfair. Griechenland brauchte Finanzhilfe damals, und Giorgos Papandreou, der Premierminister, wies Papakonstantinou an, die entscheidende E-Mail abzuschicken. Die Adressaten: Eurogruppe, EU-Kommission, EZB und IWF. Drei Zeilen, eine Botschaft: SOS. Griechenland braucht Geld, sonst geht es pleite, und zwar sehr bald.
Als Finanzminister wurde Papakonstantinou für die Griechen dann zum Gesicht der ersten Steuererhöhungen und Kürzungen. Irgendwie spürten die Menschen wohl auch, dass er sich in seinem Büro im Ministerium oder bei den Verhandlungen in Brüssel wohler fühlte als bei ihnen auf der Straße. Die Gläubiger schätzten ihn. Er hatte an der London School of Economics promoviert und zehn Jahre bei der OECD in Paris gearbeitet.
Papakonstantinou erzählte, wie er nach dem Wahlsieg seiner sozialdemokratischen PASOK im September 2009 sein künftiges Büro im Finanzministerium vorfand: leer. Nicht mal einen Laptop hatte ihm sein Vorgänger von der Nea Dimokratia zurückgelassen. Ein demokratischer Machtwechsel, der sich mehr wie ein Regimewechsel anfühlte. Papakonstantinou machte sich mit ein paar Mitarbeitern an eine Bestandsaufnahme, holte Leute von der Notenbank und vom Statistikamt dazu. Zu seinem Erstaunen hatten diese sich vorher nie getroffen.
Es stellte sich heraus, dass die Vorgängerregierung die Zahlen geschönt hatte. Das Haushaltsdefizit war viel höher als angenommen, was vor allem an der Bankenrettung lag. Auf über 15 Prozent war es gestiegen, erlaubt sind in der Eurozone drei Prozent. Papakonstantinou realisierte, was da auf ihn zukam. In seinem Buch Game Over schrieb er später: »Dafür habe ich ein angenehmes Leben in Paris hinter mir gelassen.«
Er unterschrieb den größten Kredit, den je ein Land erhalten hatte. Im Gegenzug verpflichtete Athen sich, seinen Staatshaushalt auszugleichen, damit es den Kredit bedienen konnte. Die Europäer zwangen den Griechen ein »außerordentlich hartes Sparprogramm« auf, so formulierte es der Minister. Mit einem schlankeren Staat und ordentlichen Staatsfinanzen, so die Hoffnung, würden bald schon die Investoren nach Griechenland zurückkehren und das Wachstum würde neue Steuereinnahmen generieren. Die Ökonomen und Politiker, die so dachten, gingen von einer kurzen Krise aus.
Papakonstantinou mochten die Gläubiger, ihm vertrauten sie. Er verstand ja wirklich etwas von Wirtschaft. Sein halbes Erwachsenenleben hatte er im Ausland verbracht, nach Athen kam er als Außenseiter. Im Ministerium entdeckte er Dinge, die er nie für möglich gehalten hätte: Das Haus gab im Monat 35 000 Euro für Zeitungsabos aus, ein früherer Minister hatte Dutzende Hermes-Krawatten als Geschenke kaufen lassen. Das staatliche Gesundheitswesen zahlte für medizinisches Material zehnmal mehr als private Kliniken, zehntausende Renten gingen auf Konten, deren Besitzer verstorben waren.
»Überall fanden wir Beweise für ein System, das aus den Fugen geraten war«, schrieb Papakonstantinou in seinem Buch. Er habe die Dinge wieder ins Lot bringen, den Apparat reformieren wollen. Das eigentliche Problem in Griechenland sei der »Sozialvertrag« gewesen, letztlich habe nichts mehr gegolten: »Die Bürger tun so, als würden sie Steuern zahlen, und der Staat tut so, als würde er im Gegenzug Dienstleistungen bereitstellen.« In Wahrheit zahlten die Bürger weniger, als sie mussten, und kamen damit davon. Der Staat wiederum versagte und kam damit durch, weil die Bürger daran gewöhnt waren. Sie erwarteten nichts von ihm.
Dieses Problem war größer als die Schulden, aber um es zu lösen, hätte Papakonstantinou Zeit gebraucht, und die blieb ihm nicht. Einerseits erdrückten ihn die Forderungen der Troika, die immer drastischer wurden, andererseits die griechische Straße, die gegen die Kürzungen aufbegehrte. Als Premier Papandreou spürte, wie sehr die Griechen Papakonstantinou inzwischen verachteten, versetzte er ihn ins Umweltministerium.
Hat Papakonstantinou sich etwas vorzuwerfen? Zweifellos habe er Fehler gemacht, sagte er. Aber nein: An seinem Weg, moderat zu sparen und gleichzeitig zu reformieren, zweifle er nicht. Er hatte Mitleid mit sich: Jahrelang habe er nur noch mit Polizeischutz auf die Straße gekonnt, er sei der »Prügelknabe« gewesen. Im Buch beschrieb er sich als denjenigen, »der die Lichter ausknipste, als die Musik aufhörte, und allen verkündete, dass die Party zu Ende sei«.
Die Einschnitte trafen die griechische Gesellschaft wie ein Schock, und die Logik der Gläubiger ging nicht auf. Über die Jahre schrumpfte die griechische Wirtschaft immer weiter, insgesamt um mehr als ein Viertel. Die Menschen verloren im Schnitt ein Drittel ihres Einkommens und 40 Prozent ihrer Vermögen. Die Arbeitslosigkeit stieg bis auf fast 28 Prozent, unter den Jungen hatte nicht mal jeder Zweite einen Job. Und die Erwerbstätigen unter den Jungen verdienten 45 Prozent weniger als vor der Krise.
Je länger die Rezession dauerte, desto weiter stieg die Schuldenquote. Der Staat konnte gar nicht genug sparen. Und andersherum: Je mehr er sparte, die Steuern erhöhte und die Löhne im öffentlichen Dienst senkte, desto stärker schrumpfte die Wirtschaft. Die Regierung senkte den Mindestlohn, damit die Unternehmen ihre Angestellten bezahlen konnten; daraufhin hatten die Menschen noch weniger Geld zum Ausgeben, der Staat nahm noch weniger ein. Und so weiter.
Das einzugestehen konnte sich aber niemand in Europa politisch leisten. Es war schon zu viel Geld geflossen. Vor allem zwischen Deutschen und Griechen war viel kaputtgegangen. In Deutschland setzte sich der Eindruck fest, man müsse bezahlen für die Griechen. In Griechenland fühlten sich viele von den Deutschen belehrt bis gedemütigt.
Christine Lagarde gab später zu, dass sie zu optimistisch gewesen sei. Selbst Wolfgang Schäuble räumte laut Yanis Varoufakis im Privaten ein, dass das Sparprogramm schlecht für Griechenland sei, weil wachstumshemmend. Aber Schäuble, Lagarde und den anderen Verantwortlichen ging es irgendwann weniger um die Wachstumsprognose fürs übernächste Jahr. Was zählte, war das unbedingte Einhalten der Regeln. Und die nächste Kredittranche. Hätten die Griechen sie nicht mehr zahlen können, wäre das System in sich zusammengefallen. Schäuble hätte den deutschen Steuerzahlern erklären müssen, dass ihr Geld verloren war.
Schäuble schien den Griechen zu misstrauen. Keiner drängte so sehr aufs Sparen wie er. Während Papakonstantinous Amtszeit fielen die griechischen Staatsausgaben um 30 Prozent. Ähnlich stark verlor die PASOK, seine Partei. Sie hatte das Licht ausgemacht bei der Party, bei der nächsten Wahl stürzte sie ab: von 44 auf 13 Prozent der Stimmen.
Neue Finanzminister übernahmen, die vor denselben Problemen standen: Wie rettet man ein Land, das tiefe Reformen bräuchte, während gerade alles zusammenbricht und man Gläubigern ausgeliefert ist, die nur aufs Haushaltsdefizit schauen? Geld in die Wirtschaft pumpen? Ging nicht, wegen des Defizits. Investoren ins Land holen? Diesem Land vertraute niemand mehr.
Im Finanzministerium fing 2012 ein Mann an, der überzeugt war, sich den Gläubigern fügen zu müssen, damit das alles irgendwann ein Ende haben würde: Christos Staikouras, ein 39 Jahre alter konservativer Abgeordneter. Als Vizefinanzminister war er zuständig für den Staatshaushalt. Inzwischen regierte eine Art große Koalition, die nicht mehr sehr groß war, sie bestand aus der Nea Dimokratia und der PASOK. Die Nea Dimokratia war vor der Krise an der Macht gewesen, sie war damals für die falschen Zahlen verantwortlich. Jetzt profitierte sie davon, dass sie die ersten Krisenjahre in der Opposition verbracht hatte: Sie stellte wieder den Premier.
Als ich Christos Staikouras traf, fiel schnell das Wort Disziplin. Er glaubte an Werte wie Strebsamkeit und Sparsamkeit. Und er glaubte, wie schon Papakonstantinou, den Weg gefunden zu haben. Der bestand weniger in Steuererhöhungen, die seien, meinte er, ineffizient und unsozial. Stattdessen setzte er auf die cuts, die Kürzungen. Viele Milliarden sparte er ein, vor allem bei Renten und Gehältern im öffentlichen Dienst. »Fiskaldisziplin«, sagte er: »Dieses Wort haben wir neu in die griechische Sprache eingeführt.« Er war überzeugt: Wenn der Staat nur seine harte Linie durchhielt, würde das Vertrauen zurückkehren und die Wirtschaft wieder wachsen.
Tatsächlich gelang Staikouras im Jahr 2014 ein so genannter Primärüberschuss: Rechnete man die Schuldzinsen nicht mit, gab der Staat nun weniger aus, als er einnahm. Dieser Regierung vertrauten die Märkte. Es gelang ihr, die Lage in den Griff zu bekommen. Endlich war der Punkt erreicht, den die Sparideologen fünf Jahre vorher prophezeit hatten: Die Zahlen stimmten wieder, die Wirtschaft begann, sich zu erholen. Hätte man ihn machen lassen, sagte mir Staikouras, hätte die griechische Krise schnell vorbei sein können.
Wahrscheinlich hatte er recht. Und gleichzeitig irrte er sich gewaltig. Während die Wirtschaft nicht mehr weiter schrumpfte, machten Staikouras’ cuts die Menschen noch viel ärmer. Er übersah, dass das Volk nicht mehr konnte. Die Griechen begriffen es als Hohn, dass die Regierung schon vom Ende der Krise sprach, von einer beginnenden Erfolgsgeschichte. Sie litten mehr als je zuvor.
Ende 2014 gelang es der Regierung nicht, ihren Kandidaten für das Amt des Staatspräsidenten durchzusetzen, und die Opposition unter Alexis Tsipras erzwang Neuwahlen. Tsipras gewann, Staikouras verlor sein Amt. Auch ihn interviewte ich im Frühjahr 2015, den ersten Monaten der Tsipras-Regierung. Staikouras war zurück in seinem Abgeordneten-Büro, auf dem Schreibtisch standen orthodoxe Ikonen. Trug er Schuld? Er war sich keiner bewusst. Dank seiner Politik, sagte er, habe Tsipras nun mehr Spielraum. Der allerdings sprach nicht mehr so oft von Disziplin.
Die Krise ging in ihr siebtes Jahr.
Es war die Wut der Griechen, die den Wirtschaftsprofessor Yanis Varoufakis ins Amt hievte. Sie kannten ihn aus Fernseh-Talkshows, wo er sich als Kritiker des ewigen Sparens und der endlosen Kredite profiliert hatte. Er besaß die Gabe, ökonomische Probleme einfach zu erklären.
Von den drei Finanzministern, die ich traf, war Varoufakis’ Amtszeit am kürzesten. Kein halbes Jahr verging bis zu seinem Rücktritt nach dem Referendum im Juli 2015. Als wir später in seiner Wohnung in Athen zusammensaßen, erzählte er mir, wie es anfing. Wie er am ersten Abend allein im Ministerium saß, wie er jemanden suchte, der ihm das WLAN-Passwort sagen konnte. Ihm erging es genauso wie Jahre zuvor Papakonstantinou: Als er sein Büro betrat, war es leer. Die Vorgänger, darunter Staikouras, hatten alles mitgenommen.
Sicher stimmte vieles, was Varoufakis sagte. Es entsprach der Expertise amerikanischer Ökonomen wie Joseph Stiglitz oder Paul Krugman, beide Nobelpreisträger, beide Kritiker der europäischen Sparpolitik. Seine Diagnose war nicht so exotisch wie in Deutschland oft dargestellt. Die Politik der radikalen Kürzungen war falsch, sie ließ die Wirtschaft viel schneller und heftiger schrumpfen als nötig.
Doch es war zu spät, und der Aufstand, den Varoufakis und Tsipras anzettelten, machte alles noch schlimmer. Kein Investor verirrte sich 2015 nach Griechenland, ein Land, von dem man fürchten musste, dass es vor dem völligen Chaos stand. Varoufakis’ Job als Finanzminister wäre es gewesen, die Märkte zu beruhigen, er hätte Seriosität ausstrahlen müssen. Stattdessen redete er noch im Sommer 2015 über die falsche Politik der vergangenen Jahre. Er dachte weiterhin, er könne die Gläubiger von einem Kurswechsel überzeugen.
Varoufakis ist ein höflicher Mensch. Er spricht noch besser Englisch als Christos Staikouras, seine Rhetorik ist pointierter als die von Giorgos Papakonstantinou. Gut, er trug keine Krawatten, er glaubte nicht daran, dass der Finanzminister aussehen muss wie ein Buchhalter. Wahrscheinlich half ihm seine Rockstarattitüde nicht, als er in Brüssel auf die anderen Euro-Finanzminister traf. Aus deren Sicht war Varoufakis nicht einer von ihnen. Vorgänger wie Papakonstantinou verachteten ihn, und Staikouras wollte gar nicht erst über ihn sprechen.
Trägt Varoufakis Schuld? Er hätte die Lage 2015 niemals so sehr eskalieren lassen dürfen. Aber er dachte eben, wie schon Papakonstantinou und Staikouras, dass er das Richtige tat. Möglicherweise waren Stabilität und Ruhe zwei Werte, die in seinem Denken eine weniger große Rolle spielten. Ihm ging es ums Rechthaben. Was ihn, irgendwie, mit Schäuble verband. »Wolfgang und ich waren wie zwei Boxer«, sagte er mir, »die einander verprügelt haben und sich am Ende näher waren als irgendjemandem sonst.«
Christos Staikouras ist heute Finanzminister. Der Erste seit über einem Jahrzehnt, der gute Nachrichten zu verkünden hatte, ein paar Monate lang zumindest. Dann traf ihn die Coronakrise. In einem Interview mit dem Handelsblatt sprach er darüber, was aus der vorigen Krise zu lernen sei. »Dass es keine Patentrezepte gibt«, sagte er. »Politik darf niemals rigoros sein.«
Die Schuldfrage steht immer noch im Raum, vielleicht wird sie nie ganz zu beantworten sein. Der Euro kam zu früh für Griechenland? Ja, wahrscheinlich. Die Regierungen in Athen waren jahrelang verantwortungslos? Stimmt ganz sicher. Die Europäer wollten zu lange nicht wahrhaben, dass sie den Griechen helfen mussten? Richtig. Die Sparprogramme waren zu radikal und machten die Krise dadurch schlimmer als nötig? Unbedingt. Politische Feigheit und Sturheit verhinderten einen Kurswechsel? Eindeutig. Die Krise hätte früher vorbei sein können, wenn Tsipras und Varoufakis nie an die Macht gekommen wären? Vermutlich ja.
Am Anfang war es das Unvermögen aller Beteiligten, sich vorzustellen, wie tief die Krise ausfallen könnte. Später war es die Hysterie überall auf dem Kontinent, die kaum noch jemanden rational handeln ließ. Varoufakis hielt an seinem Aufstand fest, als der längst gescheitert war. Wolfgang Schäuble hätte die Griechen am liebsten aus dem Euro geworfen, es schien sein persönliches Projekt zu sein. Er wirkte wie besessen davon.
Faszinierend ist im Nachhinein, wie sich die Kategorien auflösten. Was war rational, was irrational? Beide Seiten nahmen für sich in Anspruch, rational zu handeln, während sich die andere angeblich verrannt habe.
Für die Medizin des Sparens fanden sich immer genügend Zahlen und Argumente, die meisten stammten aus Deutschland. Die Gegenposition formulierten einige internationale Top-Ökonomen in einem offenen Brief an Angela Merkel: »Das endlose Spardiktat funktioniert einfach nicht.« Doch für diesen Widerspruch waren die Akteure in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten nicht mehr erreichbar.
Volkswirtschaft ist keine Naturwissenschaft. Die Professoren widersprachen sich, und die verschiedenen Positionen erlaubten es auch Laien, sich einer anzuschließen, ohne selbst nachdenken zu müssen. Der Titel Ökonom hatte ungefähr das Gewicht wie der des Virologen während der Coronakrise. Und so kam es, dass sich jeder einrichten konnte in seiner Position.
Die Menschen verbarrikadierten sich in ihren Lagern, wie kurze Zeit später während der Flüchtlingskrise, wie in der Brexit-Debatte oder im US-amerikanischen Wahlkampf. Woran man selbst glaubte, war wahr. Alles andere war fake news, auch wenn den Begriff erst Donald Trump prägte, ein Jahr nach dem Rücktritt von Yanis Varoufakis, ein Jahr nach dem griechischen Aufstand.
Die griechische Krise hat also noch eine Dimension: Sie war die erste Krise unserer Zeit, in der auch die eine Wahrheit starb, die alle mehr oder weniger akzeptieren. Man diskutierte nicht mehr auf einer Grundlage, man sprach der anderen Seite die Grundlage ab. Jede Seite hatte ihre Ökonomen, an die sie glaubte. Ihre Fakten. Ihre Wahrheit. Und wo alle recht haben, hat irgendwie auch niemand Schuld.