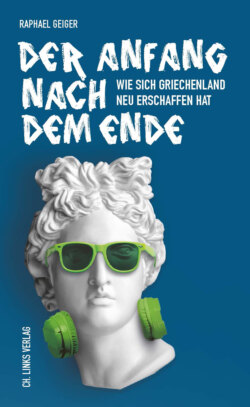Читать книгу Der Anfang nach dem Ende - Raphael Geiger - Страница 8
SHOWDOWN Wie der Aufstand gegen die Sparpolitik scheiterte
ОглавлениеSie schämten sich. Mitten in der Nacht waren sie aufgebrochen, nach der Rede ihres Premierministers. Zum ersten Geldautomaten in der Nähe, und falls der leer war, zum nächsten. Sie reihten sich ein in der Schlange der anderen, die auch Angst hatten. Und die sich auch schämten.
Uns, die Reporter, wiesen die meisten ab, auch wenn Nikos, der Fotograf, mich als Amerikaner vorstellte. Niemand sollte erfahren, dass wir für ein deutsches Magazin unterwegs waren. Aber auch so wollte kaum jemand mit uns reden. Schlimm genug, dass ihre Scham öffentlich ausgestellt war, während sie in den Schlangen standen. Kein Automat mehr in der ganzen Stadt, vor dem sich keine gebildet hatte. War ein Automat verwaist, hieß es, dass er leer war.
Die Athener hoben in dieser Nacht Ende Juni 2015 alles Bargeld ab, das sie kriegen konnten. Ihre Blicke werde ich nie vergessen. Scham, ja, aber sie hatten auch etwas Aggressives an sich. So schauen Menschen, wenn sie glauben, dass es ums Überleben geht. Wenn jeder andere der Feind ist: die Person vor einem in der Schlange, die den letzten Schein bekommt, aber auch der Fotograf, der die Kamera auf einen hält, in einer Situation, in der man nicht gesehen werden möchte.
Sie alle hatten, unabhängig voneinander, denselben Reflex gehabt, als sie die Rede von Alexis Tsipras sahen. Spät am Freitag, um Mitternacht, hatte sich der Premier an die Griechen gewendet: Nach fünf Monaten der Verhandlungen sei es nun am Volk, dem Souverän, zu entscheiden. Die Gläubiger forderten immer noch mehr Einschnitte, Steuererhöhungen, Privatisierungen; nur so werde Griechenland weitere Kredite bekommen, und ohne Kredite sei der Staat am Ende.
Es sei ein Ultimatum, sagte Tsipras, nur das Volk könne darauf antworten. Entweder Nai sagen, also Ja, oder Ochi: Nein. Was das Ja bedeuten würde, war relativ klar: mehr von dem, was die Griechen schon jahrelang erlebt hatten. Und was Tsipras verhindern wollte. Wohin ein Nein führen würde, war weniger klar; der Grexit jedenfalls erschien nicht ganz unwahrscheinlich.
Deshalb also waren die Menschen nachts zu den Automaten geströmt. Weil sie ahnten, dass es möglicherweise bald gar kein Geld mehr geben würde. Die Schlangen gehörten noch tagelang zum Straßenbild in Athen; wo immer ein Automat mit Geld befüllt wurde, reihten sich die Leute ein. Niemand drängelte, jeder wartete, bis er dran war. Versuchte jemand, die Schlange zu umgehen, entlud sich der Zorn der anderen, und die Person machte sich davon.
Noch am Wochenende sah sich die Regierung zu einer Maßnahme gezwungen, mit der viele schon gerechnet hatten: Kapitalverkehrskontrollen. Jede Griechin und jeder Grieche durfte von da an nur noch maximal 60 Euro am Tag abheben, und die Bankfilialen blieben ganz geschlossen. Yanis Varoufakis, der Finanzminister, kam nach Hause zu seiner Frau und sagte: »Honey, I shut the banks.« So erzählte er es zumindest. Wenige Tage später sollte er zurücktreten.
Es war seltsam. Zwar schaute die Welt auf Griechenland, neben den Geldautomaten im Athener Zentrum wechselten sich die TV-Teams ab. Selbst die Präsidenten der USA und Chinas äußerten sich zum Showdown und mahnten eine Einigung an. Trotzdem fühlten sich die Griechen unverstanden. Kaum jemand sprach noch über ihr Leid, es ging um das Drama zwischen den Griechen und den Deutschen, zwischen den Griechen und der Troika. Um Varoufakis gegen Schäuble, Tsipras gegen Merkel. Die Debatte drehte sich nicht mehr um die richtige Krisenpolitik, sondern um sich selbst. Showdown-Zeit. Deswegen schaute die Welt auf Athen: Weil es spannend war. Wegen des Dramas. Nicht wegen der Probleme. Und der eigentliche Showdown würde nach dem Referendum nicht mehr in Griechenland stattfinden, sondern in Brüssel.
In all den Monaten unter der neuen Regierung hatten die Gläubiger nicht nachgegeben, im Gegenteil, die Hardliner um Wolfgang Schäuble stellten noch radikalere Forderungen. Schäuble lehnte auch einen Schuldenschnitt ab, wie ihn die Griechen verlangten, und wie ihn auch der IWF forderte. Am 22. Juni legte Varoufakis ein Papier voller Maßnahmen vor, darunter eine Mehrwertsteuererhöhung. Alles das widersprach seiner Überzeugung und der Expertise sehr vieler Ökonomen, es war Gift für die griechische Wirtschaft, aber es war das, was die Gläubiger verlangten: noch mehr Sparen, mehr Haushaltskonsolidierung, selbst in diesen Zeiten, in denen die Wirtschaft dringend Wachstumsimpulse gebraucht hätte.
Für die Griechen war Varoufakis’ Papier eine Kapitulation. Und so nahmen es die Gläubiger zunächst auch auf. Am nächsten Tag aber passierte etwas, womit in Athen niemand gerechnet hatte: Auf einmal hieß es, das griechische Papier gehe nicht weit genug. So begann die Woche, an deren Ende sich Tsipras entschied, am 5. Juli ein Referendum abzuhalten.
Die Griechen sollten jetzt Ja oder Nein sagen, aber wozu? Zur Sparpolitik? Oder zu Europa, wie es die Opposition formulierte, die sich für ein Ja starkmachte: Das hier sei eine Abstimmung darüber, ob Griechenland weiter zu Europa gehören würde.
In vielen griechischen Wählern, mit denen ich sprach, spielte sich ein Konflikt ab zwischen Wut und Angst. Die Wut wählte das Wagnis und sagte Nein, die Angst wollte nicht noch mehr Chaos und sagte Ja. Noch mehr Sparpolitik konnten sich viele schlicht nicht vorstellen, sie wussten nicht, wie sie das noch jahrelang aushalten sollten. Andererseits wussten sie nicht, wie schlimm ein Grexit werden würde.
Tsipras argumentierte, ein klares Nein der Griechen würde in Brüssel sein Mandat stärken. Die Entscheidung der Bürger müsse man auch dort zur Kenntnis nehmen. Ein letzter Versuch, doch noch Zugeständnisse zu erreichen, doch noch zu gewinnen. Die Demoskopen sagten voraus, dass es knapp werden würde.
In den Tagen um das Referendum lief Giorgos Katrougalos, der Minister, durch Athen und gab Interviews. Al Jazeera, CNN, Bloomberg: Die TV-Sender mochten ihn, weil er gut Englisch sprach, seriös wirkte und schlüssig auf den Punkt bringen konnte, was gerade geschah. Für Tsipras war er ein guter Sprecher. So stellte er sich in der Nachmittagshitze auf Dachterrassen, im Hintergrund meistens das Parlament oder die Akropolis, und erklärte die griechische Welt.
»Die Sparpolitik hat unser Land zerstört«, sagte er Al Jazeera, »die Hälfte der Bevölkerung lebt an oder unter der Armutsgrenze.« Seine Regierung habe Zugeständnisse gemacht – dass die Gläubiger diese nicht akzeptierten, mache ihn glauben, »dass es da eine geheime Agenda gibt, die einzige linke Regierung Europas zu zerstören.«
Katrougalos wirkte immer noch so ruhig und fokussiert, wie ich ihn kennengelernt hatte, er lächelte, wenn er die Interviewer anschaute, nickte viel. Aber doch klang er jetzt anders. Kämpferischer, politischer. Vielleicht war es die Erfahrung, dass niemand in Europa wirklich an seinem Erfolg als Minister interessiert zu sein schien. Er hatte zu zweifeln begonnen, ob die Gegenseite überhaupt eine Einigung wollte.
»Es muss Raum für uns geben in Europa«, sagte er Bloomberg. »Raum für unsere Vision, die eine andere ist, die von der Orthodoxie des Neoliberalismus abweicht. Wozu sonst überhaupt noch Wahlen, warum dann nicht einfach die gleiche Politik überall?« Ja, sagte er, er sei vielleicht zu optimistisch gewesen. Er habe eben stark an die Vernunft geglaubt.
Er sah, wie viele in seiner Regierung, zu lange nicht, dass es dem deutschen Finanzminister weniger darum ging, dass die griechische Verwaltung reformiert wird, sondern mehr darum, dass die Zahlen stimmen, wenn er vor die Basis der CDU tritt. Im Jahr 2014, in dem die Griechen still unter den Kürzungen litten, war aus der Sicht von Schäuble und der anderen Gläubiger alles in Ordnung. Die Syriza-Regierung hatte die Ruhe gestört.
Und jetzt schlossen sich die Griechen ihr an: Beim Referendum kreuzten 61 Prozent von ihnen Ochi an. Und da war sie wieder, für einen Moment: die Euphorie. Eine Stimmung, als würde sich das griechische Volk einer ausländischen Aggression entgegenstellen. Wie im Jahr 1940, als der italienische Diktator Mussolini den Griechen ein Ultimatum stellte, mit Einmarsch drohte. Das Wort aus dem Mund des griechischen Staatschefs Metaxas damals: Ochi.
Jetzt, nach dem Referendum, feierten die Menschen. Auf den Straßen bis in die Nacht Party. Und auf einmal wieder Hoffnung: Vielleicht gewinnen wir doch noch.
Mich fasziniert diese Entscheidung bis heute. Trotz der Scham in den Schlangen vor den Automaten hatten sich die Griechen für das Wagnis entschieden. Hatten sie, wie Katrougalos meinte, gespürt, dass es jetzt »um die Demokratie ging, nicht bloß um die Wirtschaft«?
In der Woche nach dem Referendum, als Alexis Tsipras zum entscheidenden EU-Gipfel nach Brüssel flog, traf ich mich in Athen mit Maria, einer jungen Bankerin, von der ich wusste, dass sie mit Ochi gestimmt hatte. Warum hatte sie, die weder Anarchistin noch Kommunistin war, sich dazu entschieden? Nach Tagen, Wochen und Monaten des Tumults, die sie in ihrer Bankfiliale unmittelbar mitbekommen hatte?
Wir trafen uns in einem Café. Maria trug einen Blazer, sie war gerade aus der Bank gekommen. Die war zwar auf staatliche Anordnung geschlossen, weil man fürchtete, dass die Bargeldreserven nicht reichen könnten. Für Rentner, die keine EC-Karte besaßen, blieb die Filiale aber geöffnet.
Jeden Morgen bildeten sie eine Schlange, erzählte Maria. Sie sitze dann hinter ihrem Schalter, während ein Rentner nach dem anderen hereingelassen werde. Die meisten waren Männer, sie kamen morgens, weil die Hitze später unerträglich wurde. Heiß war es aber auch morgens schon, und so standen die Rentner verschwitzt vor Maria, hoffend, dass im Tresor noch genug Bargeld übrig war. Es kam vor, dass sie zu den Wartenden hinausgehen und ihnen sagen musste, dass die Vorräte leider aufgebraucht waren. Aber schon der Blick der alten Männer am Schalter, erzählte Maria, mache sie fertig.
Sie hatte in den Wachstumsjahren angefangen, vor 2008, als die Renten und Gehälter stiegen, als es in ihrer Bankfiliale meistens gute Nachrichten für die Kunden gab. In der Krise wurde Marias Arbeitsplatz zu einem Ort, vor dem die Menschen Angst hatten. Am Geldautomaten oder am Schalter wurde die Krise konkret, die Kunden wurden stetig ärmer, Maria konnte ihnen Jahr für Jahr weniger auszahlen.
Offenbar funktionierte das System nicht mehr. Maria begann, an den Verhältnissen zu zweifeln. Sie war weiterhin keine Revolutionärin, doch ihr Glauben wankte, dass die Dinge genauso sein mussten, wie sie waren. Wütend wurde Maria aber erst jetzt, in diesem Sommer. »Auf das System«, sagte sie. »Die großen Konzerne, die Chefs meiner Bank, die Medien, die Politik.«
Das klang ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber worum es ihr ging, war das Referendum: Fast alle TV-Sender hatten für ein Ja geworben, die meisten waren im Besitz von Oligarchen. Der Leiter von Marias Bankfiliale bat die Mitarbeiter, mit Ja zu stimmen. Deshalb wollte Maria auch ihren Nachnamen nicht veröffentlicht wissen. Und genau das war der Grund ihrer Wut: Man wollte sie zu einem Ja drängen, nach allem, was in den Jahren zuvor an Leid über ihr Land gekommen war. »Durch die Politik des Ja«, wie es Maria sagte. Am Bankschalter sah sie jeden Tag, wer für diese Politik bezahlen musste.
Sie selbst hatte noch das Glück gehabt, vor der Krise ins Arbeitsleben zu starten. Wäre sie ein paar Jahre später geboren, hätte sie ihren Job nie bekommen. Die Krise ging in ihr siebtes Jahr, das heißt: Für eine ganze Generation, die jetzt mit dem Studium oder der Ausbildung fertig wurde, standen kaum Stellen zur Verfügung. Die Älteren litten unter Renten- und Gehaltskürzungen, aber für die Jungen war selbst ein niedriges Gehalt unerreichbar. Keine Firma stellte jetzt ein.
Ich fragte Maria, ob sie Angst vor der Zukunft habe. Nein, antwortete sie. Sie habe Angst vor der Gegenwart. Und ja, klar, vor einer Zukunft, wenn diese eine Fortsetzung der Gegenwart ist. Dagegen hatte sie mit ihrem Nein gestimmt: Es sollte unter keinen Umständen so weitergehen wie bisher. Dagegen stimmten beim Referendum 85 Prozent der jungen Wähler. Sie hatten nichts mehr zu verlieren. Sie waren die Generation Ochi.
Zwei Tage nach meinem Treffen mit Maria unterschrieb Alexis Tsipras in Brüssel ein drittes Memorandum. Es war härter als die ersten beiden. Aus dem Ochi war innerhalb einer Woche ein Nai geworden. Das Wagnis, für das sich das griechische Volk entschieden hatte, war Tsipras zu groß. Knickte er ein? Oder wurde er damit seiner Verantwortung gerecht?
Auf Twitter folgte noch in der Nacht ein Hashtag: #Thisisacoup, dies ist ein Putsch. Der Hashtag trendete, eine Milliarde Menschen weltweit nahmen ihn wahr, ein letztes Mal trugen die Griechen ihren Protest um den Planeten. Tatsächlich wirkte es seltsam: Das Ausland zwang den Griechen etwas auf, was diese gerade in einem demokratischen Votum eindeutig abgelehnt hatten. Die direkte Demokratie hatte verloren gegen die repräsentative, gegen die Demokratie der Politikprofis, die der Kompromisse. Eine Verhandlungsnacht in Brüssel annullierte das Ergebnis einer Volksabstimmung.
Der Grexit war abgewendet, das griechische Drama geriet aus den Schlagzeilen. Die Griechen litten weiter, mehr noch als zuvor, denn Tsipras machte sich daran, alles das umzusetzen, was er unterschrieben hatte. Die Jahre nach 2015 gehörten zu den schlimmsten der ganzen Krise.
Die Weltöffentlichkeit zog weiter, die Griechen waren wieder allein mit sich. Nach einem langen halben Jahr der Schlagzeilen meldete sich ein altes Gefühl zurück: die Apathie. Im September gewann Tsipras sogar noch die Neuwahl, die er ausgerufen hatte; Syriza verlor zwar dramatisch an Wählern, aber die Unzufriedenen blieben lieber zu Hause, als zur Opposition zu wechseln.
Viele Griechen nehmen es Tsipras heute übel, dass sein Aufstand im Jahr 2015 zu noch mehr Kürzungen und zu noch höheren Steuern führte. Die Maßnahmen wären wohl weniger drastisch ausgefallen, wenn der Premier schon zu Anfang so diplomatisch aufgetreten wäre wie später in seiner Amtszeit. Einer Schätzung zufolge kostete Tsipras’ »Strategie der Konfrontation« das Land über 100 Milliarden Euro.
Giorgos Katrougalos wurde Minister für Arbeit und Soziales und damit zuständig für viele der Maßnahmen, die er für falsch hielt. Später ernannte Tsipras ihn zum Außenminister. Der Mann, der nie in die Politik wollte, machte eine schnelle Karriere, wenn auch eine kurze. Seit Tsipras’ Wahlniederlage im Juli 2019 sitzt er als einfacher Abgeordneter im Parlament.
Was bleibt vom Showdown? Eine noch viel längere Krise. Ein Moment der Angst für eine Gesellschaft, in der viele schon sehr viel verloren hatten. Ein traumatischer Moment. Aber auch der eine Tag Anfang Juli, ein Tag, der viele Griechen stolz machte. Das Datum ist heute in Athen auf viele Fassaden gesprüht: 5. Juli 2015. Daneben steht: Ochi.