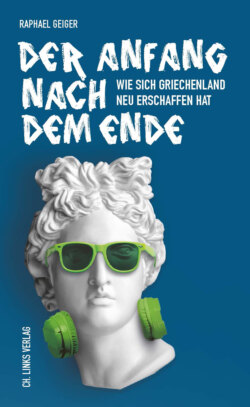Читать книгу Der Anfang nach dem Ende - Raphael Geiger - Страница 7
IM ATHENER FRÜHLING Wie die Griechen Anfang 2015 kurz träumten
ОглавлениеDas Schicksalsjahr begann euphorisch. Die Griechen lernten gerade, wieder zu lächeln, schrieb eine Kollegin vom Guardian. Bisschen kitschig, dachte ich, aber als ich wenig später in Athen ankam, verstand ich, was sie meinte.
Die Läden standen zwar leer wie zuvor, die Stadt war immer noch kaputt und verwahrlost, nachts glich das Zentrum einem Obdachlosenlager. Aber der Blick in den Gesichtern hatte sich verändert. Die Starre war weg. Die Apathie. Wenn es so etwas gibt wie ein allgemeines Gefühl, das über einer Stadt liegt, dann war es damals, im Februar 2015, in Athen eine Aufbruchsstimmung.
Es waren die ersten Wochen nach dem Sieg von Alexis Tsipras. 37 Prozent der Stimmen hatte Syriza bei der Parlamentswahl Ende Januar gewonnen und war damit die stärkste Kraft; mittlerweile stand die Partei in den Umfragen sogar bei 47 Prozent. Tsipras, der neue Premierminister, war noch beliebter: Drei Viertel der Griechen standen laut den Demoskopen hinter ihm.
So begann es: mit Sympathie. Um die Syriza-Abgeordneten gab es eine Ekstase. Für viele von ihnen war es das erste politische Amt, es waren Leute aus der Athener Mittelschicht, die morgens mit der Metro ins Parlament fuhren. Saßen sie abends in der Taverne, kamen Menschen zu ihnen und machten ihnen Mut.
Wenn der neue Finanzminister, Yanis Varoufakis, ein Professor und Blogger, von seinem Büro zu Fuß über den Syntagma-Platz hinüber zum Amtssitz des Premierministers ging, bedrängten ihn nicht nur Journalisten und Fotografen, sondern auch normale Bürger. Sie sprachen mit ihm, als wäre er ein Freund. Zeig es ihnen, Yanis, rief einer. Gemeint waren die Gläubiger der Troika, mit denen Varoufakis in Brüssel verhandelte, vor allem aber: die Deutschen mit ihrem Spardiktat. Es war, als würde da gerade ein Boxkämpfer durchs Publikum zum Ring laufen. Und wenn Varoufakis später nach den Verhandlungen in Brüssel vor die Presse trat, schaute das ganze Land zu: Wie war es gelaufen?
Nichts hatte die Wahl verändert am Leid der Griechen. Es war noch zu früh. Doch in diesen Februartagen glaubten die Griechen, dass ihr neuer Premier seine Versprechen würde halten können, unterstützt von Varoufakis. Die beiden würden der Troika schon Zugeständnisse abringen. Etwas würde sich ändern.
Ja, Tsipras und Varoufakis, die beiden griechischen Helden, machten den Troika-Vertretern tatsächlich Sorgen. Jeder konnte spüren, wie verdammt ernst sie es meinten, sie waren laut genug. Mit diesen Griechen zu verhandeln würde kein Vergnügen werden. Sie brachten die Sprache des griechischen Volkes in die Konferenzräume in Brüssel, eine deutliche, drastische Sprache, und genau das war es, was die Griechen an ihrer neuen Regierung mochten. Zum ersten Mal seit Beginn der Krise fühlten sich die Griechen wirklich vertreten.
So begann es: mit Erwartung.
Doch warum hatte Tsipras diesmal gewonnen und nicht schon 2012? In den vergangenen Monaten war es in Griechenland ruhig gewesen. Von einer langsamen Erholung war die Rede, die Wirtschaft war im Jahr zuvor gewachsen, wenn auch nur um 0,7 Prozent. Warum also war den griechischen Wählern gerade jetzt nach dem Bruch, nach einem Aufstand? Warum wählten sie das Wagnis statt Stabilität?
Mit Nikos, einem Fotografen, der aus Korfu stammt, aber seit fast 30 Jahren in Athen lebt, zog ich los. Unser Programm: Ursachenforschung. Wir besuchten Dimitris Koumanias, einen freundlichen Mann Ende 50. In seiner Wohnung hatte er erst seit Kurzem wieder Strom und fließend Wasser. Sie war vollgestellt mit alten Fotos, einige zeigten ihn im Jackett an einem Hotelpool. Es war sein altes Leben, sein Vorkrisenleben, das in sich zusammengefallen war, als wäre es nur eine Fassade gewesen, die er sich selbst aufgebaut hatte. Heute trug Koumanias eine Trainingsjacke, setzte sich aufs Sofa und erzählte uns seine Geschichte, die auch davon handelte, wie schnell man aus der griechischen Mittelschicht abstürzen konnte.
Koumanias hatte jahrzehntelang im Tourismus gearbeitet, hatte auf den Inseln Hotels geleitet. Die Kündigung kam 2012. Seine Frau ging damals in Rente, sie bekam fortan 350 Euro im Monat. Dimitris bekam bezog ein Jahr lang Arbeitslosengeld, 360 Euro. Ihr Sohn verlor seinen Job, zog wieder bei ihnen ein.
Soweit die Einschläge der Krise. Koumanias hielt sich beim Erzählen nicht lange mit ihnen auf, fast jede griechische Familie erlebte Ähnliches. Das erste Jahr bekamen sie irgendwie rum, sie schränkten sich ein, so gut es ging. Nur: Für Dimitris ergab sich kein neuer Job, das Arbeitslosengeld lief aus. Sozialhilfe gab es in Griechenland nicht. Von nun an lebten sie von der Rente seiner Frau; dass sie damit nicht hinkommen würden, war klar. Sie mussten jetzt Entscheidungen treffen, bei denen es um Würde ging. Oder um ihren Verlust.
Waren es Entscheidungen? Hatten sie überhaupt eine Wahl? Sie hörten auf, die Rechnungen zu zahlen. Strom, Wasser. Im Winter die Heizung. Ein paar Monate und Mahnungen später kam kein Wasser mehr aus dem Hahn, die Wohnung blieb dunkel. Sie kauften Kerzen. Wasser holten sie sich von den Toiletten umliegender Cafés. Ihr Auto konnten sie nicht mehr betanken; sie hätten es ohnehin nicht bewegen dürfen, weil sie bald auch die Kfz-Steuer schuldeten.
Immerhin, die Wohnung gehörte ihnen. Wie die meisten Griechen waren sie Eigentümer. Doch der griechische Staat hatte auf der Suche nach Geldquellen eine Immobiliensteuer eingeführt, die Enfia, fällig jedes Jahr im September. Über die Wohnungen und Häuser, dachte die Regierung wohl, würde sie die Leute kriegen, eine Immobilie konnte niemand verstecken.
Es sei denn, jemand war zahlungsunfähig. Als wir Dimitris Koumanias besuchten, betrug die Summe, die er dem Staat schuldete, 11 000 Euro. Steuerschuld war eine Straftat, theoretisch hätte Koumanias verhaftet werden können. Wovor er sich aber wirklich fürchtete, war die Enteignung. Der Staat hätte die Wohnung pfänden können, wie es in anderen Fällen schon geschehen war. Obdachlosigkeit war für Dimitris Koumanias und seine Familie nun eine konkrete Sorge. Aus der Mittelschicht waren sie in kaum mehr als zwei Jahren nach ganz unten gefallen, niemand hielt sie auf, niemand half.
Worum ging es Koumanias, als er Tsipras wählte? Es war nicht der Jobverlust, Krisen passieren in jedem Land. Koumanias ging es darum, dass der Staat ihn, der unverschuldet in Not geraten war, wie einen Verbrecher behandelte.
Der Bürger Koumanias wusste sich nur noch mit verbotenen Mitteln zu helfen. Er wählte die Nummer von Den Plirono, einer Gruppe von Aktivisten. Die hatten eine Hotline eingerichtet, bei der man anrufen konnte, wenn einem Strom und Wasser abgestellt worden waren. Noch am selben Tag kam ein Techniker bei Koumanias vorbei und verband die Familie wieder mit dem Netz. Das Licht ging an, das Wasser floss wieder. Sie konnten duschen, kochen und so tun, als wäre alles beim Alten, als wären sie wieder Menschen.
Doch Koumanias wusste: Die neue Normalität war keine. Was sie getan hatten, war ziviler Ungehorsam. Aus offizieller Sicht war er nun ein Dieb. Irgendwann würde die Stromgesellschaft die Versorgung ein zweites Mal abstellen. Würde dann die Polizei vor der Tür stehen? Unwahrscheinlich, es gab viel zu viele Fälle wie seinen. Für den Staat war Koumanias ein Straftäter, doch es fehlten ihm die Mittel, ihn zu verfolgen.
»Ich will das nicht«, sagte Koumanias. »Ich will Steuern zahlen. Ich will meine Rechnungen zahlen.«
Wegen der Schulden traute er sich auf kein Amt mehr, er ging dem Staat aus dem Weg. Er war unfrei geworden. Er hatte seinen Status als Bürger verloren. Diese Kränkung gab es in Griechenland millionenfach. Die einen verloren nur einen Teil ihres Gehalts, anderen, wie Koumanias, brach ihr ganzes Leben weg. Und auf einmal lebten sie in der Illegalität.
Den Kontakt zu Koumanias hatten uns die Leute von Den Plirono vermittelt, was auf Deutsch »Ich zahle nicht« heißt. Am Abend trafen wir im Büro der Gruppe auf Leonidas Papadopoulos, einen jungen Arzt, der seine Freizeit zuletzt häufig vor Gerichtsgebäuden oder Autobahnmautstellen verbracht hatte. Wenn man ihm zuhörte, klang es, als wäre in Griechenland bis dahin ein autoritäres Regime an der Macht gewesen. Nun, unter Alexis Tsipras, wirkte Papadopoulos wie befreit.
Immer mittwochs demonstrierten die Mitglieder der Gruppe mit anderen vor den Gerichten, weil dann die Enteignungsverfahren stattfanden. Sie machten sich aber auch selbst strafbar, zum Beispiel, indem sie Menschen wie Koumanias halfen. Aber auch, wenn sie eine Mautstelle blockierten, weil sie nicht einsahen, dass eine Fahrt von Athen nach Thessaloniki über 35 Euro an Gebühren kosten sollte. Die griechischen Autobahnen seien viel zu teuer gebaut worden, sagte Papadopoulos, »dreimal so teuer wie nötig«, der Korruption wegen. Die Strecke zum Athener Flughafen galt als teuerster Autobahnbau Europas.
Papadopoulos berichtete von einem früheren Finanzminister: Der habe sein Einkommen während der Krise nach und nach auf ein ausländisches Konto transferiert. »Der Finanzminister!«, rief er. Für die Krise habe währenddessen die Gesellschaft bezahlen müssen. Das war die Ungerechtigkeit, gegen die Den Plirono antrat. Die Mehrwertsteuer war immer weiter gestiegen, auch für Lebensmittel, heute beträgt sie 24 Prozent; die Stromsteuer stieg um fast die Hälfte, zur Einkommenssteuer kam jetzt noch ein Solidaritätsbeitrag dazu. Währenddessen sanken Gehälter und Renten dramatisch. Der griechische Staat hielt sich an die Vorgaben der Troika, sanierte den Haushalt, die Menschen litten.
In dieser Zeit, vor dem Syriza-Wahlsieg, bekam auch Dimitris Koumanias die Nachrichten mit. Er sah einen Premierminister, Tsipras’ Vorgänger, der sich über die erreichten Sparziele freute. Gläubiger, die zufrieden waren, aber zu weiteren Kürzungen mahnten. Koumanias kannte niemanden, der zufrieden war. Es waren die Jahre der Apathie. Die Leute von Den Plirono gehörten zu den wenigen, die noch protestierten. Das Land hatte sich aufgegeben.
Als Tsipras im Dezember 2014 schließlich Neuwahlen erzwang, war es, als hätte er eine Tür aufgestoßen. Die Griechen hatten die Alternativlosigkeit die vergangenen Jahre über still ertragen, das ewige Sparen. Dimitris Koumanias ging es um einen Ausweg, wie auch immer der aussehen würde. In Alexis Tsipras sah er ihn.
Tsipras war anders. Schon im Stil: keine Krawatten, keine diplomatischen Floskeln, auch als Premierminister blieb er anfangs der Kämpfer, der Scharfmacher. Dazu seine Koalition: ein Links-Rechts-Zweckbündnis mit Anel, einer nationalkonservativen Abspaltung der Nea Dimokratia. Syriza und Anel waren sich völlig fremd, sie verband nur, dass beide die Sparpolitik ablehnten. Dafür sollte das Bündnis erstaunlich lange halten.
Yanis Varoufakis war erst kurz vorher aus Texas zurückgekehrt, wo er an einer Uni Wirtschaft gelehrt hatte, jetzt fuhr er oft auf dem Motorrad am Ministerium vor. Neben ihm im Kabinett saßen radikalere Linke, aber auch Pragmatiker; viele Quereinsteiger, zum Beispiel ein Staatsanwalt, der früher in Steuerhinterziehungsfällen ermittelt hatte und das Thema jetzt als Minister betreute.
Der Mann, der sich um die Reform des Staatsapparats kümmern sollte, hieß Giorgos Katrougalos. Auch er ein ehemaliger Professor, aber Jurist, an einer Kanzlei beteiligt und bis kurz zuvor nicht an einer politischen Karriere interessiert. Syriza schickte ihn erst als Europaabgeordneten nach Straßburg; nach dem Wahlsieg machte die Partei ihn zum stellvertretenden Innenminister, zuständig für die Reform des öffentlichen Diensts.
Wir trafen ihn in einem jener Athener Bürogebäude aus den 60ern, in denen man glaubt, am Set der Serie Mad Men gelandet zu sein. Unten am Eingang stand: Ministry for Administrative Reform and E-Government. Katrougalos empfing uns in seinem Büro im obersten Stock, von dem aus er über die Stadt schauen konnte. Ein leicht ergrauter, freundlicher Mann, damals 52 Jahre alt. Das Einstecktuch passte zur Krawatte, seine ganze Erscheinung war elegant. Man merkte, dass er neu in der Politik war, er sprach so smart und unterhaltsam, wie Studenten es bei ihren Professoren mögen. Einer jener Menschen, die ihre intellektuelle Überlegenheit nie zu Arroganz haben verkommen lassen.
Dort unten lag die Stadt der Krise, über dem Gebirge ging langsam die Sonne unter. Was er selbst von der Krise mitbekommen habe? Katrougalos erzählte von seiner Frau, einer Lehrerin. Ihre Schule liege in einem schwierigen Stadtteil von Piräus. Sie habe erlebt, dass Schüler im Unterricht ohnmächtig wurden, weil sie ohne Frühstück gekommen waren. Er selbst zähle natürlich zu den Glücklichen, fügte er gleich hinzu, zu den Privilegierten. Aber auch er habe Freunde, die arbeitslos geworden waren, und er mache sich Sorgen um seine Kinder. »Niemand hier hat die Krise nicht mitbekommen«, sagte er.
In einem kurzen Vortrag referierte er darüber, was sein Auftrag war. Kurz: Die griechische Verwaltung ins 21. Jahrhundert zu überführen, und das in dieser kurzatmigen Zeit. Katrougalos war für das zuständig, was in deutschen Talkshows regelmäßig gefordert wurde: für die Strukturreformen. Oder mit einem anderen Talkshow-Wort: für die Hausaufgaben.
Katrougalos schien zu wissen, wovon er sprach. Er führte sein Ministerium, eigentlich eine Abteilung des Innenministeriums, wie ein Projektmanager. Seine Beamten waren bisher vor allem dafür zuständig gewesen, den öffentlichen Dienst zu verkleinern. Sie waren froh, dass die neue Regierung keine neuen Kürzungen plante, auch wenn es natürlich weiterhin um Umstrukturierungen ging, um schnellere Prozesse, um mehr Flexibilität.
Über die größere politische Lage sprach Katrougalos weniger gern als über seine Aufgabe. Seltsam für einen Minister, dachte ich, andererseits: Vielleicht brauchte es ja jetzt gerade Leute wie ihn. Fachpolitiker, die sich in ihr Ministerium einarbeiten. Genau daran hatte es Griechenland lange gefehlt.
Ob er an eine Einigung mit den Gläubigern glaube? »Es muss sie geben«, sagte er. »Ich glaube fest an die Vernunft.« Vielleicht war das nur eine Floskel. Oder Katrougalos konnte sich wirklich nicht vorstellen, dass sich dieses Problem nicht lösen ließ. Er kam aus der akademischen Welt, für ihn folgte auf die Problemstellung eine Analyse, gefolgt von Lösungsvorschlägen.
Gerade ein paar Wochen war er im Amt. Wir beschlossen, ihn zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu treffen. Wie würde er sich als Minister machen, wie regierte er? Und was sagte uns das über die griechische Regierung, die »Amateure«, wie sie ein deutsches Magazin genannt hatte?
Von heute aus gesehen hatten sie keine Chance. Tsipras musste enttäuschen. Es dauerte nicht mal lang. Die Zeit drängte, das Land brauchte, wie sich herausstellte, dringend neue Kredite. Mal wieder. Die Gläubiger verlangten dafür, wie es üblich geworden war, neue Maßnahmen: Kürzungen also, Steuererhöhungen, Privatisierungen.
Gegen genau dieses Prinzip war Syriza angetreten. In Brüssel versuchte Varoufakis, den Finanzministern der Eurogruppe zu erklären, wie falsch die Logik des Sparens gegen neue Kredite war. Je mehr Griechenland sparte, desto mehr würde die Wirtschaft schrumpfen. Und je länger die Krise dauerte, desto mehr neue Kredite würde das Land brauchen. Aber die Minister hatten wenig Lust, sich von Varoufakis belehren zu lassen. Am 20. Februar gaben sie ihm vier Monate Zeit für einen detaillierten Maßnahmenkatalog. Varoufakis willigte ein. Im Grunde hatte er sich damit schon ihrem Prinzip unterworfen.
Zwei Monate vergingen, bis Giorgos Katrougalos, der bis dahin eher unbekannte Reformer, auf einmal in die Schlagzeilen geriet. Auch in Deutschland: Die Bild-Zeitung machte ausgerechnet an ihm den ersten »Korruptionsskandal« der neuen Regierung fest.
Was war passiert? Katrougalos’ Anwaltskanzlei hatte vor einer Weile das Mandat entlassener Beamter angenommen, die auf Wiedereinstellung klagten. Im Erfolgsfall würde die Kanzlei dafür ein Honorar bekommen. Syriza hatte im Wahlkampf versprochen, nicht erst auf ein Urteil zu warten, die Entlassenen sollten sofort zurückkehren dürfen. Und zuständig dafür, das Versprechen umzusetzen, war nun Katrougalos. Er persönlich hatte die Beamten zwar nie vertreten, seine Beteiligung an der Kanzlei ruhte. Möglicherweise hätte er aber später an dem Fall verdienen können, wenn er in die Kanzlei zurückgekehrt wäre.
Der Minister Katrougalos entschied zugunsten der Mandanten des Anwalts Katrougalos. Ein Interessenskonflikt, wenn auch ein eher harmloser, verglichen mit früheren Skandalen der griechischen Politik. Aber Katrougalos hätte ahnen können, dass die Geschichte auf ihn zukommt. Die Korruptionsvorwürfe schockierten ihn, noch in der Nacht gab er ein Interview: »Wäre das wahr, müsste ich mich umbringen.« Niemals werde er auch nur einen Cent von dem Geld annehmen.
Einige Tage später besuchten wir ihn. Es war morgens, Katrougalos saß am Schreibtisch, vor sich einen Take-Away-Kaffee, und wirkte nicht besonders besorgt. Dass etwas von dem Fall hängenbleiben würde, war ihm klar. Aber er lasse sich davon nicht ablenken, sagte er, es sei »eine Schmierenkampagne«, ein Versuch des »Klüngels der Medienmogule«, ihn zu diskreditieren. Was ihn mehr beschäftige, sei die Debatte um das griechische Problem. Man erwarte jetzt schon von ihm Ergebnisse, nach kaum drei Monaten im Amt. Er frage sich, wie das gehen solle.
Im Ausland erwarteten viele schon gar nichts mehr. In deutschen Talkshows hieß es nun häufig, auch Syriza habe nicht geliefert, oft ergänzt um die Feststellung, in Griechenland werde sich eben nie etwas ändern. Der Journalist Michalis Pantelouris rechnete dagegen vor, dass das griechische Parlament bis 2014 insgesamt 179 Reformgesetze verabschiedet hatte, gerade bei der Digitalisierung ging es voran. Es schien, als könnten die Griechen den Deutschen gar nicht genug reformieren. Und als kämen Fakten in dieser Debatte schlicht nicht mehr an gegen Meinungen.
Glaubte Katrougalos immer noch an eine Einigung mit den Gläubigern, an einen Deal? »An einen ehrenhaften Kompromiss«, sagte er. »Einen Konflikt kann doch niemand wollen. Ein Kompromiss wäre für uns alle eine Win-Win-Situation.« Trotzdem musste er seine Beamten jetzt auch auf den Notfall vorbereiten: auf einen möglichen Grexit. Im Kabinett ging es weniger um Reformen als um Sparvorschläge, die Varoufakis mit nach Brüssel nehmen konnte. Es war nicht das, wofür der Professor in die Politik gegangen war. Und Syriza hatte dafür nicht die Wahl gewonnen.
Es wurde Frühling in Athen, es wurde Sommer, die Euphorie verflog. In den Umfragen verlor Tsipras an Sympathie, die Menschen wurden nervös. Niemand wusste, wohin das Land steuerte. Nur dass der Staat, falls es keinen Deal gab, im Sommer bankrott sein würde. Eine Entscheidung stand an.