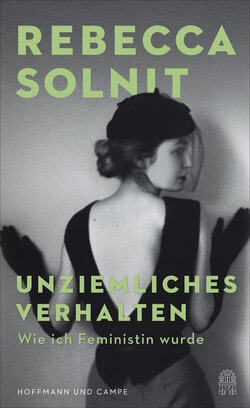Читать книгу Unziemliches Verhalten - Rebecca Solnit - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеManchmal wird ein Geschenk gemacht, und weder Schenker*in noch Beschenkte*r erkennen seine wahre Tragweite, es entpuppt sich letztlich als etwas anderes als das, was es zunächst zu sein scheint. Wie vor jedem Anfang ein anderer Anfang liegt, so liegt auch hinter jedem Ende ein weiteres Ende, eines überlagert das andere, und die Auswirkungen breiten sich in kleinen Wellen aus. Eines Wintersonntags, als ich noch jung, unwissend, mittellos und fast ohne Freund*innen war, machte ich mich auf den Weg zu einer Wohnungsbesichtigung. Ich hatte das Angebot unter den Suchanzeigen in der Zeitung gefunden, ein paar winzige Zeilen der Information in diesem dichten grauen Raster, in dem hauptsächlich Wohnungen beschrieben wurden, die ich mir nicht leisten konnte. Man hatte mich ausgelacht, als ich verkündete, dass ich eine Wohnung für zweihundert Dollar im Monat suchte, was selbst damals extrem wenig war, aber mehr konnte ich als junge Studentin – im dritten Jahr meiner finanziellen Unabhängigkeit – nicht aufbringen.
Als ich auf Wohnungssuche ging, wohnte ich in einem winzigen Zimmer mit Fenster zum Lichtschacht, das insofern luxuriös war, als es über ein eigenes Badezimmer verfügte – in einer Pension für Dauergäste, deren übrige Zimmer nur Etagenbäder hatten. Für das gesamte Gebäude gab es eine einzige, schlecht beleuchtete Gemeinschaftsküche, wo einem das Essen entweder aus dem Kühlschrank gestohlen wurde oder die Kakerlaken sich darüber hermachten oder beides. Die anderen Bewohner waren Leute, die ihr Leben irgendwie nicht aufs richtige Gleis gebracht hatten. Ich war neunzehn und hatte mein Leben noch auf gar kein Gleis gebracht, hatte gerade erst damit begonnen mich zu fragen, wer ich werden wollte und wie das zu bewerkstelligen wäre, die übliche Herausforderung in diesem Alter. (Ich hatte mit fünfzehn die Highschool abgeschlossen, war mit sechzehn ans Community College gegangen und dann nach einem Jahr an die Uni gewechselt; mit neunzehn war ich im letzten Studienjahr an der San Francisco State University, dem Arbeiter-College im windigen Südwesten der Stadt.)
Ich stieg an der City Hall in den 5-Fulton-Bus ein und fuhr an den Blocks mit Sozialwohnungen vorbei, an einer Kirche in der Fillmore Street, wo eine Gruppe ernst dreinblickender Schwarzer in Anzügen sich zu einer Beerdigung versammelt hatte, an reichverzierten alten Holzhäusern und kleinen Spirituosenläden, dann ging es den Hügel hinauf zur Lyon Street, wo ich ausstieg, während der Bus Richtung Pazifik weiterrumpelte. Ich fand das Haus, ein Gebäude mit zurückgesetzter Eingangstür, die wie viele andere in der Gegend durch ein schmiedeeisernes Tor zusätzlich gesichert wurde. Die Fußmatte im Innern war mit einer rostigen Kette am Briefkastenschlitz angeschlossen. Ich klingelte beim Hausmeister und stapfte, nachdem er mich eingelassen hatte, in den ersten Stock hoch, wo er mich vor seiner eigenen Wohnungstür erwartete und gleich in den zweiten Stock weiterschickte, damit ich mir die Einzimmerwohnung über seiner ansah.
Ihre Schönheit erstaunte mich. Eine Eckwohnung, deren Hauptzimmer zwei Erkerfenster hatte, eins nach Süden und eins nach Westen, durch die das Licht hereinflutete. Goldene Eichenholzböden, hohe Decken mit abgerundeten Ecken, weiße Kassettenwände. Verglaste Türen mit Kristallknauf. In der separaten Küche ein weiteres Ostfenster, durch das die Morgensonne hereinleuchten würde, sobald sie über das große Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestiegen war. Die Wohnung war strahlend hell, schien nicht von dieser Welt, einem Märchen entnommen, riesengroß und exquisit im Vergleich zu den spartanischen Einzelzimmern, in denen ich, seit ich mit siebzehn von zu Hause ausgezogen war, größtenteils gewohnt hatte. Ich spazierte eine Weile darin herum, dann ging ich wieder hinunter und sagte dem Hausmeister, dass ich die Wohnung haben wollte. Er sagte freundlich: »Wenn Sie sie haben wollen, dann sollten Sie sie auch kriegen.« Ich wollte sie unbedingt, sie war schöner als alles, was ich mir erträumt hatte, allein in ihr zu stehen kam mir schon vor wie ein Traum.
Er war ein stattlicher Schwarzer, um die sechzig, hochgewachsen, stämmig, unverkennbar früher einmal sehr gutaussehend und auch jetzt noch eine beeindruckende Gestalt mit einer tiefen, polternden Stimme, und wenn er an diesem Tag so gekleidet war wie fast immer, dann trug er wohl eine Latzhose. Er bat mich in sein Wohnzimmer. An diesem Super Bowl Sunday, an dem eine örtliche Football-Mannschaft im Finale spielte und aus den Häusern ringsum bei jedem Punktgewinn tosender Jubel aufstieg, sah er im Fernsehen schwarzen Männern beim Blues-Spielen zu; das große Gerät stand auf einem eigenen Tischchen neben dem sechseckigen, mit grünem Filz bezogenen Pokertisch, und das Nachmittagslicht wurde durch die breiten Lamellen der altmodischen Jalousien an seinen Erkerfenstern gefiltert. Als er mir den Bewerbungsbogen reichte, wurde mir schwer ums Herz. Ich sagte ihm, die Miethai-Immobilienverwaltung, deren Name oben auf dem Formular stand, habe mich schon abgelehnt. Einer der Angestellten hatte meine Bewerbung vor meinen Augen verächtlich in den Papierkorb neben seinem Schreibtisch fallen lassen – ich verdiente nicht genug Geld für ihre Mindestanforderungen.
Der Hausmeister sagte, wenn ich eine seriöse ältere Frau dazu bewegen könnte, den Mietvertrag für mich zu unterzeichnen, würde er dieses Täuschungsmanöver decken. Ich nahm sein Angebot an und fragte meine Mutter, die es schon öfter abgelehnt hatte, irgendein Risiko für mich einzugehen. Diesmal jedoch ließ sie sich darauf ein und unterschrieb das Formular. Der Immobilienverwaltung kam es nicht komisch vor, dass eine weiße Hausbesitzerin, die auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge wohnte, diese Wohnung haben wollte – ich glaube, sie schrieb, sie wolle näher bei ihrer Arbeit sein, denn sie machte bei einer Künstleragentur die Buchhaltung. Wahrscheinlich bekam sie den Zuschlag ganz automatisch, weil sie für diese kleine Wohnung in einem schwarzen Viertel die finanzkräftigste Bewerberin war.
Acht Jahre lang bezahlte ich meine Miete jeden Monat, indem ich das Geld bar anwies und das Formular mit dem Namen meiner Mutter unterschrieb. Im Mietvertrag stand, dass Unterzeichner*in und Mieter*in identisch sein mussten, sodass ich in meiner Wohnung, die offiziell gar nicht meine war, offiziell nicht existierte. Obwohl ich dann letztlich so viele Jahre dort lebte, hatte ich lange das Gefühl, ich könnte jederzeit rausgeschmissen werden und müsste mich deshalb möglichst unsichtbar machen, was meine in der Kindheit entwickelte Neigung zur Verstohlenheit, mein Bestreben, unbemerkt zu bleiben, noch verstärkte. Irgendwann fand die Hausverwaltung heraus, dass Unterzeichnerin und Mieterin nicht identisch waren, und fragte beim Hausmeister nach, was das zu bedeuten habe. Er verbürgte sich dafür, dass ich eine ruhige, verantwortungsvolle Mieterin sei, und es geschah nichts weiter, trotzdem hatte ich nach wie vor ein unsicheres Gefühl.
James V. Young hieß der Hausmeister. Ich nannte ihn immer Mr. Young. Irgendwann erwähnte er mal, dass ich seit siebzehn Jahren die erste weiße Person sei, die in diesem Haus wohne. Die anderen Bewohner waren größtenteils ältere Ehepaare, doch es gab auch eine alleinerziehende Mutter mit ihrer freundlichen Tochter, die in einer der anderen Einzimmerwohnungen in diesem Gebäude wohnte; insgesamt verteilten sich auf die zwei Stockwerke über einem aus Garagen bestehenden Erdgeschoss sieben vom Treppenhaus aus zugängliche Wohnungen. Dass ich in ein schwarzes Viertel gezogen war, hatte ich noch nicht so recht begriffen; es würde mich in den folgenden Jahren vieles lehren, und ich blieb so lange dort wohnen, dass ich, als ich schließlich auszog, eine von der weißen Mittelschicht bewohnte Gegend verließ, in der die Gebäude bis auf einen frischen Anstrich größtenteils unverändert waren, alles andere sich jedoch gewandelt hatte und etwas Wesentliches, sehr Lebendiges verlorengegangen war.
Auch ich hatte mich verändert; die Person, die im einundzwanzigsten Jahrhundert dort auszog, war nicht mehr die Person, die all die Jahre zuvor eingezogen war. Natürlich gibt es eine gewisse Kontinuität. Aus dem Kind ist die Frau hervorgegangen, aber seither ist so viel geschehen, hat sich so viel verändert, dass ich an diese spindeldürre, angestrengt bemühte junge Frau denke wie an eine, die ich einmal sehr gut kannte, für die ich gern mehr getan hätte, mit der ich mitfühle, so wie ich mit den Frauen ihres Alters, denen ich heute begegne, oft mitfühle; diese Person damals war nicht ganz ich, war in entscheidenden Bereichen sogar völlig anders, und doch war ich sie: eine linkische Außenseiterin, eine Tagträumerin, eine ruhelose Wanderin.