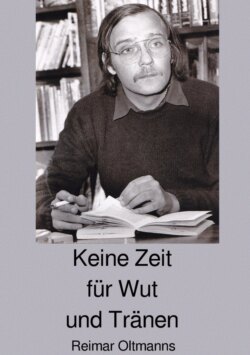Читать книгу Keine Zeit für Wut und Tränen - Reimar Oltmanns - Страница 11
Im Heim zu Osnabrück – Lazarett der Kinder – Sex und Prügel in Verlassenheit
ОглавлениеAusholen ist so gut wie geschlagen
Sprichwort aus Afrika
Meine neue Heimstatt war ein H-förmiger Betonkasten mit 98 Fenstern in der Größe eines Fußballplatzes. Sie lag draußen an der Stadt-Peripherie von Osnabrück der Landstraße zum Vorort Sutthausen, eingezäunt zwischen Wald und Acker. Weit und breit nur Wiesen, Lehm Wege. Einsamkeit. Es war ein auch nachts beleuchtetes Getto, aus dem es eigentlich kein Entkommen, kein Abhauen gab. Eigentlich.
Dorthin hatte Mutter Jutta ihren Sohn Reimar im Rahmen der „freiwilligen Jugendhilfe“ in ein evangelisches Jugendheim abgeschoben, abgestellt, außer Sichtweite gebracht. Im Haus Neuer Kamp in Osnabrück arbeiteten etwa zwanzig Erzieher oder auch Erzieherinnen. Während ihrer Arbeitszeit schlossen sie durchschnittlich mit 64 Einzelschlüsseln Räume auf und wieder zu, öffneten mit dem Vierkantschlüssel verriegelte Toiletten-Türen. Wer aufs Klo musste, der hatte zunächst nach Klopapier zu fragen – und das Tag für Tag, Nacht für Nacht, Monat für Monat, Jahr für Jahr. – Kinder-Gefängnis.
Schon einen Tag nach meiner Ankunft hatte ich auf einer Zehn-Pfennig-Postkarte mit dem Konterfei des Malers Albrecht Dürer (*1571+1628) den „lieben Eltern“ einen vorgefertigten Satz zu schreiben: „… mir gefällt es hier sehr. Schade, dass ich erst so spät hier angekommen bin.“ Es waren von Erziehern vorformulierte Phrasen. Je positiver Heim und Leute im kindlichen Darstellungsvermögen geschildert wurden, desto entspannter und erträglicher verlief der Heimalltag. Kinder hatten ihre Gefühle und Befindlichkeiten abzurichten; Opportunität als Sozialisations-Mosaik erlernbar machen.
Die sogenannte Heimerziehung war das „letzte Mittel“, der Notnagel in zerrütteten Familien vielerorts. Sie wurde im Wesentlichen im Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt. Dieser Paragraph sah vor, Kinder und Jugendliche außerhalb des Elternhauses extern Tag und Nacht pädagogisch zu beobachten, zu erziehen, anzuleiten, abzurichten – freiwillig. Die Kosten für derlei außerhäuslicher Unterbringung, freiwillige Erziehungsbeihilfe genannt, trug der Staat. In meinem Fall hatte der Stiefvater lediglich monatlich 35 Mark Kindergeld für den Heimaufenthalt abzuführen.
Ihren Ursprung hatte die Heimerziehung in Deutschland in der Armenfürsorge im Mittelalter. Dort wurden Alte, Kranke und geistig Verwirrte versorgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) wurden Waisenhäuser gegründet; aus der Armenfürsorge entwickelten sich zunehmend Kinderheime, Fürsorgeerziehungsanstalten unter Bedingungen des Strafvollzugs.
Die Heimleiterin vom Haus Neuer Kamp zu Osnabrück, Frau Gertrud Berling (*1919+2009), eine Psychagogin, winkte mir vom Balkon des ersten Stockwerks im Verwaltungsgebäudes bei meiner Ankunft zu. Hier stand sie oft, verbrachte Stunden mit dem Fernglas vor ihren Pupillen. Von hier aus hatte sie den gesamten Gebäudekomplex unter Kontrolle, konnte blitzschnell wegrennende, herumstreunende Heimkinder wie Karnickel auf den Feldern ausmachen, aufscheuchen und als Strafe mit einem dreimonatigen Stubenarrest belegen. Fernglas hin, Feldstecher her, es trippelten viele Kids aus dem evangelischen Kinder- und Jugendheim; meist des Nachts über die Blitzableiter. Zu viele. Nach Rückkehr drakonische Strafen; Prügel, Gebrüll, Prügel, Gebrüll, Stubenarrest, Sonderarbeiten. Gespenstisch dieser Exodus junger Menschen.
Mein Heim-Kumpel Stefan, ein Zimmer-Genosse, war solch ein Ausreißer vom Dienst, ein Trippelbruder, ein Blitzableiter-Spezialist, über die er fast jede Nacht in Windeseile seine Freiheit suchte und einstweilen auch fand. Stefans Heimleben war von Phlegma oder auch Abwesenheit gekennzeichnet. Er redete auch nicht viel, lachte wenig. Apathisch. Scheidungskind, Trennungsschock. Seine tiefliegenden Augen, seine Blässe signalisierten Desinteresse – tagsüber. Nachts zog es ihn potz Blitz zum Blitzableiter, der ihn aus dem zweiten Stock auf die Erde brachte. Hannover war sein Ziel. Immer wieder Hannover an der Leine. Dort lebte seine Mutter frisch verliebt und verheiratet mit einem scheinbar erfolgreichen Architekten zusammen. Bungalow, Springbrunnen, Siegertyp.
Stefan konnte und wollte nicht verwinden, warum Mutter seinen Papa kurzerhand rausgeschmissen und ihn direkten Weges ins Heim gesteckt hatte. Ausgerechnet in diesen Beton-Bau mit seinen verschlungenen, düsteren Kellergängen, in dem es Samstag für Samstag Eintopf mit Steckrüben gab. Und ausgerechnet er, der Stefan, hatte aus dem feuchten, dunklen unterirdischen Geschoss diesen labbrigen Eintopf in großen, schweren Kübeln in die zweite Etage hoch zu schleppen. Da schwappte die Suppe schon mal über. Aber des Nachmittags an den Wochenenden waren ohnehin die Sauber-Mach-Dienste angesagt. Und an diesen Diensten kam Stefan mit seiner oft bekleckerten Schürze nicht vorbei.
Da musste er Flure fegen, wischen, Bohnerwachs dick auftragen und dann immer wieder wienern bis es glänzte. Galgenhumor, gequält lächelnd schaute er drein. Zu allem Überfluss war er zudem meist dazu auserkoren, auch abends die Sülzbrote aus dem Küchen-Keller zu holen. Die Extra-Portionen mit Aufschnitt Platten für die Erzieherinnen und einer verschlossenen Haube, die hatte er natürlich auch gleich mitzubringen. Da durften wir alle miterleben, zuschauen, wie sich unsere „Vorbilder“ abendlich mit Schinken, Spanferkel-Schnittchen ihre Mäuler stopften. Sie stopften sich ihre Mäuler und zeigten, gestikulierten mit ihrem Besteck auf die Anempfohlenen. Sie sollten endlich lernen, beim Essen „das Maul zu halten“ und den Arm zu heben. Sonst ginge es alsbald ohne mampfen ans Putzen. Heimjahre.
Er haute oft ab, dieser Stefan. Er wurde aber immer wieder ins Heim gebracht – von der Polizei. Nur eines Tages, da ward er nicht mehr gesehen. Verschwunden. Achselzucken. Stefan war am Autobahnkreuz Lotte in einen LKW gelaufen – sofort tot. Hier am Stadtrand zu Osnabrück sahen geschulte Polizisten-Blicke eigentlich sehr genau, welche Jugendliche zum Viertel gehören oder auch nicht – also aus dem Heim fortgelaufen waren. Es sind waren ahnungslose, entwurzelte Kinder, die sich im neudeutschen Sprachgebrauch „Off Road Kids“ nennen dürfen.
Es sind, damals wie heute, abgeschobene Heimkinder fernab von ihren desaströsen, zerrissenen Elternhäusern. Wo sich ihre Seelen wund gerieben, entblößt haben, ist Linderung oder auch die Aufarbeitung des Schadens langatmig, oft besonders schwierig. Sie irren und lungern Tage oder einige Wochen auf Boulevards naheliegender Städte umher, bevor sie wieder eingefangen werden. Allemal gilt, wer sich nicht anpasst, Widerworte gibt, plötzlich wieder ausreißt und auch sonst im Heim über die „Stränge schlägt“, der wird abgeschoben hinter Schloss und Riegel in eine geschlossene Unterbringung, ausgegrenzt hinter meterhohem Gemäuer. Das hatte mir meine Fürsorgerin Fräulein Helene Klaebig (*1917+2013) vom Jugendamt in Emden als Amtsvormund mit auf den Weg in meine Heim-Jahre gegeben, abschreckend versteht sich. Disziplin und ein bedingungsloser Gehorsam hießen nun einmal die Erziehungsideale dieser Jahre.
In der mit glänzendem Parkett ausgelegten Eingangshalle des Haus Neuer Kamp zu Osnabrück übergab mich bei Ankunft meine Mutter bereits wartenden Erzieherinnen. Sie verschwand. Wortlos. Es sollte wohl das erste Mal gewesen sein, dass mich in diesem erkalteten, arg fremd-bedrohlich wirkenden Heim-Foyer das Gefühl von Verlassenheit, Abgeschiedenheit, Hilflosigkeit, ja Verrat heimsuchte. Tränen und Bitterkeit.
Die einst als felsenfest apostrophierte Mutter-Kind-Bindung aus siebenjähriger Zweisamkeit zu Schöningen, ja das Ur-Vertrauen, hatte nunmehr ihr jähes, nicht mehr zu reparierendes Ende gefunden. Nur ich war und blieb kein Einzelfall, kein Einzelschicksal. An die 800.000 Kinder und Jugendliche wurden in den 50er und 60er Jahren ohne viel Aufhebens mehr oder weniger in Erziehungsanstalten oder auch Heimen weggesperrt – „entsorgt“.25 Die Anzahl der Heimzöglinge sank Ende der Neunziger des vergangenen Jahrhunderts immerhin auf 40.000 Kinder in der alten Bundesrepublik.26 Nur quantitative Größenordnungen sagen selten etwas für die gesellschaftliche Tragweite dieser seelischen Zerstörungskraft – in diesem Fall bei – Jugendlichen aus.
Das Haus Neuer Kamp nahm als Dauerkinderheim Jungen im Alter von 3 bis 15, Mädchen von 3 bis 18 Jahren auf und verfügte zur damaligen Zeit über eine Aufnahmekapazität von 100 Plätzen. Gewohnt wurde in kleinen Gruppen von zehn bis zwölf Kids gemeinsam mit einer Gruppenerzieherin in einer Etagenwohnung mit vier Schlaf-, einem Wohn-, Schularbeiten Zimmer, Teeküche sowie Toiletten, Wasch- und Duschräumen.
Wir Heimkinder mussten jeden Morgen vor Schulbeginn den Fußboden zu schrubben, Suppenkübel auf Stockwerke zu schleppen, Geschirr abzuwaschen, Betten zu bauen; nach dem Unterricht an den Nachmittagen in der Wäscherei oder auch in der Großküche zu helfen. Gelegentlich missfiel Aufpassern die Akkuratesse beim Putzen. Wieder wurde mal eben ein Eimer Wasser auf den Boden gekippt und laut getönt: „Jetzt wischt ihr noch mal, gefälligst ordentlich.“
Wenn wir uns aus dem Heim auf den Schulweg machten, wurden Zähne wie Fingernägel mit Argus-Augen bei der sogenannten Verabschiedung kontrolliert. Aufgestanden wurde des Morgens um 6 Uhr, die Schlafenszeit begann um 19.45 Uhr mit einem Liedchen des deutschen Komponisten Heinrich Leberecht August Mühling (*1786+1847), das da lautete: „Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.“ Heim-Humor.
Einmal wöchentlich gab es donnerstags ein Taschengeld von 50 Pfennig. Es war sogar möglich, an diesem Nachmittag die Sutthauser Straße in Gruppenformation mit einem Praktikanten, den wir „Feldwebel“ schimpften, entlang zu laufen. Ziel: Konsumladen. Begierde: Gummi-Bärchen. Eingehende oder auch geschriebene Briefe unterlagen der Heimzensur. Telefonate waren streng verboten. Freien Ausgang gab es nur mit Sondergenehmigung.
Für solch eine spezielle Erlaubnis sorgte Erwin, der Heimfriseur. Ihn durfte ich eine Zeit lang sogar in seiner Privatwohnung besuchen. Normalerweise kam Erwin alle vier Wochen, stutzte uns die Haare zu Mekki-Frisuren. Erwin war Mitte dreißig Jahre alt, von untersetzter, gedrungener Figur mit reichlicher Pomade im nach hinten gekämmten Haar, verheiratet, ein Kind. Sein Markenzeichen: Erwin lachte häufig verschmitzt über beide Backen, erzählte viele Witze zur Selbstunterhaltung sozusagen; anzügliche, schmutzige Bonmots über das weibliche Geschlecht.
Wir staunten mit offenen Mäulern jedes Mal erneut, aus welchen Klatschspalten Erwin all diese verschmitzten Ferkeleien nahm und dann auch noch in seinem Gedächtnis zum Weitererzählen einspeicherte. Wenn zufälligerweise eine ahnungslose Erzieherin an Erwins Frisiertisch vorbei huschte, dann deutete Erwin mit seiner Schere schmunzelnd auf diese junge Frau, bevor er seine schlüpfrigen Erzählungen über des „Fräuleins Unterhöschen“ fortsetzte. Lachen, Kichern. Erwin strahlte.
Pro Haarschnitt nahm er eine Mark. Der Preis war es, der ihm angesichts der vielen Köpfe eine Art „Sonderstellung“ im Heim zuwies. Zumindest gab es von der Heimleitung keinerlei Einwände, Erwin einmal zu Hause zu besuchen. Erwin wohnte am Rosenplatz in Osnabrück, an dem sinnigerweise nicht mal eine Knospe oder auch schmales Blumenbeet blühte. Beton.
Aus seiner Wohnungstür in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses drang ein miefiger Gestank von Alkohol und ranzigem Essen. Mülltüten bedeckten den verklebten Fußboden. Eine vergammelte Matratze schmückte den Wohnraum. Auf ihr lag ein junges Mädchen, das sich als „Frau Erwin“ vorstellte. Überall standen oder purzelten leere Schnapsflaschen herum – von Friseur Erwin war nichts zu sehen. Fehlanzeige. An diesem Morgen soll er beizeiten das Haus verlassen haben, um im nahe gelegenen Bad Iburg Internats-Köpfe zu scheren. Erwin – der Heimfriseur.
Meist an den Nachmittagen zum Wochenende durchstreiften Heimkinder in Reih und Glied angrenzende Wälder. Zum Picknick-Pfefferminz-Tee zählte gleichfalls die Mundorgel zum festen Repertoire. Jenes handliche Fahrten-Liederbuch im Hemdtaschenformat, aus dem die Kids ihre Volkslieder zu schmettern hatten; etwa „Jesus herrscht als König“ – „Gute Nacht Kameraden“ oder „Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord“ wie auch „Wildgänse rauschen durch die Nacht mit schrillem Schrei nach Norden“. So manche Melodie stammte damals noch aus der Nazi-Zeit. In Lied-Texten wurden auffallend viele „Neger“ und „Zigeuner“ besungen. Der Refrain duldete nur eine militaristische Variante.
Zur Erinnerung: Osnabrück ist ein geschichtsträchtiger Schauplatz des Westfälischen Friedens aus dem 17. Jahrhundert.27 Ein mahnender Ort. Nur in den fünfziger und sechziger Jahren der vergangenen Centesimo waren immer noch klackende Stiefel-Sturm-Schritte der Sieger-Soldaten dumpfe Alltagslaute. Überall klapperte das Schuhwerk in ehrwürdigen Altbau-Gassen mit seinem gediegenen Kopfsteinpflaster. Der Zeitgeist jener Jahre trug Uniform und Knobelbecher. Die Stadt beherbergte mit den in der British Forces Germany (BFG), erst als Besatzungsmacht, dann als NATO-Verbündeter, zeitweilig bis zu zehntausend Soldaten in ihrem Gemäuer; über 160 Hektar groß waren englische Militärflächen, die größte Basis der Britischen Armee im Ausland überhaupt – Osnabrück. Im Jahre 2009 zogen die Engländer ab. Stadtteile wie Dodesheide mit seinen großflächigen Parks wirkten wie leergefegt. An die 500 deutsche Zivilangestellte marschierten gleichfalls in die Arbeitslosigkeit. Verlassenheit.
Erklärte Maßgabe im Haus Neuer Kamp zu Osnabrück war es, Jugendlichen, die Schäden an ihrer Seele in Elternhäusern davongetragen hatten, durch stationäre heilpädagogische und psychotherapeutische Behandlung möglichst zu beseitigen. Alle Zöglinge besuchten öffentliche Schulen der Stadt Osnabrück. Das klang in seiner Außenwirkung modern, zukunftsorientiert und einfühlsam.
In seiner Innenwirkung hingegen wurden jedoch unbedacht die Konzepte aus der Zeit des Nationalsozialismus übernommen. Viele Heime existierten ja bereits und das Personal wurde weiter beschäftigt. Ob Erzieher oder auch Kindergärtnerinnen – sie alle konnten sich ungehindert ihre Befindlichkeiten an Heimzöglingen austoben, prügeln oder sich auch sexuell an Schutzbefohlenen Jugendlichen vergehen. Grauzonen, die mit dem schauerlichen Satz umschrieben wurde, „du sollst nicht fehlficken“. Der junge Mensch hatte keine andere Chance, als sich „heimangepasst“ zu verhalten. Nur so konnte er sich ein Überleben sichern. Das war Alltag im Haus Neuer Kamp, wo die leichte Verfügbarkeit von Kindern sexuelle Befriedigungs-Szenarien garantierte.
Naheliegend war es, ohne viel Aufhebens, mal eben kurz über den Flur ins Jungen- oder Mädchenzimmer zu hüpfen. Das ersparte dem Erziehungspersonal umständliche Busfahrten in die Kilometer weit entfernte Innenstadt, dort wo ein Liebesabenteuer langwieriger und überdies sehr ungewiss, oft ein Zufall war. Die pädagogische Trendwende sollte noch ein Vierteljahrhundert auf sich warten lassen. Seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gibt’s kein Augenzwinkern mehr, werden immerhin körperliche Gewalt, sexueller Missbrauch strafrechtlich geahndet. – Fortschritt.
Damals zu meiner Heim-Zeit Mitte der sechziger im vergangenen Jahrhundert nistete überall in Erzieher-Köpfen selektive, rigide Prinzipien, ein drakonisches Bestrafungspotenzial. Sie wurden von den Großvätern des Dritten Reiches unbedacht kopiert, nachempfunden. Da wurden Schlüsselbunde urplötzlich ohne Ansatz an die Köpfe oder in den Rücken weglaufender, aufgeschreckter Kinder geworfen. Da blieb es in meiner Gemischten Gruppe III (Jungen und Mädchen) vornehmlich dem pädophilen Gruppenleiter vorbehalten, das gegenseitige Auspeitschen mit nassen Handtüchern, quasi als sexuelles Vorspiel, anzuordnen. Lustgewinn. Ein ordentlich gemachtes Bett, das zu jeder Tageszeit für etwaige Besucher vorzeigbar war, schien für die Heimleitung allemal wichtiger als eingeschüchterte Kinderseelen. Dass uns beim Klo Gang nur zwei Blatt Papier gesondert zugeteilt wurden, nach dem wir die Erzieher höflich zu fragen hatten, blieb ein verschämt verstecktes Alltagsritual.
Jene allseits verinnerlichten Heim-Gewohnheiten besagten zunächst einmal, sozial auffällige, geistig oder körperlich behinderte oder psychisch kranke Kinder und Jugendliche zu disziplinieren, sie aus dem öffentlichen Leben einstweilen zu verbannen.
Mangelnde Anpassung wurde eben als Verwahrlosung interpretiert, einst als Vorstufe zum „lebensunwerten“ Leben abgehandelt. So schien es normal, dass ich im ersten Vierteljahr auf keiner Schulbank hockte, über keinerlei außer-heimische Kontakte verfügte, ich mit Entzug und Entsagung auf meine Heim-Jahre im Heim-Versteck abzurichten war. Isolation. Ich sollte mich erst einmal von meiner elterlichen Drangsal erholen, erst einmal lernen, angstfrei ein- und auszuatmen.
Wieder saß ich, wie einst in meinem Heimatstädtchen Schöningen, am Fenster, diesmal in der ersten Etage im zweiten Gebäudetrakt des Kinder- und Jugendheims. Diesmal plärrte ich nicht auf den Marktplatz, sondern rief lauthals in die tief hallenden Wälder hinein. Keiner wollte mich hören. Heiser wurde ich. Nachts schlafwandelte ich durch Gruppenräume. Schreiend weckten mich meine Albträume, Angstträume.
Immerhin: bemerkbar hatte ich mich schon gemacht, gestört, dazwischengeredet, Mahlzeiten verweigert – mit niemandem mehr gesprochen, das wochenlang. Ganz plötzlich wurde ich von einem Tag zum anderen als sichtlich „behinderter Querulant“ mit Wahnanwandlungen abgeholt; eingeliefert in die Psychiatrie der Westfälischen Kliniken zu Gütersloh, Hermann-Simon-Straße 7. Mutters Meinung hatte sich durchgesetzt. „Mein Reden ist seit langem“, äußerte sie sich auch ungefragt, „der Junge ist nicht ganz normal. Ist wohl bei der Geburt was schiefgelaufen. Zu lange hatte sich wohl die Nabelschnur um Brust und Hals geschlungen. Mit Schulterriemen kam er auf die Welt. Und die 40 Grad Fieber wollten und wollten nicht runtergehen.“ Punktum.
Als ich die Gemischte Gruppe III mit zwölf Jahren verlassen musste, intonierten Erzieherinnen mit Kindern: „Befiehl du deine Wege … Mach End‘ o Herr mach Ende an aller unser Not.“ (Paul Gerhardt *1607+1676). Wenigstens durfte ich ein Köfferchen mit Spielsachen und meinem Lieblingsbuch „Locke und die Fußballstiefel“ mitnehmen.
In Gütersloh auf dem Areal des weitläufigen Krankenhaus-Komplexes mit Hunderten behinderter Menschen lag ich in einer Schlafhalle, die mich an einen Bahnhofs-Warte-Saal erinnerte; mit zwanzig bis fünfundzwanzig angeblich seelisch in ihrer Geistesverfassung gestörten Kindern. Gleißende Neonröhren und weiße Kittel kreisten unablässig über unseren Augen – Nacht für Nacht, acht Wochen lang.
Als ich Jahrzehnte später den russischen General und Dissidenten Pjotr Grigorenko (*1907+1987)28 in der Moskauer Psychiatrie des Serbskij-Instituts besuchte, fühlte ich mich schon von Atmosphäre wie Räumlichkeit her an die Absonderlichkeiten bundesdeutscher Kinder-Betreuungen erinnert. Eine mit weißen Metallstangen geschmückte Pritsche mit der Nummer 24 war das einzige, was mir in Gütersloh blieb. Versuchsanstalt für Medikamenten-Evaluierung oder Irrenhaus? So genau wollte das wohl niemand eigentlich wissen. Hier ging es ums Überleben.
Wieder waren es starke Tranquilizer namens Megaphen- und Belladenal-
Tabletten29 die meine vermeintliche „seelisch-nervöse Übererregtheit“ lindern sollten. Ruhig wurde ich gestellt. Und das bereits seit meinem achten Lebensjahr. Nur die Megaphen-Tropfen, auch in der Überdosis, wollten nicht helfen. Ich harrte mit trüben, hospitalisierten Betten-Blicken wie bestellt und nicht abgeholt der Dinge, die da kommen sollten. bestellt und nicht abholt. Im erkalteten Irrenhaus. Heilanstalt.
Auf der Kopfrückseite meines Bettes waren auf angeklebten Zetteln die Nummern von 1 bis 6 aufgezeichnet. Sie gaben Auskunft darüber, mit welcher Schulnote Krankenpfleger meinen allmorgendlichen Bettenbau zensierten. Nicht mal meinen Zeichenblock hatte ich mitnehmen dürfen. Die Fenster waren sehr hoch und vergittert, die Türen verschlossen, Steinfußböden, angefressene, demolierte Tische und Stühle, Plastik Geschirr und Besteck, keine Musik, kein Gesang, kaum Gespräche – Kindergefängnis. Kein Blick auf Bäume oder Landschaften – nur Gitter, nur ewig die ängstlich wahrgenommenen Herren in weißen Kitteln – morgens, mittags, abends immerfort die weißen Kittel. Untersuchungen über Untersuchungen, Geräte-Medizin, ärztliche Befragungen, schriftliche Tests – acht Wochen sind kein Tag.
Hinter diesen Stahlrohr-Verhauen lernte ich Edgar kennen. Er war mal gerade elf Jahre alt geworden, kam aus dem benachbarten Bielefeld. Einzelkind – unehelich. Mutter berufstätig. Keine Zeit. Edgar war von schmächtiger Gestalt mit wieselflinken Augen, wich nicht mehr von meiner Seite, wollte immer spielen, wo nichts spielerisch war. Kontakt nach Hause hatte er keinen, kein Brief, kein Päckchen, keine Süßigkeiten. Über Jahre. Freunde wurden wir. Edgar wusste zu erzählen, kannte viele Geschichten. Wenn da nicht gewisse Wörter, wie „Ficker“, „Scheißer“, „Arschficker“, „Fotze“ gewesen wären, die fortlaufend über seine Lippen huschten, Sätze wie Gedanken unterbrachen, Zuhörer schockierten.
Edgar litt unter einem Kurzschluss im Gehirn, auch Tourette-Krankheit
genannt. Tourette30 das ist die Krankheit der Tics. Es ist eine neurologische Erkrankung, ein Rätsel der Medizin. Die Ursachen waren nur ungenau zu bestimmen. Vermutungen gingen von Störungen im Gehirnstoffwechsel oder einer Genmutation aus. Jedenfalls galt die Tourette-Krankheit zu jener Zeit der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts als unheilbar. Zwänge wie bellen, grunzen, zwinkern oder auch mit dem Kopf Fensterscheiben einzudrücken – das waren oft ständige Lebensumstände. Ratlosigkeit. Achselzucken. Edgar verschwand über Jahre in der Jugend-Psychiatrie, sein zu Hause. Keiner wusste mit ihm etwas anzufangen, keiner hörte ihm zu. – Endstation eines jungen Lebens.
Nur einmal hatte ich Besuch: dreieinhalb Stunden – die Mutter. Ihre Kleidung war aufwendig-extravagant, als müsse sie als weit gereiste Madame vor Ärzten in der Psychiatrie ihre Intaktheit unter Beweis stellen. Bedächtig fütterte sie Schwäne im angrenzenden Stadtpark, redete beim kleinen Spaziergang wenig mit mir. Sie schaute versonnen ans gegenüberliegende Ufer, in dem sich die Nachmittagssonne spiegelte.
Kaum war ich in Emden geräuschlos aussortiert worden, da kündigte sich beim Zollwachtmeister Nachwuchs an. Arier-Nachwuchs von strammen blonden wie blauäugigen Mädchen. Endlich. Das wollte die schwangere Frau mir sagen. Mehr nicht. Plätzchen, Kuchen – Ende der Visite. Ihr Zug fuhr pünktlich, Gleis sieben gen Norden.
Ich verkroch mich in dieser Nacht zum ersten Mal unter Schwester Erikas Bettdecke. Sie hatte sich schon an den Abenden zuvor häufiger an mein Bett gesetzt und mich immer wieder geküsst. – Nachtdienst. Gut sah sie aus, besagte Schwester Erika, zärtlich war sie mit ihren umschließenden Lippen. Reimar war gerade 13 Jahre alt geworden.
Mit dem Nacht-Express nach Ostfriesland nahm Frau Mutter aber auch die einhellige, unliebsame Expertise meiner Klinik- Ärzte mit: von einer, auch von ihr stets behaupteten geistigen Beeinträchtigung könne nachweislich nicht ausgegangen werden, ganz im Gegenteil.
Hellwach sei ich, ausgestattet mit einem schnellen Denk- und Erinnerungsvermögen. Es wäre daher höchstwahrscheinlich, dass die nächtlichen Angst-Exzesse auf zerrütteten, desolaten Familien- Zustände, Gewalt-Einwirkungen zurück zu führen sind. Ein weiterer Heimaufenthalt, somit die räumliche Trennung vom Elternhaus, sei dringend geboten. Eine höhere Schulbildung sei erfolgsversprechend. Ruhiger Umgang in einer gedeihlichen Atmosphäre sei anzuraten, würden Ängste wie Unruhemomente verschwinden lassen.
Flugs war ich abermals unverhofft bei denen, die mich gerade erst weggeschickt hatten: im Haus Neuer Kamp zu Osnabrück. Sicherlich, verlautbarte es auf einmal da, der Junge sei wohl schon intelligent, vielleicht reiche es ja doch bis zum Angestellten eines Reisebüros, zu mehr aber keinesfalls. Da wäre das Ende der Fahnenstange erreicht. Mittlere Begabung. Punktum. Das will der Hauspsychologe Oskar Meseck wasserdicht durch seine Explorationen eruiert haben.
Von Routine getragen waren die Psychologen-Blicke. Nur die Zahlenwerte zum Intelligenzquotienten, die er feinsäuberlich zu notieren gedachte, die stimmten summa summarum nicht. Zettelwirtschaft. Was eine fundierte psychologische Einschätzung angeblich so diffizil erschienen ließ, Reimar sei einfach nicht auszumachen, mal lebhaft, mal zurückgezogen, einfach schwer zu kalkulieren seien seine Vorteile und Nachteile. Unsicherheiten eines Anfängers, der im öffentlich stattlichen Gebaren über jeden Zweifel erhaben war. Paradoxien meiner Kindheit. Weichenstellungen: die mich loswerden wollten, sie hatten mich nunmehr fortan wieder. Mich schützte das zweifelsfrei höher zu bewertende Psychiatrie-Gutachten aus der Klinik in Gütersloh. – Hoffnung.
Verschieden waren die Anlässe fürs Heim-Asyl, die Szenerien zeigten aber bedrückende Ähnlichkeiten. Sie schienen fast austauschbar. Nahezu allen Kindern war Liebe vorenthalten worden. Vernachlässigungen, Lieblosigkeiten durchdrangen ihr junges Leben, materiell wie emotional. Gewalteinwirkungen, Handkantenschläge, Knüppel, Fausthiebe und Tritte, sexuelle Verfügbarkeit, sexuelle Beliebigkeit, hatten hinlängliche Spuren hinterlassen. Sie zeitigten seelische Fußabdrücke, auch Bindungslosigkeit des ständigen Kommens und Gehens – Verlade-Bahnhöfe. Ich habe es als kleiner Bub erleben müssen, ich weiß, wovon ich rede, schreibe.
Die dreizehnjährige Margot kam aus Oberhausen. Sie war ein stilles, in sich zurückgezogenes Mädchen; aus ihrem Zimmer in der Gemischten Gruppe III zog ein strenger, süßlicher Geruch über den Flur. Eine rote Gummimatte hatte die Margot-Matratze zu schützen. – Margot die Bettnässerin. Sie war ein hochgeschossenes, in sich zurückgezogenes Mädchen mit blonder Bubi-Kopf-Frisur; gelegentlich huschte ein freches Lachen über ihr Gesicht. Nur ihren linken Arm, den hat sie im langen Ärmel ihres Pullovers sorgsam eingepackt, durfte niemand sehen. Margot, die Ritzerin.
Das Mädchen, so die Heimakte, wurde über Jahre von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht. Immer dann, wenn der Bergmann von der Nachtschicht des Morgens nach ein paar Bierchen sich ins Bett trollte, hatte Margot präsent zu sein. In manchen Nächten half es schon, erzählte sie später zögerlich, dass sie sich einfach tot stellte wie ein Betonklotz lag sie dann da, rührte, bewegte sich nicht – wie ein Klotz. In anderen Nächte half das wenig. Wenn Margot des Morgens aufwachte, lag sie mit „fürchterlichen Bauchschmerzen“ blutverschmiert im eigenen Urin.
Gute-Nacht-Spiele. Sexuelle Liebes-Spielchen. Mutter Inge will davon nichts mitbekommen haben. Früh am Morgen verkaufte sie im Edeka-Laden frische Brötchen. Ahnungslos war sie zumindest bis zu jenem Zeitpunkt, an dem Margot begann mit Glasscherben, Rasierklingen ihr eigenes Fleisch am linken Unterarm aufzuritzen.
Das Mädchen Margot – vom Stiefvater missbraucht, von der Mutter letztendlich abgeschoben, Pflegefamilie, Heimkind in Osnabrück. Ängste, die nicht weichen wollten, Essstörungen, die alles blockierten, Depressionen, die überall wie nirgends plötzlich auftraten. Mit dem Rasierklingen-Schnitt verknüpfte sie die befreiende Gewissheit, „dass ich noch da bin“. Heimjahre.
Das Mädchen Margot aus Oberhausen war keine Ausnahme im Haus Neuer Kamp. Sie war der Normalfall in den fünfziger und sechziger Jahren in deutschen Landen. Seelisch ruiniert, körperlich geschändet von einem grobschlächtigen Mann, der eigentlich ihr Vater hätte sein wollen, sollen, müssen. Margot war noch nicht einmal fünfzehn Jahre alt. Ihr Selbstwertgefühl schien irreparabel dahin. Sie schämte sich, redete nicht. Schauplatz Heim – Haus Neuer Kamp zu Osnabrück
… und jetzt, ausgerechnet im sicher geglaubten Heim, waren es Erzieher mit ihren obligaten Klapperlatschen und ihren manierlich blank rasierten Beinen, die inmitten der Nacht in Kinder-Schlafräume eindrangen, zielsicher durch die Zimmer schlichen. Der Spätdienst war beendet, Schlösser mit dem Dietrich schnell geöffnet und schlafende Jungs unversehens gefügig gemacht.
Der Bananen-Onkel, wie sich der Sonderpädagoge Klaus Vogelsang31 vorstellte, war unterwegs. Er war häufig unterwegs. Der 24jährige war ein Ostzonen-Flüchtling aus Gotha, wie damals die aus der einstigen DDR übergelaufenen Deutschen genannt wurden. Eigentlich studierte er an der Pädagogischen Hochschule in Osnabrück Sonderschul-Pädagogik. Offiziell zumindest. Tatsächlich zog es ihn ins Heim der Kinder. Dort wohnte, dort agierte er. Ein Zuhause hatte Vogelsang nicht. Kinder waren seine „Heimat“- ihre Unterhosen, an denen er hingebungsvoll riechen mochte.
Klaus Vogelsang verstand es, sich das Vertrauen neu angekommener, verstörter Buben zu erschleichen. Die ersten Heimmonate waren schulfreie Zeit – Wochen der Beruhigung, der Eingewöhnung; aber auch die Zeit für neue Bezugspersonen. Vogelsang gab Rechenaufgaben, lispelte vor den Heimkindern stehend mit seinem Arsch wedelnd Diktate zur Rechtschreibung herunter. Zur Faschingszeit an Sonntagnachmittagen tanzte der etwa 1,80 Meter große Mann mit jungen, körperlich noch arg kleinen Bubis eng umschlungen ganz bedächtig zu Schlagern von Freddy Quinn „Hundert Mann und ein Befehl“. Dabei presste er die körperlich kleinen Jungen-Köpfe passend an seinen Hosenschlitz. Er tanzte so bedächtig, als werde er niemals aufhören wollen mit seinen rötlich unterlaufenen Glupsch-Augen. Gelegentlich verschwand Vogelsang für kurze Momente mit einem Buben im Waschraum. So „schmutzig“ schien ihm das Jüngelchen. Die Vorhaut musste vor dem nächsten Ringelpietz ordentlich gewaschen werden – seine gleich mit.
Im Haus Neuer Kamp durfte er als angehender Pädagoge die Jungs-Betten „beaufsichtigen“ – die Jungs-Betten bei Mondschein, die Jungs-Duschen am Morgen, die Jungs beim Süppchen löffeln. In seiner Eigenschaft als schwanzpraller „Bananen-Onkel“ fiel er – mir nichts, dir nichts – über Geschlechtsteile junger Knaben her; kneifend, lutschend und leckend – immer und immer wieder vor Wollust sabbernd. Das hatten Gerd-Dieter, der Andy, Wolfgang und Schmidtchen Jahre um Jahre über sich ergehen lassen müssen; diesen Vogelsang mit seinem „singenden Tonfall“ thüringischer Mundart. Jeder wusste vom „Bananen-Onkel“, jeder wusste um seine Repressionen - jeder schwieg. Pädophilie.
… wieder waren es Kindergärtnerinnen, die ihre Jungen frohen Mutes im Negligé auf die Matratze lockten. Das war in vielen Gruppen so. Es sei denn, Lesben liebäugelten miteinander. Angelika Tobens32 kannte alle Texte aus dem Liederbuch der Mundorgel auswendig. Sie sang ohne Unterlass. Oder sie betete. Bei und mit ihr waren die rauschenden Wildgänse nicht nur in der Nacht, sie waren immer unterwegs.
Angelika war eine herzliche, aber nicht sonderlich attraktive Frau. Ihre braunen Augen schielten die Umgebung aus, ihr üppiges Sommersprossen-Gesicht ließ Pippi Langstrumpf vergessen. Freunde hatte sie praktisch als frisch Zugereiste keine. Jung war sie, gerade 21 Jahre alt, aus der Schweiz nach Osnabrück mit dem Kindergärtnerinnen-Diplom übergesiedelt. Abends hockte die junge Angelika allein in ihrem Erzieherinnen-Zimmer. Abend für Abend hörte sie Schnulzen vom amerikanischen Schlagersänger Elvis Presley (*1935+1977), mal in deutscher „Bist du einsam heut Nacht“, mal in englischer Version, „Are you lonesom tonight“.
Angelika sang so einladend, bis ich letztendlich an ihrer Bettkante mitsummte – „… sind die Träume schon da, ist der Schatten dir nah, der dich fragt, bist du einsam heut Nacht … Wir alle müssen unsere Rollen spielen. Du hast Deine Rolle gut gespielt…“.
Ich konnte nicht ahnen, dass Angelika praktisch meine erste Frau werden sollte – mit 13 Jahren. Tagsüber blieb ich ein Heimjunge, des Nachts mutierte ich zum Sex- oder auch Lebensgefährten meiner Erzieherin. Wenn der Nachtdienst die Flurlichter ausknipste, schlich ich zu Angelika ins Bett. Zuweilen wachte ich Stunde um Stunde, bis ich meines Schleichwegs sicher sein konnte. Weit hatte ich es ohnehin nicht, weil nur ein schmaler Flur unser beider Zimmer trennte. Zuerst gab’s Schokolade, manchmal auch Kekse – vor dem verbotenen Sex. Kindesmissbrauch.
Hin und wieder malten wir uns aus, was passieren würde, wenn unsere Amour fou. aufflöge. Unsere Bindung war ungewöhnlich, nicht ungefährlich. Sie schien obendrein kopflos zu sein. Ich war minderjährig, ein Schutzbefohlener in ihren Händen. Sie war eine beruflich selbstständige Frau in den besten Jahren – auf der natürlichen Suche nach einem Mann. Nur es gab für sie in diesem Heim nicht die geringste Chance einer Lebensperspektive. Was tun? Loslassen oder wenigstens die Stunden auskosten?
Wir konnten von einander nicht lassen. Wir verständigten uns für den Fall der Fälle darauf, einfach strikt zu lügen, sämtliche Vorwürfe als schmutzige Fantasie konsequent abzustreiten und vor allem, diese Verteidigungsstrategie unbeirrt, stereotyp durchzuhalten.
Seltsam knirschte mein Empfinden, meine Vorlieben – auch Jungen-Vorlieben zwischen der Liebeserwartung und dem nach Zeitplänen abzuspulenden Alltäglichkeiten – Heimleben. Ich verspürte einen ständigen Unruhe-Zustand in mir, ein besonders aufmerksamer Liebhaber zu sein – in Kinderjahren. Ich hatte einfach präsent zu sein, ihre Erwartungen zu erfüllen – an späten Abenden. Ich durfte mich meinem gleichaltrigen Mädchen-Schwarm aus der Gruppe praktisch kaum nähern – ohne mich sogleich rechtfertigen zu müssen. Besitzansprüche.
„Mein Reimar“ hatte das gleichaltrige Heimmädchen Carin mir tagsüber immer wieder zugeflüstert, fast beiläufig. Sie war ein aus dem Elternhaus in Celle verstoßenes Mädchen. Als sie in Osnabrück abgeliefert wurde, wusste sie so gar nicht, wie ihr geschah. Sie quälten keine Depressionen, Aggressionen oder andere auffälligen Verhaltensstörungen: allenfalls beim Vater. Er hatte sie nach der Scheidung staatlichen Heimen ausgeliefert, weil er seiner Tochter in frisch vermählter Zweisamkeit kein neues Zuhause geben wollte. Das einzige, was im Fall Carin aus ihrer Heim-Akte hervorstach, waren ihre Diebstähle im Konsum-Laden. Ihr Heißhunger nach Gummi-Bärchen.
„Mein Reimar“, das sagte sie auch, als wir uns nach 47 Jahren 2012 wiedersahen. Wir trafen uns in Wien. Sie hatte mich übers Internet ausfindig gemacht. Ich folgte ihrer Einladung. Wir sprachen, redeten, gestikulierten in alten k-u-k-verkitschten Cafés in Wien; Wir saßen Stunde um Stunde im Legenden umwobenen Künstler-Café Hawelka in der Dorotheergasse. Fast schien es so, als seien nahezu vier Jahrzehnte an uns im Nu vorbeigerauscht, hätten gar nicht stattgefunden mit ihren Hoffnungen, Visionen, Ambitionen, Ehen, Scheidungen, Kinder, Enttäuschungen, Ängsten.
Das Heim hatte uns wieder. Sie, die auf Mode und neureichem Erfolg getrimmte Immobilien-Maklerin der Insel Sylt. Ich, der Reporter und Buchautor, auflagenstarker Magazine zwischen den Erdteilen hin und herjagend, saß da wie bestellt und nicht abgeholt nicht auf äußeren Schick bedacht im zerknitterten Anzug. Wir sprachen es nicht laut aus, aber unsere Blicke verrieten uns – unser Lebensthema. Konnten wir beide es insgeheim immer noch nicht fassen, aus dem Moloch Heim zu solch einem Höhenflug angetreten zu sein: Karriere. Gemeinsamkeiten.
Carin sagte: „Ich war und bleibe ein Heimkind mit Folgeschäden. Ich war ausgesetzt worden. Über Jahrzehnte litt ich unter Verlassenheitssyndromen; nicht einmal, sondern immer und immer wieder – Tag wie Nacht. Ich konnte nicht allein sein – Panik. Wenn sich Partner-Konflikte andeuteten, war ich schon auf der Flucht, auf der Suche nach einem anderen Mann oder bin einem ‚fliegenden Frauen-Wechsel‘ vorausgeeilt. Vielleicht war es die Angst, nicht mehr geliebt zu werden.“
Carin schilderte: „Hin und wieder wurde ich mir selber ein wenig unheimlich, unsicher. Je mehr ich nämlich verdiente, je größer sich mein gesellschaftlicher und beruflicher Aufstieg vollzog, desto unkritischer sah ich mich, desto mehr Frauen schlossen sich meinem attraktiven Puppen-Kabinett im Immobilien-Milieu an. Ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe, allein sein zu können, es sogar genießen kann. Ich brauche keinen Alkohol, keine andere Vagina mehr, um die Verlassenheits-Panik zu milden.“
Carin ergänzte: „Mir machen diese Männer einfach keinen Spaß mehr. Das Macher-Gefühl wird immer schaler, weil es meist Figuren waren, die mich nicht wirklich begeisterten. Vielleicht nähere ich mich ja eines Tages wieder einmal dem männlichen Wesen, ohne gleich das Gefühl der Verletzung zu spüren. Leider habe ich ja auch schon zu viele verletzt, weiß man doch nur zu genau: „no risk, no fun.“
Carin resümierte: „Ihr Männer seid irgendwie ‚geschädigt‘, habe ich das Gefühl. Lasst mir doch meine ‚Esoterik‘33. Ich nehme wirklich nur das an, was wirkt und was ich sehen kann. Bei allen Experimenten war ich häufig die einzige, die nichts sah, fühlte etc. Aber genau das habe ich dann auch gesagt. Also ich nehme niemandem (mehr) einen Mann weg, seinen Glauben und seine Überzeugung sowieso nicht. Zu guter Letzt: Ist es denn verwerflich, wenn mir ein indischer Astrologe sagt, Du wirst 17 schöne gesunde Jahre erleben?
Rückblende – Als ich im Jahre 1965 im Haus Neuer Kamp mit Carin gemeinsam eines Abends auf ihrem Bett erwischt wurden, hatte das 14jährige ahnungslose Mädchen aus der Gemischten Gruppe auf Geheiß unserer Erzieherin Angelika zu verschwinden – wurde plötzlich in eine Gruppe „schwer erziehbarer Mädchen“ im anderen Gebäude-Trakt verlegt. Begründung: keine. Dabei hockten wir arglos in Pyjamas auf der Matratzenkante, tauschten Süßigkeiten, vielleicht manches Mal auch ein bisschen mehr. Vielleicht war es eine zärtlich gedachte Gemeinsamkeit gegen unsere Verlassenheit, unsere hinter uns gelassenen Ruinen, die sich Elternhäuser schimpften. Die Suche nach Nähe in Kinder-Jahren.
Angelika hingegen war schon solch ein flüchtiger Anblick zu viel. Sie weinte. Sie weinte viel und verzog sich mit ihren Taschentüchern ins Erzieherzimmer. Sie weinte auch, wenn ich in den Ferien meine Mutter in Emden zu besuchen hatte. Vielleicht Verlustängste. Ich genoss ihre leise Demut, auch unsere emotionale Abhängigkeit.
Angelika schrieb mir Briefe, auch versteckte Liebesbriefe ohne Rücksicht, ohne Vorsicht – wie von Sinnen. „… Du fehlst mir hier sehr und ich schwärme regelrecht von Dir. Weißt Du noch, wie wir beide die halbe Nacht im Tagesraum an den Transparenten gearbeitet haben? Du und ich. Vieles mehr war zwischen uns. Es gibt halt derart schöne, einzigartige Erlebnisse. Wann kommst Du wieder? Sag wann?“ Und Angelika schmollte, wenn ich zum Schulbeginn ins Heim zurückeilte. Erst, wenn ich ihr nachhaltig versichern konnte, kein Mädchen berührt zu haben, blühte sie wieder auf. Unsere Bindung nahm nach drei Jahren ihr jähes Ende, als ich Osnabrück und damit das Heim verließ. Die streng verbotene Bettgeschichte hatte einen Namen: die Erzieherin mit ihrem anvertrauten Heimjungen im Haus Neuer Kamp zu Osnabrück.
Vorteile hatte ich unter Angelikas Obhut, viele Vorteile. Die pädophile Männer-Fraktion im Heim jedenfalls muss diese Liaison gewittert haben. Sie ließ mich in Frieden. Über alles, was im und um das Heim passierte, wusste ich beizeiten Bescheid. Ich kannte die Lebensprofile, Beurteilungen und etwaige Zukunfts-Skizzen meiner Kumpane. Auch die Ränkespielchen so mancher Erzieher blieben mir nicht verborgen. Nichtigkeiten, Eitelkeiten, oft ein Jammertal. Viel Bettgeflüster mit Herrschaftswissen.
Zu Zeiten im Advent gingen wir jeden Abend feierlich und frisch gekämmt in die vorweihnachtlich geschmückte Empfangshalle. Lieder galt es bedächtig zu singen, feierlich Sonntagsgesichter zu zeigen – Tag für Tag. Da galt es coram publico die Adventsuhr weiter zu drehen und dabei mutig stehen zu bleiben, Gedichte von Conrad Ferdinand Meyer (*1825+1898) „Eia Weihnacht, eia Weihnacht, schallt im Münsterchor der Schall der Knaben …“ hatte ich aufzusagen oder auch an der Harfe zu zupfen – für einen Bonbon. Heim-Idylle. An solchen vorweihnachtlichen weich intonierten Stimmungsabenden verstand es sich von selbst, dass die wenigen Männer des Hauses ihre Anwesenheit dokumentierten.
Max H. Berling (*1905+1999) der ursprünglich Max Henry Berliner hieß, war Architekt und Ehemann der Heimleiterin. Er hatte mit durchdachten Konzeptionen die zerstörte Osnabrücker Marienkirche nach dem Kriege restaurieren helfen, gar das Gemäuer des Heims angeordnet. Damals konnte der einst renommierte Baufachmann und Kirchen-Erneuerer nicht ahnen, dass auch für ihn die letzten Jahre seines Berufslebens dieses Haus Neuer Kamp zu einer Art Gefängnis werden sollte. Eine Rente bekam der Freiberufler nicht. Wenn er überhaupt über Bares verfügen durfte, so oblag es seiner Frau, ihm ein „Taschengeld“ zuzuteilen. Das machte sie oft sehr launenhaft und nach Gutdünken. Anstandslos bedachte sie ihren Gatten unter der Bedingung, dass ihr Max bei den Abendandachten sich einvernehmlich an ihrer Seite zeigte und voller Inbrunst Kirchenlieder mitsang. Halleluja.
Im Haus Neuer Kamp hatten Frauen alle Macht über Männer, über heranwachsende Jungen; voran Heimleiterin Gertrud Berling. Damals waren es vornehmlich noch Frauen mit streng frisiertem Knoten, die dort ihr kurzatmiges, rigides Kommando unter dem Kreuz im Namen evangelischer Pastoren führten. Ein Knoten beim Wecken, ein Knoten bei der Essensausgabe der Suppenkübel, ein Knoten im Büro, ein Knoten beim Abendlied, viele teilnahmslose Knotengesichter bei den wöchentlichen Abendandachten mit dem obligaten Schlusskanon „Herr erbarme dich“ – „Lobet den Herren den mächtigen König der Ehren“. Und letztlich war es der aufgemachte Knoten im Halbdunkel der Nacht irgendwo mit irgendwem auf einer abgewetzten Matratze. Die überall und nirgends auftauchende Knotenfrisur in den fünfziger wie sechziger Heim-Jahren war keine Modeerscheinung. Für Zöglinge dieser Epoche symbolisierte der Dutt ein unnahbares Schreckgespenst. Er blieb das stählerne Frauen-Symbol aus düsteren, Angst machenden Zeiten der braunen Epoche.
Was hatte sich in Zeiten der jungen Bundesrepublik eigentlich verbessert? Wohl recht wenig. Unbeherrschte, unnahbare, launische, oft unausgebildete Fräuleins diktierten in Heimen das Wohlbefinden der ihnen Ausgelieferten. Hin und wieder gab es einen kurzen Schlag ins Gesicht oder mit dem Lineal eins auf die Finger. Hin und wieder hieß so viel, ausnahmslos jeden Tag. Und im Foyer hallte abgehacktes Geschrei ans Gemäuer, klatschten Backpfeifen im Drei-Minuten-Takt.
Es waren die Prügel-Nachmittage des Führungspersonals um Heimleiterin Gertrud Berling mit ihrer Stellvertreterin Ursula Knabke (*1923+2013). Erzieher-Stunden. Scheinbar ewig wirkte ihr immer und immer wieder ausbrechendes Gebrüll krächzend nach; auf den unendlich langen, nie enden wollenden schallgedämpften, schummrigen Fluren des verfluchten Kellergangs. Dort lungerte Gewalt. Angeführt vom baumlangen Hausmeister Granert. Erzieher-Gewalt, rohe Gewalt. Ihm oblag es, widerspenstige Kinder auf Weisung der Heimleitung im Kellergang mit Faustschlägen und Knüppel zu malträtieren. Am Eingang schallte Gekreisch, am Ausgang kullerten Tränen.
Pastor Eckhard Pfannkuche, der mich in seiner weiß getünchten, neu erbauten Melanchthonkirche am Bergerskamp 1964 konfirmierte, gab mir mit auf den Weg: „Beiße die Zähne zusammen, auch wenn es noch so schwerfällt. Da hilft nur Beten.“ Fortan machte mich der Gemeindepfarrer zum Kindergottesdiensthelfer. Psalmen, Gebete und Lieder, in denen sich das gottesdienstliche Leben widerspiegelte. Zeit zum Durchatmen.
Der Pastor schenkte mir die damals neue Fassung der Lutherbibel; die Übersetzung des Alten und Neuen Testaments der Bibel aus dem althebräischen, dem aramäischen bzw. der altgriechischen in die deutsche Sprache. Der Pastor schickte mich auf Landesseminare der Kindergottesdiensthelfer zur zweifelsfreien theologischen Interpretation der Agende. Ihm lag besonders daran, dass ich im Kreise von 200 Gymnasiasten „Selbstbewusstsein tankte“ und, wie er sich ausdrückte, „die Ehrfurcht vor höheren Schulen“ ablegte. Ich sollte „einfach lebhaft mitdiskutieren“, ermunterte er mich häufig.
Pfannkuche war Kettenraucher und ein Mann der Bibliothek. Kein Platz in seinem Pfarrhaus blieb leer, Bücher über Bücher. Dort verschanzte er sich, schrieb seine Predigten meistens in den Nächten. Tagsüber ging es im Pfarrhaus oft zu wie in der Villa Kunterbunt – ein Kommen und Gehen. Seelsorge. Ich staunte und staunte über Geduld wie Demut; mit welcher Leichtigkeit dieser hoch gewachsene Mann mit scheinbar weltfremder Lesebrille und stramm zurück gekämmten Haaren zitierte, rezitierte, rekapitulierte, zuhörte, half. Bezugsperson.
Es sollte mein erster, selbst verfasster und auch gedruckter Artikel sein, den ich als 15jährige Schüler im Kirchen-Kreis34, dem Nachrichten-Blatt für die Evangelisch-lutherische Gemeinde Osnabrück schrieb. Heftige Auseinandersetzungen gab es in der Gemeinde, wie Christus vom damaligen kirchlichen Kunstverständnis her im Gotteshaus optisch wahrzunehmen ist; als leidender, sentimental dreinschauender Petrus vergangener Epochen? Oder als gegenwartsbezogener Christus am Kreuz in der Form einer nüchternen, eher abstrakten Skulptur eines Hingerichteten, der sich noch offenen Blickes seiner Schlächter vergewissert? Kulturkampf.
Ich fragte hingegen, ob wir Angst davor haben, Christus in die Augen die schauen. Deshalb bevorzuge man schließlich das alte, atmosphärisch einschläfernde Kreuz, weil es hingebungsvoll sentimental anzubeten sei. Nur, so meine Schlussfolgerung, ein Hingerichteter sei nie schön.
Wer aber war der Kirchen-Reformator Philipp Melanchthon (*1497+1560), der eigentlich Philipp Schwartzerdt hieß und mit Martin Luther treibende Kraft der deutschen und europäischen kirchenpolitischen Reformation wurde. Er war Philologe, Philosoph, Humanist, Theologe – von Krankheit und Zweifel geplagt. Von ihm stammt die einst beruhigende Mahnung: „Die Geheimnisse der Gottheit sollten wir besser angebetet als erforscht haben.“ Martin Luther hingegen suchte eher mit markanten Sprüchen vom “Fressen, Furzen, Rülpsen“ seine Aufmerksamkeit. Wie dem auch sei: ich hatte einen Pastor als Bezugsperson – ein Vorbild.
Nachvollziehbar, auch naheliegend: Auch ich wollte Theologie studieren, ein evangelischer Seelsorger sein. Auf dem sogenannten Nachhauseweg von der Kirche ins Heim sang ich oft das Kirchenlied „ein feste Burg ist unser Gott“ vom Reformator Martin Luther (*1483+1546) um 1529 geschrieben trotzig und voller Inbrunst vor mich hin. Damals konnte ich nicht wissen, welch eine Symbolkraft für den Protestantismus von Luthers Versen ausgegangen war.
Wer hier im Heim durchkommen wollte in diesem ausgegrenzten Kinder-Getto kleiner Mädchen wie Jungs, das wollten eigentlich alle, hatte sehr schnell im Flüsterton lernen müssen, seine Empfindungen, Gefühle wohlkalkuliert den sich andeutenden Vorteilen unterzuordnen und sich instrumentalisieren zu lassen. Prostitution der Zärtlichkeit. Augenzwinkern. Achselzucken. Bedrohung. Belohnung. Punktum. Heimjahre, um wenigstens an den Sonntagen stundenweise im Gotteshaus Obhut zu finden.
Unwürdige Abhängigkeiten, Grauzonen überall Grauzonen. Vielerorts wucherten Übergriffe. Nur keiner wusste so recht, wer mit wem, wo und wann. Gewiss gab es zeitweilig Praktikanten, die mitbekamen, was in Betten, auf Fluren und Toiletten geschah. Aber keiner verspürte auch die Courage, wenigstens einmal dem Einzelfall nachzugehen, einfach Beweise an die Öffentlichkeit zu bringen. Stattdessen wurden Schilderungen missbrauchter Zöglinge verdrängt, bagatellisiert. Zudem sahen sich missbrauchte Kinder als unglaubwürdige Nestbeschmutzer ausgegrenzt – immerwährenden seelischen Zerreißproben ausgeliefert. Ganz nach dem Gutdünken des Erziehungspersonals: „Es konnte einfach nicht sein, was nicht sein durfte.“
„Sie wurden geschlagen, erniedrigt und eingesperrt“, berichtet der Journalist Peter Wensierski in seinem Report für das Magazin Der Spiegel35. Unter oft unvorstellbaren Bedingungen wuchsen in den fünfziger und sechziger Jahren Hunderttausende Kinder und Jugendliche in dreitausend kirchlichen Heimen mit mehr als 200.000 Plätzen auf. Weltweit sterben nach Mitteilung der Kinderhilfsorganisation UNICEF36 jährlich über 50.000 Kinder an den Folgen von Gewalt und Missbrauch, allein werden 20.000 Kinder Opfer von sexuellen Übergriffen37.
Die Sozialwissenschaftler und Bildungsforscher der Universität Bielefeld, Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen, kamen in ihrer ersten umfassenden Milieu-Untersuchung (World Vision Kinder-Studie, 2008)38 bei Kindern zwischen acht und elf Jahren zu dem Ergebnis, „dass die Klassengesellschaft in Deutschland keine neue Entwicklung ist. Erschreckend ist aber, wie sich in einem reichen Land wie Deutschland die Armut von Kindern ‚eklatant‘ auf ihre Biografien auswirkte. Das bedeute: geistige und kulturelle Armut, soziale Armut, materielle Armut, seelische, emotionale und psychische Armut, schulisches Versagen – und immer wieder Gewalt gegen Kinder, durchgängig Gewalt.
Es war die einst in der Schweiz lebende Kindheitsforscherin und Psychoanalytikerin Alice Miller (*1923+2010), die sich erstmals kritisch mit den allseits vorherrschenden Einsichten der Kind-Eltern-Beziehung auseinandersetzte. Ihr bekanntestes Werk, „Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem waren Selbst“39, erschien im Jahr 1979.
Alice Miller griff die sogenannte Triebtheorie vehement an, weil sie Traumen der Kindheit als kindliche Fantasien darstelle und die Realität von Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung als kindliches Trugbild bagatellisierte. Sie schrieb, dass auch ohne vitales Erinnern die Langzeitfolgen von Gewalt, sexuellem Missbrauch latent in Körper und Seele lauern, dort eine bedenkliche Eigendynamik freisetzen können. Pfade am gesellschaftlichen Wegesrand waren somit vorgezeichnet. Mit anderen Worten: Hier sorgte eine wegschauende Gesellschaft dafür, wie sie aus dem Gewaltopfer Kind, ausweglose Täter späterer Jahre macht. Gewalt gegen sich selbst, Gewalt gegen andere.
Alice Miller konstatierte: Um solche Gefahren-Potenziale zu verhindern sei es für solche Kinder wichtig, im Laufe ihres Erwachsenenwerden die eigenen authentischen Gefühle von Schmerz in der Kindheit zu erkennen, und vor allem zu verarbeiten. Ohne dieses präzise Erinnern, jenes erneute Erlebbare sei ein Bezug zur eigenen Geschichte zum eigenen Geschehen versperrt. Meist ist eine schonungslose, oft beherzte wie auch schmerzhafte Offenheit zum hastig Verdrängten der Beginn einer langwierigen Entwicklung, die die Seele erstarken lässt. Kärrnerarbeit. Befreiung. Wer aber hat dafür das Geld, wer mag schon solche seelischen Anstrengungen, Irritationen, mitunter Verzweiflung auf sich nehmen? Die wenigsten.
Ich kannte die Bahnhöfe dieser Städte – Emden, Osnabrück, Rheine, Lingen, Meppen, Papenburg und Leer. Ich wusste um die kahlen, ergrauten Hallen, um menschenleere Bahnsteige, die alles in ihrer Gleichmut und Monotonie zu erdrücken schienen. Kälte. Verladebahnhöfe, ob Menschen oder Güter, sind unverrückbare Orte von Trennung, Schmerz, Hoffnung, Freude oder auch Verdrängtem, gar Endzeitlichem. Frachtgut. Ankommen, Warten, Abschied nehmen, Abfahren.
Ich spürte die Leere. Aber ich liebte diese Eisenbahn-Knotenpunkte aus altem Backstein. Sie gaben mir Raum, auch im Getöse die Stille, mich zu finden, zu lernen, mich zu spüren, auf mich zu hören. Kein Lärm. Kein Krach. Keine Schläge – das kannte ich. Es gibt sie noch, diese einsilbigen Schienenverläufe, bedächtiges Schnaufen oder schrilles Pfeifen der Dampfloks ohne Ende in den flachen norddeutschen Landen, soweit das Auge reicht.
Diese, meine Stille war für mich mehr als lediglich die Abwesenheit eines begleitenden Geräusches, das ich nicht wahrnahm. Vielleicht dämmerte in mir ein Moment der Selbstvergessenheit, die ich sonst nicht kennen durfte. Ich suchte die Unnahbarkeit im Zugabteil, um mir selbst nahe zu sein. Jedenfalls seit meiner Kindheit lebt in mir eine heimliche Sehnsucht fort, möglichst in Zügen Grenzen zu passieren, seelisch Grenzen zu überschreiten, das Rattern der Schienen als Dauerzustand, irgendwo hinziehen, einfach fliehen – immerfort. Auch in späteren Zeitfolgen haben mich als Reporter Groß-Bahnhöfe in Frankfurt, Paris, Mailand oder Warschau, auch im fernen Buenos Aires, Daressalam angezogen. Sie blieben Anziehungspunkte, Kristallisationskugeln, denen ich mich nicht entziehen konnte. Oft waren es von Fernweh begleitete Zwischenstationen auf meinen Durchfahrten zu einem anderen, neuen Leben. – Verschnaufpausen.
Viermal im Jahr zog ich den Gleisen entlang zur Mutter nach Norden ans Meer – als „Heimat-Urlaub“ tituliert. Aber war es wirklich Heimat da draußen? Vertrautheit, mitunter Geborgenheit? Oder gar Urlaub im Refugium Elternhaus? Nur Kinder leben intuitiv ihre Vergangenheit, die sie praktisch nicht zu leben hatten oder auch durften. Ich verbrachte meine großen Schulferien in der Konservenfabrik BoB draußen auf dem entlegenen Marsch-Acker um das Dorf Wybelsum in der Krummhörn – dort, wo hauptsächlich in Kitteln wie Gummistiefeln verkleidete Hausfrauen rund um die Uhr schufteten, immer auf Trab waren – Dosen abfüllten, packten und Kisten schleppten für 2,74 Mark pro Stunde. Oder beim Rostklopfen in den Trocken-Docks der Nordsee-Werke im Emder Hafen. Dort, wo ramponierte Schiffe nach schweren Seegängen generalüberholt werden mussten. Stunden um Überstunden, Ferientage für Ferientage klopfte ich mit spitzem Hammer im blauen Arbeitskittel und gelben Helm auf dem Kopf in Akkord-Kolonnen den Rost von den Rümpfen der Frachter – immerhin für 4,20 Mark pro Stunde. Jede Pausensirene war ein Stück Befreiung.
Eine alte Regel besagt, Ur-Erlebnisse in der Kindheit wirken am nachhaltigsten. Sie beeinflussen Einstellungen, sie bestimmen Verhaltensweisen, sie prägen sich unauslöschlich ein. Gravierend sind Ur-Erlebnisse immer dann, wenn sie ein Sich auseinanderleben, ein Sich fremdwerden – Entfremdungen offenbaren. Nahezu unbemerkt hatten einstige Bindungen zu meiner Mutter eine kaum für denkbar gehaltene Entwurzelung erfahren.
Ich wusste hinlänglich um die förmliche Grundausstattung ihrer an mich gerichteten Korrespondenz; von ihrem umschweifenden Lamento des ihr entrissenen „geliebten Sohns“. So begann sie meist ihre Briefe einzuleiten. Sie endeten meist mit Elogen auf ihren Mann, diesem offenkundig einzigartigen „Vati“, der sogar in der Lage war, eine Hollywood-Schaukel für den Vorgarten zu bauen. Familien-Idylle aus einem Pseudo-Milieu, das mich nicht erreichen konnte oder auch sollte. Es waren frank und frei formulierte Fiktionen. Lebenslügen galt es vorzugaukeln und der Heimzensur vorzuführen.
Als der Bruch passierte, vergewisserte ich mich meines Willens. Schon oft hatte ich die Vorstellung zu verletzen. Ich fühlte mich zu schwach, und ich weiß um die Unbedingtheit und um das Unwiederbringliche dieses Schrittes.
Tage habe ich an Formulierungen gefeilt, Worte gedreht, gewendet, verworfen – neu platziert. Ich konnte noch nicht ahnen, dass ich überhaupt so etwas wie ein Selbstbewusstsein hatte. Mit dem Heim als Refugium im Hintergrund fühlte ich plötzlich ungeahnte Stärke, einen neu entdeckten Überlebenswillen. Jedenfalls sicherlich am 9. März 1963, an dem ich Mutters Offerte widerstand. „Ich war sehr überrascht, dass ihr mich übers Wochenende eingeladen habt. Leider muss ich euch sagen, dass ich nicht kommen möchte. Einfach aus dem Grunde, weil wir sehr verschiedene Ansichten haben und das geht nicht gut. Außerdem bin ich für euch ja sowieso ein ‚Rüpel‘. Es wird euch keine Freude machen, mit mir zusammen zu sein. Einmal sagen wir uns so oder so die Meinung. Vater hat das ja schon brüllend und um sich schlagend in den Weihnachtsferien getan.“ Meine Antwort kommt verspätet, aber sie kommt.
„Du hast diesen Mann geheiratet, und Du ganz allein musst dafür aufkommen. Du hast mich beizeiten ins Heim gesteckt. Ich als Dein Sohn möchte mit diesen Krächen nichts mehr zu tun haben. Wir sehen ja immer wieder, wir sind nicht fähig, ein geordnetes Familienleben zu organisieren. Es besteht nur Misstrauen. Es hat gar keinen Sinn, dass ich zu euch nach Emden zurückkehre. Bitte rege Dich nicht auf. Du schadest dir nur selbst.“
Geschrieben an meine Familie, die mich ausgesetzt hat, weil das zu lebende Leben eine Ausnahme blieb, und die Hamburger Bild-Zeitung die einzige Hauptlektüre war.
Naheliegend, ja geradezu zwangsläufig, folgte mein Wortschatz den Tag für Tag gehörten Kalenderphrasen einer unbewohnten Sprache. Altklug kamen meine gestanzten, nachgeplapperten Sätze daher, „weil eben nicht aller Tage Abend ist“. Vornehmlich „hat die Morgenstunde Gold im Mund“, auch wenn es „in der Schule hart auf hart zur Sache geht“ Es wurden Briefe geschrieben, in denen sich der „Ernst des Lebens“ darin bewahrheitete, „weil der kluge Mann vorbaute; vielleicht auch deshalb, weil „auch beim Fußball der Ball rund ist und wie im Leben immer weiter rollt“. – Heimerziehung.
Heimzensorinnen waren mit Scheren und Brieföffner bewaffnete Damen. Sie begutachteten jede Zeile, jedes noch winzige Schokoladen-Paket. Sie bestimmten, wie die an die Heimkinder adressierte Wirklichkeit auszusehen hatte. Was ihnen bedenklich erschien, wurde aus der Korrespondenz herausgeschnitten oder mit Filzstiften unleserlich übermalt. Vierteljährlich galt es den Aufsichtsbehörden aus Heimleitung und Jugendamt bei außergewöhnlich „abnormen Verhalten“ Mitteilung zu machen. Als Belege wurden sodann konfiszierte Briefe und Pakete aus der Asservatenkammer herbeigeholt – zur Beweiserhebung wie in einem Gerichtsverfahren.