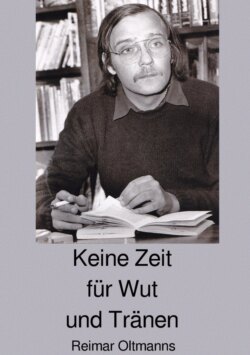Читать книгу Keine Zeit für Wut und Tränen - Reimar Oltmanns - Страница 9
Bei Hitlers am Küchentisch - Zu Hause im Hauptzollamt in Emden/Ostfriesland
ОглавлениеDie schönste List Des Teufels ist es, Uns zu überzeugen, Dass es ihn nicht gibt.
Charles Baudelaire (*1821+1867) Französischer Lyriker und Wegbereiter der europäischen literarischen Moderne
Scharfer Wind wird vom Westen über die Nordsee-Küste fegen. Es wird ein Freitag sein. Der Gestank von Fischmehl, vom Vollhering, weht von dem Trawler des Alten Heringshafens durch die Straßen, folgt den Menschen unablässig überall hin. Bei solchen Windverhältnissen heißt es ein- und auszuatmen – den „Emder Matjes“: tagein, tagaus immer derselbe Geruch. Emden in Ostfriesland, die Deiche der Nordsee, die mich sieben Jahre durch meine Kindheit begleiteten, wirken auf den Neuankömmling wie platt gedrückt unter der Vehemenz des Windes. Er ist mächtig, allgegenwärtig, ohrbetäubend. Er vergreift sich an allem, so will es scheinen, was übers Gras hinauswächst.
Der Leuchtturm Emden West Mole steht auf der im Jahre 1899 gebauten Einfahrt in den Emder Außenhafen. Der sechs Meter hohe Lichtmast signalisiert als Molen Feuer den Schiffen ihren Standort, um sicher ihren Landeplatz zu erreichen.
Samstag für Sonnabend, oft Sonntag für Sonntag verbrachte ich an diesem kleinen, achteckigen, roten Leuchtturm mit seiner spitzen, roten Kuppel. Er stand auf einem achteckigen, drei Meter hohen Sandsteinsockel. Hier auf dem Laufsteg der West Mole, ganz dicht an „meinem Leuchtturm“, habe ich in meinen frühen Jahren Stunde‘ um Stunde‘ – insgesamt vielleicht Monate – gesessen, beobachtet, gelesen, Selbstgesprächen geführt, zugehört. – Unvergessen.
Meine Blicke waren stets auf die aus- wie einlaufende Schiffe mit ihren schwergewichtigen Bruttoregistertonnen gerichtet. Ob es Fernweh war, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Es faszinierte mich jedenfalls, solch ein Koloss zu Wasser auf die Meere hinaus tuckern zu sehen. Es hatte etwas Erhabenes, Beruhigendes – Anmut. Bedächtigkeit. Wenn mal gerade kein Frachter oder Tanker in Sicht war, richteten sich meine Augen auf das gegenüberliegende Holland. Es schien nah, sehr nah. Und doch waren die Niederlande fern, jedenfalls für mich.
Ernüchterung: In diesen Jahren kennt jedenfalls das kleine Leuchttürmchen kein Mensch mehr. Er fristet als Auslaufmodell auf dem zugesperrten Werksgelände der Volkswagen AG ein Schattendasein. Das ursprüngliche Laternenhaus wurde abmontiert. Es schmückt nunmehr die Emder Innenstadt – als Touristenattraktion versteht sich.
Erinnerungsbilder aus meiner Kindheit, die sich tief in mein Gedächtnis eingegraben haben, verlieren sich in der Gegenwart ins Unkenntliche. Trostlos verlassen – wie leblose Raumstationen – dümpeln die einst sagenumwobenen Sehnsuchtsplätze zwischen Land und Meer vor sich dahin – auch Leuchttürme genannt.
Auf meist um die 126 Stufen einer gusseisernen, knatschenden Wendeltreppe kletterte ich früher hinauf zur Aussichtsplattform. Dort verliefen sich meine Blicke in der unendlichen Weite des Meeres zwischen Ankommen und Abfahren, suchten immer und immer wieder nach einem Fix-Punkt. Das war vor Jahren, Jahrzehnten. Heute kauert kein einsamer Wärter mehr dort droben. Drei Sekunden an, drei Sekunden aus. Drei hell, drei dunkel. Eine Stunde vor Sonnenuntergang begann es, eine Stunde nach Sonnenaufgang endete es. Leuchtturmwärter sind nach 200 Jahren wieder Geschichte.
Der Mythos von diesen Kathedralen der Meere wich einer exakt berechenbaren High-Tech-Satelliten-Navigation. Wehmut. Nur Dünen und Meer, kleine windschiefe Häuser, schmucke Villen auf den ostfriesischen Inseln und prachtvolle Kur-Kliniken aus der Kaiserzeit (1871-1918) überlebten einstweilen – noch. Aus Kapitänen wurden in der Neuzeit Assistenten von Standesbeamten, wenn es um Eheschließungen 20 Meter über der Erde, kurz unter den Wolken ging. Hoffnung. Kitsch, Hochzeits-Zirkus im digitalen Zeitalter, der sich in der Vierfarb-Tiefdruck-Reklame „Romantik pur“ nennen darf.
Immerhin: einmal durfte ich auf meinen „alten Tagen“ noch auf einen Leuchtturm klettern, in die Ferne der Meere blinzeln. Meine weitaus jüngere Halb-Schwester Susanne Wegner, Mutter mit vier Kindern im Gepäck, riskierte vor dem pensionierten Kapitän Wilfried Eberhardt ihren zweiten Ehe-Versuch. Das Leben besteht halt aus Wiederholungen. Sie gab sich mit ihrem Maik, 40 Meter über der Erde auf dem rot-weiß geringelten Leuchtturm zu Pellworm das Ja-Wort. Nach der Trauung klirrten Schampus Gläser und raschelten mitgebrachte Fischstäbchen in aller Höhe. Wieder auf der Erde ging es unter am Strand barfuß ins Watt – und dann begleiteten Oldie-Lieder etwa vom britischen Popsänger James Blunt („rain and tears are the same, But in the sun you’ve got to play the same“ – Regen und Tränen sind dasselbe) die beiden in ein neues „Liebes-Zeitalter“; Krabbenbrötchen, ein Schluck Schnaps mit Treueschwur im sterilen Dorfkneipen-Milieu inbegriffen.
Ortswechsel, zurück in meine Kindheit: Das 1901 erbaute und im markanten norwegischen Stil gehaltene Empfangsgebäude der Hafenbahn Emden-Außenhafen wurde für anonyme Wellblechhütten mit seinen allgegenwärtigen Fritten-Buden niedergewalzt; dort wo Reisende, meist kinderreiche Familien zur Insel Borkum eine Verschnaufpause einlegen konnten, gibt’s keine kostenfreien Sitzbänke mehr. Wenn die Architektur der Jahre ein Ausdruck ihre Identität ist, dann hier – austauschbar, identitätslos, unnahbar. Hier singt keine Lolita mehr, „Seemann lass das Träumen“. Hier deprimieren ramponierte Sitzlandschaften und holzverkleidete Wände, auf dem der Hinweis steht: unverzüglich die Fahrausweise beim Bordkassierer lösen. Na denn mal los. Irgendwie klingt es nach Billigheimer, riecht es nach Ausverkauf.
In meinen jungen Jahren heulten jedenfalls die Werkssirene der Nordseewerke zum Pausenende – wie ehedem seit Jahrzehnten. Etwa 550 Schiffe wurden hier seit 1905 gebaut oder auch repariert. Damals galt ein 70 Meter hoher Bock Kran als unverkennbares Wahrzeichen dieser Stadt. Damals und heute? Dumpinglöhne aus Fernost sorgten dafür, dass im Hafen Werften dem Schrott überlassen wurden. Ausverkauf. Überall wie nirgends – ohne Antrieb und Fracht dümpeln Schiffe in den Häfen. Für Notbesatzungen bleiben nur Routine- oder Wachaufgaben zu bewältigen. Wenn Seeleute Abwechslung suchen, bevölkern sie naheliegende Bordelle und verkriechen sich hinterher in ihrer Seemannsmission. Rausch ausschlafen.
Adventszeit in der Seehafenstadt Emden. Das Rathaus am Delft, die große Kirche der Protestanten oder auch das Krankenhaus – bis auf die Grundmauern steht nichts mehr, mithin der Erde gleichgemacht. Emden lag im Zweiten Weltkrieg im Einflugkorridor der alliierten Luftstreitkräfte. 94 Luftangriffe, 1.500 Sprengbomben, 10.000 Brandbomben und 3.000 Phosphorbomben. Fünfhundert Jahre Baugeschichte der Stadt gingen in Flammen auf. Bei Kriegsende zählte die Stadt mit ihren etwa 50.000 Menschen zu den am meisten zerstörten Orten in ganz Europa. Trümmerlandschaften.
Aber schon wenige Jahre später wirkt alles erstaunlich sauber, penibel aufgeräumt. Akkurat flimmern winzige Glühbirnchen an Straßen-Girlanden, zum Verkauf anstehende Weihnachtsbäumen zieren so manchen Luftschutzbunker – in Schräglage. Auf den Fremden wirken die noch verbliebenen 31 Betonklötze in ihrer städtebaulichen Dominanz wie schnörkellose „Zukunftsattrappen“ einer neuen „Schöner-Wohnen-Kultur“. Galgenhumor lebt in einer Gegend, in der raue Böen und nasskaltes Wetter nahtlos in Sturmfluten übergehen. Ostfriesland.
Ein demolierter, vom Rost angefressener Möbeltransporter aus den letzten Kriegsjahren brachte mich am 14. Dezember 1956 mit wenigen Habseligkeiten von einer Grenze zur anderen; von der innerdeutschen Grenze des Zonenrandstädtchens Schöningen an die am Dollart gelegene deutsch-holländische Grenze des ostfriesischen Städtchens Emden. Mein winziger Kinder-Schreibtisch, Transistorradio, Schrank, Bett, Steinbaukasten und rote Schaffnermütze sollten mich begleiten, vorerst noch. Ich konnte nicht ahnen, dass mit diesem Umzug für mich als siebenjähriger Junge ein einschneidender, auch traumatischer Lebensabschnitt begann. Es waren wenige Jahre der Grenzüberschreitungen, der Grenzverluste, Schmerzgrenzen, Höllenängste.
Emden in jenen Jahren durchlebte vom Sturmtief begleitete Aggressionswellen nach außen wie innen. Wenig, fast nichts, blieb im Innenleben der Stadt übrig, etwa von der hinlänglich besungenen Seefahrer-Romantik eines Freddy Quinn, dem Nationaldenkmal am Dollart. In Hafen-Bars und Spelunken leierten die Musikboxen bis zum geht nicht mehr seinen Gassenhauer: „So schön war die Zeit / Hört mich an, ihr goldenen Sterne / Grüßt die Lieben in der Ferne.“
Jeder fühlte sich irgendwie und irgendwo verkannt, glaubte etwas Besonderes zu sein. Nach Schicksal roch es fast überall. Schicksalsschläge lauerten in so manchen Ecken. Nahezu alle hofften auf Seelenmassage. Es bedurfte nicht viel, aus welchen nichtigen Anlässen auch immer, flogen die Fäuste, ging das Inventar zu Bruch – Krankenwagen. Notaufnahme. „Nostalgie“, formulierte der französische Sänger Charles Aznavour, „ist die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, in der man nichts zu lachen hatte“.
Die Kneipen waren dreckig und verrucht, Schiffsbilder, Wimpel, Fischkarten klebten an den Wänden im „Goldenen Anker“ in Hafen-Nähe wie eh und je. Der Leitspruch an der Theke unübersehbar: „Wer Geld hat, hat gute Laune und lässt sich vollsaufen, wer keines hat, erst recht.“ Die Augen des Wirtes Dieter waren glasig, seine Haut blass, seine Haare fettig strähnig, Bartstoppeln – fern der Heimat. „Was willst du Lottel denn hier“ stammelte Dieter mir zu. Na klar, die Stimmung im „Goldenen Anker“ war so schlecht wie die Luft. Da drückte Dieter mal eben die Taste F4 seines Leierkastens mit Lale Andersen (*1905+1972) Wieder war Lili Marleen unter uns. Bis zum geht nicht mehr. Immer nur Lale, Lale und nochmals Lale in einem fort.
Meine Aufmerksamkeit dort draußen am Borkum-Kai galt einem spröden abweisenden Klinkerbau – dem Seemannsheim, dem Wohnzimmer für Fremde aller Länder. Hier war ständiges Kommen und Gehen wie in einem Durchlauferhitzer, der viele Sprachen kannte. In Zahlen: 6.000 Übernachtungen, 773 Tagesgäste, exakt 51 Gottesdienste mit 700 Besuchern im Jahr. Ich lernte sehr schnell, dass hier Seeleute aus 40 Nationen eine Zwischenrast einlegten; auf ein neues Schiff warteten oder gar ihren Lebensabend lebten. In Wirklichkeit aber verdichtete sich diese Unterkunft zu einem Refugium für Seemänner, die nirgendwo an Land ein Zuhause finden konnten. Wenn sie nicht auf See waren, blieben sie heimatlos; oft an Land wurden sie auch krank und standen ohne Arbeit da.
Ich fühlte mich hingezogen zu Waldemar, einem großen kräftigen Mann, der häufig auf der Parkbank neben dem Haupteingang hockte. Freundlich war er. Er suchte mit mir, dem Pimpf, Gesprächskontakt. Verlorenheit. Frührentner war er, als Schiffkoch unterwegs, fünfundzwanzig Jahre auf den Meeren lagen hinter ihm. Mit 64 Jahren fand Waldemar kein Schiff mehr – trotz großer Kajüten Erfahrung. Erst gab es Arbeitslosengeld, dann Frührente. Was blieb, das sind Erinnerungen an längst verblichene Augenblicke bei hohem Seegang. Waldemar sagt: „Wer einmal draußen war, im Sturm sein Ende ins Auge geschaut hat, der will etwa den Streit an Land um die Höhe einer Hecke am Eigenheim nicht mehr verstehen. Dann fahre ich lieber zur See.“ – Einzelgänger Waldemar, ein Aussteiger eigenen Zuschnitts.
Und die Gegenwart? Das sind Kartenspiele Tag für Tag im kahlen Aufenthaltssaal des Heims; einer Bude mit Bett, Tisch, Stuhl, Schrank, ein großes Fenster und einen kleinen Schlüssel für sein persönliches Fach in der Küche. Hin und wieder übermannt ihn der Suff, hin und wieder Barbeleuchtung mit Weiber, ausnahmslos ein und dieselbe Lebensgeschichte. Erzählt wird jeden Abend, sieben Mal in der Woche. Das Leben verträgt viele Wiederholungen. Sicher trägt er eine Vorahnung von seinem Tod in sich – an die Urnenversenkung irgendwo draußen auf See. Das hat Waldemar jedenfalls beizeiten testamentarisch verfügt.
Waldemar hatte schon vielen seiner Kameraden geholfen, erlebte auch notgedrungen, wie einige seiner Mitbewohner regelrecht „vor die Hunde“ gingen. Seeleute im Seemannsheim, die täglich bis zu zwei Litern klaren Schnaps in sich hineingossen. Pförtnerloge ging zu Bruch, Haustüre zerdeppert, Heimleiter verprügelt, Fenster im Speisesaal eingeworfen; dreimal sauste eine volle Bierflasche direkt an Waldemars Kopf vorbei.
„In Aurich“, sagt der Volksmund, „ist es traurig, in Norden ist es besser, in Emden gibt es Menschenfresser“, sangen wir als Kinder auf Ostfrieslands Straßen recht keck. Wir spürten schon zerrissene, grau belegte Zustände in dieser Gegend. Es waren Befindlichkeiten, Stimmungen der Erwachsenen, die sich auf uns übertragen hatten. Ja, es war schon die Wut nach innen, nein auch die verbitterte Ohnmacht nach außen. Die Gemüter schienen auf irgendeine Weise angerempelt.
Es waren sorgsam von Männern diktierte Tages- wie Freizeitabläufe. Sie bestimmten Gut wie Böse, Oben wie Unten – schreiben Laune und Lebensatmosphäre vor. Der Zeitgeist des fünfziger Jahrzehnts im vorherigen Jahrhundert quetschte sich allenfalls in kurzatmige Polizeiberichte. Mehr nicht, jedenfalls in Emden. Handgreiflichkeiten in Familien wurden totgeschwiegen. Hieß es doch beschwichtigend: „Ein richtiger Schlag zur rechten Zeit, schafft wieder Ruhe und Gemütlichkeit.“
Jeder hatte darauf zu achten, nicht zu den Zukurzgekommenen zu zählen. Eine Hab-Acht-Stellung, die so manche Familien ihrer Bitterkeit und Grobschlächtigkeit überließ. Nahezu die gesamte Stadt wachte über Lebensstandard und Lebensart ihrer Einwohner, von Nachbar zu Nachbar, von Eintopf zu Eintopf. Hier nistete sich ein Klima des lähmenden Misstrauens ein, in dem die Denunziationen unvermutet auflebten. Der Überwachungsstaat und seine Folgen.
Im Städtchen Aurich (40.000 Einwohner) sorgte die Neueinstellung eines „Sozialdetektivs“ (zu Deutsch Schnüffler) dazu, 717.768 Euro Hartz-IV-Gelder nicht ausgezahlt worden sind22. Bei derlei Ansporn war es auch kaum verwunderlich, dass es den Behörden-Kollegen auch in Emden immer wieder gelang, bei den Ärmsten der Armen Hartz-IV-Missbräuche aufzuspüren. Allein in einem Jahr wurden 3.210 Personen überprüft – mit der Folge, dass gleichfalls in der Hafenstadt 320.000 Euro zu viel an Stütze gezahlt worden ist.23
Gewalt gegenüber Frauen, Gewalt gegenüber Kindern – das war der Normalfall, ein Randthema, allenfalls eine Marginalie, fast eine familiäre Selbstverständlichkeit. Aber auch Gewalt unter Schülern. Dort, wo die Söhne mit stets wiederkehrenden Schlägereien ihren Vätern nacheiferten; in der zwischen Bunkern und Bombentrichtern gelegenen Emsschule etwa. Die Gründe: Nichtigkeiten. Tristesse. Stellvertreter-Kriege.
Keine große Pause ohne ein „blaues Auge“, aufgerissene Lippen auf dem Schulhof der Emsschule in den fünfziger Jahren. Steinschleudern nahezu in jeder Schulklasse. Lehrer als Protokollanten für Haftpflicht-Versicherungen oder als Ringrichter für
Polizeiberichte. Kein Fußballspiel an der Kesselschleuse an Wochenenden zwischen den Erzrivalen „Stern“ und „SuS Spiel und Sport“ Emden, wo nicht spätestens in der zweiten Halbzeit die Fäuste flogen; nicht auf dem Schlacke-Spielplatz unter den Akteuren, sondern auf den Rängen zwischen den Zuschauern. – Stellvertreter-Kriege zwischen den Bewohnern vom Conrebbersweg und dem Bezirk Transvaal – dort, wo die sich Arbeiter mit knappen Auskommen eingerichtet hatten. Erst wurde angefeuert, gebrüllt, dann wurde geschlagen, feste drauf geprügelt. Ging es doch um letztendlich um ungelöste Frage der Gegenwart: um Zugehörigkeit, um Identifikation in Zeitläuften der Zerrissenheit. Der sonntägliche Bolzplatz als Reflex dafür, wenn Menschen in Krisen schlittern. Nachkriegszeiten, das blieben nicht nur Wiederaufbau-Legenden – das waren Wirtschaftskrisen, Vertrauenskrisen, Wertekrisen. Verlassenheitsmomente von Menschen, die sich im Stich gelassen fühlen, sich ängstigen, die Übersicht über ihr Leben zu verlieren. Damals wie heute immerfort. Am 25. März 1957 wird die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge durch die Gründerstaaten Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland mit dem Ziel einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik in den Grenzen Europas konstituiert. Zukunftsvision.
Bei den Einkäufen auf dem Bauernmarkt in Emden „zwischen den beiden Sielen“ an den Freitagen etwa fielen immer wieder mit Kopftüchern verkleidete Frauen auf. Es waren Mütter, die zudem ihre Augen mit Sonnenbrillen abzudecken wussten. Prügel-Opfer. Ein Stück verfrühter Orient, etwa drangsalierter Musliminnen in Deutschland? Verkehrte Welt. „Moin, moin, Jutta, jetzt auch Du? Wie geht es dir, alles wieder in Ordnung?“ fragte Turnerin Elsbeth besorgt vom Kneipp-Verein.
Meine Mutter schwieg, starrte auf den Kartoffelsack. Peinlich. Sie bedeutete nur, dass „das Leben ja weitergehen muss“. Geprügelt zu Hause nach dem Frühstück von ihrem Ehemann – kurz vor Dienstbeginn. Handkantenschlag. Oder es flogen wieder einmal Teetassen an die Wände. Geschirr wurde ohnehin nur noch in größeren Mengen im Versandhandel bestellt.
An diesem besagten Morgen hatte Jutta auch noch Besorgungen ihrer Bekannten auf dem Einkaufszettel. Frau Jensen, die eigentlich kontaktfreudige Lotsengattin aus der Cirkenastraße, wagte sich nicht mehr vor Türe, kauerte oft verstohlen hinterm Gardinenvorhang. Schamgefühl. Ein Auge war zugeschwollen, sie stotterte, weinte. Die Haustürschlüssel waren ihr abgenommen worden vom Kapitän zur See, ihrem Ehemann. Männer-Willkür, der das weibliche Geschlecht rechtlos ausgeliefert war.
Jutta mochte sie gerade in solch bedrückenden Stunden an den Missionar Gerhard Bergmann (*1914+1981) erinnern. Beeindruckend schien sie von seiner Evangelisation im Land der Ostfriesen in den sechziger Jahren. Zehn Abende ging Bergmann im überfüllen Missionszelt der Frage nach, „gibt es eine Hölle?“ Zehn Abende sang Jutta mit Leidensgenossinnen Jensen, Baumann, Heinrichs, Harken und Stumpf mit fester Stimme ein Halleluja. Einmal gelang es den Damen gar, ihre Männer dem Missionar vorzustellen. Dafür gab es hinterher Sekt und Sex – zu Hause versteht aus.
Schließlich hatte der Dr. Bergmann die Damen auf einen scheinbar „fatalen Reflex zwischen Ursache und Wirkung“ aufmerksam gemacht. Das „sexuelle Aushungern“ der Männer, also die Verweigerung der Frauen zum Beischlaf, verkehre die angestrebte Harmonie ins Gegenteil. Ablehnung, Distanz und oft vermittelte Gewalt folgen der Wollust. Wohlbedacht zitierte er den französischen Romancier Honoré de Balzac (*1599+1850). Balzac hatte in damaliger Epoche bereits viele Frauen an Willigkeit und Hingabe gegenüber dem Manne mahnend erinnert. „Das Bett ist das Barometer der Ehe.“
Jutta indes ging als Hausfrau hinter dem ostfriesischen Deich häufig in die Kurklinik Dr. Feldmann-Graefe in Bad Iburg am Rande des Teutoburger Waldes und auch nach Bad Lauterberg im Harz zu Dr. von Plachy. Atempause. Frauen-Urlaub. Jahr für Jahr hatte sie ihre Nerven zu regenerieren. In ihr wuchs die Sehnsucht nach Stille in einer zerbrechlichen Zeit, in der alltägliches Allerwelts-Geschrei ihres Ehemanns zunahm. Stille, sagte sie einmal, sei für sie mehr als die Abwesenheit von Geräuschen. Stille in einem Kurort waren auch Momente der Selbstvergessenheit.
Bekanntlich hat der Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud (*1856+1939), derlei Augenblicke als „wunschlose Glückseligkeit“ charakterisiert. Wer sich aber der Stille nicht hingeben mag und sich damit beruhigt, dass die innere Anspannung eines Tages nachlassen werde, liebäugelt mit dem Ur-Knall. Man hört auf, sich selbst zu spüren, sich selbst wahrzunehmen. Schematisch löst eine Angstwelle die nächste ab. Angst vorm Leben, Angst vor dem Tod, Angst vor den Menschen. Zusehends öfter schreckte Jutta des Nachts schweißgebadet hoch, hörte ihr Herz rasen. Selbstaufgabe.
Dessen ungeachtet gab es einen Mann, einen Berater, der seine Langmut geschmähten, geschundenen Frauen widmete. Es waren die Jahre X vor der Frauenbewegung, vor den Frauenhäusern. Er spendete Trost, gab Rat, mahnte zur Umsicht – eine Therapiestunde im Radio. Unter der Rufnummer „44 17 77 Hollander, guten Abend“ gab der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg krisenbewegten Menschen, vornehmlich Frauen, zwischen 1952 bis 1971 die Möglichkeit mit dem Lebensberater Walther von Hollander (*1892+1973) zu sprechen. Scheidung, Schulden, schwul, Prügel, Alkohol, Untreue, Sinnkrisen der Männer – kein Thema blieb unberührt.
Zweimal wöchentlich wurde gesendet; donnerstags von 21.05 bis 22 Uhr und sonntags von 17.30 bis 18.00 Uhr. Es waren die Stunden der Frauen – der Küsten-Frauen. Hießen die Mütter nun Gesine, Elvira, Jutta oder auch Waltraud – sie alle hockten vorm Radio und lauschten auf UKW dem Rundfunk-Therapeuten. Ventilfunktion, Nachdenklichkeit, Diskussionsstoff. Hollanders Art blieb ruhig, immer besonnen, die tiefe Stimme lud ein, sich Sinnkrisen und Nöten zu nähern.
Ein zaghafter Bewusstseinswandel zeichnete erste Konturen, was so viel bedeutete: ganz allmählich das Leben neu zu lernen. Das Leben nicht über andere, über die Männer zu definieren, eigene Bedürfnisse, eigene Interessen zu formieren. Fortschritt, 45 Jahre später: Immerhin gibt es seit November 1979 in Frauenhaus. Statistiken vervollständigen die Dramen. Über 1.100 Frauen und 1.250 Kinder suchten (1986-2006) Schutz, Beistand wie Hilfe. Das ist über Jahre gerechnet etwa jede fünfte Frau, die sich in Emden vor ihrem Mann auf der Flucht wähnte.
Emden und sein Hinterland, die Krummhörn, ist eine traditionelle Hochburg der Sozialdemokratie. Hier engagierte sich im 16. Jahrhundert der rechtsgelehrte Bürgermeister Johannes Althusius schon 150 Jahre vor Jean-Jacques Rousseau (*1712+1778) für die Volksdemokratie, hier organisierten Deicharbeiter im 18. Jahrhundert die ersten Streiks in Deutschland.
Beim konstruktiven Misstrauensvotum gegen den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt (1969-1974) im Sommern 1974 demonstrierten achttausend Arbeiter der Nordsee-Werke und der VW-Niederlassung in Emdens Innenstadt. „Wäre Brandt abgewählt worden“, sagte der frühere Betriebsratsvorsitzende Walter Gehlfuß, “hätten wir eine Revolution gemacht. Verständlich, dass in einer solchen auf die SPD eingestimmten Atmosphäre an der Nordsee-Küste, auch nur kleine Verrenkungen ihrer SPD-Prominenz wohlwollend registrieren wurden.
Aufgeregt und üppig eingeschenkt wusste jedenfalls die Emder Zeitung im Jahre 2005 davon zu berichten, dass Bundeskanzler Gerhard Schröder (1998-2005), sich gern für die heimatliche Presse aufmerksam seiner fünf Schwiegermütter erinnert. Im speziellen familiären Anliegen von Anneliese Taschenmacher, Frau Schröder die Zweite (1972-1974).
In einer kleinen Reihenhaus-Siedlung im Vorort Larrelt verbrachte Schröders zweite Schwiegermutter Alma mit 82 Jahren ihren Lebensabend. Naheliegend, dass Emdens Oberbürgermeister Alwin Brinkmann (1986-2011) Liebesgrüße mit Berliner Blumen direkt aus dem Kanzleramt überbrachte. Schließlich habe Gerhard in den siebziger Jahren bei den Taschenmachers Nächte hindurch den Ostfriesen-Skat gespielt.
Des Morgens in aller Früh ist er gleich „mit unserer Anne“ an den Deich gegangen. „Da sollen sie immer stur in Richtung Holland geglotzt haben, Leuchttürme auf holländischen Landzungen mit dem Fernglas beobachtend. Ja, ja“, schmunzelte Ex-Schwiegermutter Alma ein wenig Gedanken verloren, „das ist aber wirklich nicht der erste Schröder-Gruß gewesen.“ Einmal, erzählte sie plötzlich ungefragt, habe sie einen ganz langen Brief aus privatem Anlass (Scheidung) auch schon mal von Schröder bekommen. Der kam allerdings nicht aus Berlin, sondern noch aus Hannover. Denn da war „der Gerhard mal niedersächsischer Ministerpräsident und so.“ (1990-1998). Schneller Abgang. Leises Ende. Schröder-Jahre.
Weite Flure, auf denen es streng nach Linoleum roch – das wurde mein Zuhause. Das Hauptzollamt zu Emden, ein moderner, zweistöckiger roter Klinker-Neubau, lag in der Ringstraße. Waffenkammer, Fahnenmast, Verladerampe für Güterkontrollen, Zollhunde, Peilsender für Zollboote an der Küste, 28 Diensträume. Uniformzwang für Hinz und Kunz. Viele Stiefel schleiften Tag um Tag die Flure. Kaserne. Vater Staat.
Nur an Wochenenden wurde es auf den Fluren des Zolls mucksmäuschenstill. Das war die Stunde des Wachtmeisters – Connys Zeit oder auch Hitlers Wunschkonzert. Es hallte höllisch auf den Gängen, wenn der Wachtmeister mit Naziliedern der Gegenwart trotzte. Da lag er nicht nur mit der Pest vor Madagaskar. Auch formierte er mit seinen „Brüdern die Kolonnen“ an den Frontabschnitten oder bejubelte den „schönen Westerwald“. Nein, „Antje mein blondes Kind“ stellte er singend die Frage, „was ist der Tod, wo unsere Fahne weht?“ Sehnsucht nach Hitler.
Wenn Wachtmeister Conny von Hitler sprach, sprach er mit tiefempfundener Rührung von einer großen epochalen Zeit, in die er, ausgerechnet er, der Conny, hineingeboren worden war. Ein feuchter Film verdichtete ganz plötzlich unvermutet seine Netzhäute. Er war eben doch nicht der ewige Popanz, sondern ein im angegrauten Arbeitskittel versteckter Staatsbeamter, der tagein, tagaus die Behörden-Mülleimer zu entleeren hatte. „Nein“, räsoniert er, „der Führer hätte nur nicht an so vielen Fronten gleichzeitig kämpfen müssen. Dann wäre Europa jetzt unser. Ein Jammer, dass wir den Krieg verloren haben. Sonst wären wir das Herrenvolk, Weltmacht geworden“, murmelte er und schob an diesem Morgen den dritten Mülleimer an den Straßenrand. Jahr um Jahr. Verdruss.
Freizeit oder gar Hobbys, die hatte er nicht, kannte er auch nicht. Wenn man einmal von seinen nächtlichen Angel-Ausflügen zum Wochenende im Fischerei-Hafen absah. Da stand er dann am Sonntagmorgen mit einer klatschnassen Reuse voller Aale im Korridor und strahlte über alle notdürftig geflickten Zahnstifte. Mutter hatte sofort Wasser in die Badewanne einzulassen. Aal-Tage. Jeden Tag gab’s Aal zu Mittag. Immer wieder Aal.
Es war ein Leben aus Sparsamkeit und Verzicht, ein Alltag aus Sonderangeboten mit Graupensuppe und fein geschnittener Speckschwarte und tranchierter Haut natürlich vom gekochten Aal. Es wurde „gegessen, was auf den Tisch kommt“. Vorsorglich hatte er gleich rechts neben seinem reservierten Frontplatz am Küchentisch einen elastischen Bambus-Stock griffbereit positioniert.
Wenn ich den Arm beim Essen nicht hob, bekam ich einen kurzen Schlag auf den Kopf. Halb verschluckt, immer Angst. Wenn ich mich an die Wand lehnte, wurden mir so zielsicher die Ohren umgedreht, bis ich in die Knie ging. „Krüppel“ nannte er mich, weil mein Brustkorb nicht dem Umfang eines Jungen meines Alters entsprach. Wenn ich es wagte, Widerworte auszusprechen, flog mein Kopf gegen die Wand.
Das Gebot der Kinder-Jahre im ostfriesischen Emden hieß nun einmal. „Ein deutscher Junge weint nicht“. Ich weinte aber viel, sehr viel. Deshalb hatte er ja auch einen knappen Satz auf meinem Schultornister festgeklebt: „Ich bin eine Memme“, stand da in großen Lettern gepinselt. Auch Mutter Jutta befand, ihr Junge sei „verweichlicht“, er müsse „abgehärtet werden“. „Dieser Bengel“ hätte es mit ihr allein in seinen Kinderjahren zu Schöningen viel zu gutgehabt. Er sei eben durch und durch „verhätschelt“ worden.
Bücher, auch Kinder-Bücher, Gesprächs-Anregungen, Schalk und Spiel, die gab es beim Zollwachtmeister keine. Ebbe. Wie sollte es auch, die hatte es in seiner Familie nicht gegeben. Fremdkörper. Dafür fehlte es an Witz, Humor, Gelassenheit. Es war und blieb achtloses Accessoires aus einem gänzlich unergründeten Milieu, die aus gegebenen Anlässen mal hervorgekramt wurden. So verirrte sich ein Bildband gelegentlich auf den Küchentisch, der da bedeutungsvoll besagte: Deutschland, „ein deutscher Mythos – wie wir 1954 Weltmeister wurden“. Sonst diktierte die Bild-Zeitung Befindlichkeit und Stallgeruch schon zu den Mahlzeiten.
Wie selbstverständlich vertiefte der Wachtmeister sich in die Gedankenwelt schwarzer Großbuchstaben; Pflichtlektüre am Mittagstisch. Tag für Tag die Bild-Zeitung. Immer und immer wieder die Bild-Zeitung. Kein Entkommen.
Es waren „Kopf-ab-Stories“ aus halbseitigem Milieu, die fortwährende
Faszination, auch Abscheu-Instinkte, die einen stets wiederkehrenden Kitzel freisetzten. Ob da nun laut Bild-Zeitung „endlich ein Mädchen-Mörder“ dingfest gemacht werden konnte, oder auch nicht. Nur solche knallig aufgemachten nicht selten erfundenen Geschichten ließen den Atem bei vollem Munde stocken; selbst wenn ein Vorfall sich im fernen Kentucky ereignet haben sollte. Bildungsfern, bildungsfeindlich
In Deutschland, einem der reichsten und aufgeklärtesten Länder der Erde, einer Nation mit einer ansonsten feinsinnigen Kultur der Rechtsstaatlichkeit, gilt für die Kindererziehung expressis verbis die Mentalität des Rechts der Germanen etwa 120 Jahre vor Christus. Fernab vom Bürgerlichen Gesetzbuch dieser Jahre hatte bei den Germanen der Vater die Straf- und Zuchtgewalt gegenüber seinen Zöglingen.
Er konnte über Leben und Tod willkürlich entscheiden. Er hatte das Recht, sie nach der Geburt auszusetzen, sie zu verstoßen, zu verknechten, zu töten. Erst mit dem Übergang von der Groß- zur Individualfamilie sollte sich das grauenvolle Gewaltverhältnis ändern, schrieb die ehemals profilierte Gerichtsmedizinerin Elisabeth Trube-Becker (*1919+2012). Zeit ihres Lebens blieb die Wissenschaftlerin eine Vorkämpferin für Menschenrechte der Kinder. Sie sah ihre Aufgabe darin, Dunkelfelder der Kindesmisshandlungen auszuleuchten.
Tatort im Hauptzollamt war nicht selten der Kohlenkeller, abgedunkelt, nicht einsehbar, durch die Koksberge fast schalldicht. Ein Refugium, nahezu ideal für Kindesmisshandlungen. Immer wieder schlug Stiefvater Conny auf mich mit geballten Fäusten ein. Reizbarkeit, schnelle unkontrollierte, abrupte Wutausbrüche, Unbeherrschtheit. Die Gründe waren austauschbar, Nichtigkeiten. Immer wieder stieß er meinen Kopf gegen die vom Kohlenstaub schwarze Wand, riss den scheinbar leblosen Körper empor – schleuderte ihn mit aller Kraft auf einen Kokshaufen. Er fauchte: „Wenn du willst, kannste noch mehr haben, du Krüppel“
Es waren Beschimpfungen, Gewaltausbrüche, Kopfverletzungen, Todesängste, die wie eingebrannt aus meinen düsteren Erinnerungen abzurufen sind, mich begleiten. Bewusstlos lag ich da auf dem zu verfeuernden Koks. Augen zugeschwollen, Lippen aufgeplatzt. Was war nur geschehen? Der Junge hatte gewagt, seinem von Angst einflößenden Jähzorn befallenen Stiefvater zu widersprechen. Er wollte am frühen Abend zum Training der Jugend-Mannschaft seines Fußballvereins Kickers Emden statt den Rasen der Zöllner zu mähen.
Nachdem ich wieder zu mir gekommen war, quetschte ich mich mit blutigem Gesicht, aufgeschlagenen Lippen und schmerzenden Körper durch eine Kellerluke. Ich flüchtete aus dem Elternhaus. Ich rannte durch die halbe Stadt zu meinem Klassenlehrer Gerhard Dengler. Ich redete und weinte. Doch auch dieser eher schmächtige Pädagoge verspürte Angst, gleichsam Schläge von meinem Stiefvater zu kassieren. Er war gerade erst aus dem Hörsaal der Pädagogischen Hochschule in Göttingen entlassen, an die Küste geschickt worden; Junglehrer-Landverschickung für zwei Jahre.
Dengler brachte mich jedenfalls nach Hause zurück. Er beschwichtigte mich, fragte nach meinen Missetaten und bestärkte von Angesicht zu Angesicht, den väterlichen Gewalttäter in seinem „Erziehungsauftrag“ – ganz nach der Allerweltfloskel „eine Ohrfeige habe noch niemanden geschadet“. Aus dem landläufigen Bewusstsein war und ist noch immer der „berühmte Kinderklaps“ nicht rauszukriegen. Für ihn, den Klassenlehrer, jedenfalls war mein Notruf damit abgetan. „Sonst bei einer offiziellen Schulintervention“, so Gerhard Dengler später, „hätte ich wohl möglich auch noch mehr heimliche Kloppe bezogen“. Er gab mir noch den Hinweis, dass er ein „Pädagoge“ und kein „Polizeikommando“ sei. Hilflosigkeit.
Meine Mutter freilich wollte schon ihren Ehemann zur Rede stellen. Auf erregte Fragen bekam sie Antworten – Prügel-Antworten. Wieder erhob er seine Pranken, wieder setzte es Hiebe auf die Backen – dieses Mal gleich in einem Aufwasch Frau wie Kind. Sie kassierte oft Ohrfeigen, ohne Ansatz, ohne Vorgeplänkel, einfach nur so; die Hiebe waren einfach nicht auszumachen wie aus heiterem Himmel. Sie sagte auch nichts, schminkte sich bunt. Wie ein kleiner Tuschkasten zog des Weges durch die Hafenstadt, die zufällig Emden hieß.
Es ist hinreichend verbrieft, dass Eltern und Erziehungsberechtigte versuchen, bei Verletzungen durch Misshandlungen Ärzte und Ämter zu täuschen, zu belügen. Es werden die raffiniertesten Mittel benutzt. Schwere Blessuren werden als Sturz von der Treppe, vom Stuhl oder Fallen auf den Fußboden gedeutet. Empfindliche Verbrennungen und auch Erfrierungen lassen sich mit unglücklichem Zufall, entschuldbarem Irrtum oder eigenem Verschulden des Kindes erklären. Es sind Fälle bekannt geworden, in denen Kinder während einiger Monate mehrfach mit Gewaltspuren jeweils in eine andere Klinik eingewiesen wurden. Die eigentlichen Ursachen wurden in den seltensten Fällen ans Tageslicht der Öffentlichkeit geholt. Schweigen.
Angstträume begleiteten mich in den Nächten, rissen mich aus dem Schlaf. Entweder sollte ich getötet werden oder ich hatte jemanden umgebracht. Stets wähnte ich mich auf der Flucht ganz sicher vor unverarbeiteter Drangsal des Tages, traumatischer oder traumatisierenden Gewalterlebnissen. Ich kletterte auf den Fenstersims und schrie in die Tiefe der Nacht – bis Nachbarn von der gegenüberliegenden Häuserseite klingelten. Ich schlug mit der Faust, die Scheibe von der Korridortür ein, blutete, konnte mich nicht wieder beruhigen. Negative Gefühle, Angst und Panik, auch Wahn. Spielten in solch furchtbaren Nächten Pingpong mit mir. Ich rief meist meine Mutter um Hilfe. Wenn sie kam – mir nahe war, wehrte ich mich, fühlte ich mich auch von ihr bedroht.
In meinen jungen Jahren verabreichten mir Ärzteschaften ein ganzes Arsenal Beruhigungshämmer, auch Psychopharmaka; von Belladenal Tabletten bis Megaphen-Tropfen und immer wieder die Adumbran-Tranquilizer. Tag für Tag ein oft teilnahmsloses Leben im Namen der Ruhe, Beruhigung. Abgeschaltet, stillgestanden. Jahr für Jahr suchte ich nach Verstecken; entweder im Kleiderschrank meiner Mutter oder unter den Tischreihen des Zolls im großen Sitzungssaal; Hauptsache unentdeckt bleiben.
Gern fuhr ich mit meinem Tretroller in den Außenhafen. Meist saß ich auf dem Kai, der zur Mole führte viele Stunden. Weitläufige Blicke. Ich schaute auslaufenden Schiffen nach irgendwo hinterher. Ich stellte mir das Leben an Bord vor und erzählte mir frei erfundene Geschichten. Ich war bei mir angekommen. Vorbei zog gerade ein vom Rost befallenes Frachtschiff. Ich erinnere mich noch genau an seinen Namen „Blue Point New York“. Dort wollte ich hin. Dort sollte die Welt besser sein, dachte ich. Fernweh. Ich war zwar bei meiner Familie zu den Mahlzeiten an der Oberfläche noch präsent, vom inneren Verständnis her war ich längst aussortiert, abgeschoben. Ein Heilpraktiker konstatierte gar, dass ich durch Einnahme so vieler Medikamente „spätestens in einem halben Jahr durchgedreht wäre.“ Er verordnete stattdessen Bäder und Umschläge. Gebadet wurde freilich nur einmal wöchentlich. Beim Substantiv Umschläge blieben kurzerhand die ersten beiden Buchstaben auf der Strecke.
Verständlich, dass in den ersten Volksschulklassen meine „Bestnote“ ein ausreichend war. Verständlich auch, dass ich meiner Mutter aus ihrem Schreibtisch 50 Mark stahl. Am Schalter des Bahnhofs Emden-West löste ich eine Fahrkarte nach Hamm. Dort lebte ein junges Mädchen namens Ursula. Mit ihr – der schwarzhaarigen Ursula Raukohl – hatte ich im Frühling am Strand der Nordsee-Insel Borkum Volleyball gespielt. Ich war 11, sie 14 Jahre alt. Sie wollte ich wiedersehen, mit ihr alles teilen. Auf dem Bahnstieg 2 im westfälischen Rheine holten mich Bahnpolizisten mit festem Griff aus dem Zugabteil.
Ich rollte unter polizeilicher Beobachtung mit dem nächsten Eil-Zug zurück zur Bahnhofsbaracke Emden-West; über die Klappbrücke des Binnenhafens, vorbei an unwirtlich ergrautem Bunker-Beton und Wassertürmen, vorbei am Gestank des Heringshafens. Schiffssirenen heulten auf. Das taten sie immer, wenn ein KüMo (Küstenmotorschiff) um Einlass in den Binnenhafen bat, die Eisenbahn-Schienen diagonal die Lüfte kreuzten und die Schiffe passieren konnten. Keine 500 Meter Luftlinie von dieser Klappbrücken-Konstruktion lag „mein Zuhause“.
Dorthin hatte ich mich wieder einzufinden. Wo „der Krüppel“, wie ich ja nun einmal hieß, weiter mit Fäusten oder auch Lederriemen die Zuwendung des Stiefvaters erfuhr. All das geschah nicht etwa zufällig. Es passierte ausgesucht auf den nach Linoleum riechenden glatten Fluren des Hauptzollamtes; vorzugsweise an dienstfreien Wochenenden. Fürsorgepflicht? Kindesmisshandlung.
Die Moral der jungen Jahre: Die Familie-Misere galt es nicht zu hinterfragen. Ich allein war der sogenannte „Symptomträger“ von Gewalt und Zerrüttung. Ich war die Ursache, war ja letztendlich „krank, geisteskrank“. Ich war der Sprengsatz, ein „Sündenbock“, eben ein Störenfried, der eigentlich einer intakten Familienharmonie aus Bier- und Doornkaat Flaschen sein Gleichgewicht nahm.
Ich hingegen spürte nur einen Wunsch, den dumpfen Stiefelschritten des Zöllners zu entkommen. Egal wohin – nur raus aus den Klauen elterlicher Gewalt. Seinerzeit konnte ich natürlich nicht wissen, dass nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes etwa 1,42 Millionen Kinder24 in der alten Bundesrepublik schwersten familiären Misshandlungen ausgesetzt waren. Zerrissenheit.
An einem nasskalten, verschneiten Wintertag, dem 22. Januar 1962 war es so weit – endlich. Kinder-Emigration. Unter innere Emigration wird die innere geistige Auswanderung verstanden. Ich befand mich in einer seelischen Emigration. Ausgewandert in eine gewaltfreie Zeit. Wenigstens das. Es begannen meine Heim-Jahre, dort draußen auf unendlich weiten, sich überlassenen, nahezu vergessenen morastigen Feldern zu Osnabrück am Rande des Teutoburger Waldes. Hier stand das Haus Neuer Kamp in der Sutthauser Straße 288. Es sollte für viele Jahre mein Zuhause werden.