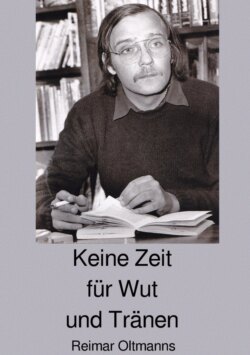Читать книгу Keine Zeit für Wut und Tränen - Reimar Oltmanns - Страница 13
Sein und Sinn im Hamsterrad „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ - Irgendwo hinziehen, irgendwo hin flieht. Bruchstellen. Erwarte nichts im Leben, dann ist alles, was du bekommst, ein Bonus.
ОглавлениеFrank Zappa, Komponist, Musiker (*1950+1993)
Keine Frage – ein Leben im Heim, der stereotype Gleichklang zwischen Zeit und Raum glich der Verlässlichkeit eines Hamsterrades. Wir waren ständig im Laufschritt auf Trab, glaubten gar, uns nach vorn zu bewegen. In Wirklichkeit galt es unsere Energie, unsere Motorik, aber auch unsere Phantasie abzuschöpfen; letztendlich mit Psychopharmaka ruhig zu halten; das Haus Neuer Kamp ein Kleintierkäfig. Verständlich, dass wir weder nach links noch nach rechts, sondern ausschließlich auf die sich drehenden Speichen starrten.
Derlei Zöglings-Erziehungsmethoden machen Jugendliche zu „geistigen Krüppeln“, letztendlich zu schlichten Ja-Sagern, Mitläufern in einer autoritär strukturierten Gesellschaftsordnung von oben bis unten. Unterwürfigkeit hier, Unterwürfigkeit dort – den ganzen lieben Tag devot, oft ungefragt, aber stets geflissentlich heraus posaunte Unterwürfigkeit. Das Passepartout „Anpassung“, durchdrang all die emotionalen Schichtungen des jugendlichen Daseins. Ein Überlebenskampf, der keine Zivilcourage, keinen Bekennermut, keine Individualität ermuntert oder gar Konfliktbewältigung erlernbar macht. Stattdessen fördert er intrigante Charaktere, die anderen Heimkindern um des Vorteils willen Schaden zufügen. Abgestumpfte Duckmäuser. Atemnot in jungen Jahren.
Auf jedem Flur, in jedem Zimmer ein Spitzel – eben Aushorcher, der praktisch von jedem heimlich gegessenen Apfelkuchen Meldung machte. Statt vertraut wurde misstraut, statt Gesprächen, die Fehlverhalten korrigieren helfen, hagelte es Verbote und Bestrafungen. Statt ein vitales, spielerisches Wir-Gefühl in den Gruppen, wurden Rivalitäten untereinander angestachelt. Statt freier, beherzter Meinungen wurde das nachgeplapperte, opportunistische Meinungsprofil belobigt. Da wurde kaum etwas in Frage gestellt, hinterfragt. Wer selbstständig dachte oder gar handelte – der machte sich verdächtig. Angepasste Selbstaufgabe mündete in Phrasen wie „Schweigen lernen vor dem Unerforschlichen“. Amen. Hier wucherte die stereotype Unterdrückung der Ich-Entwicklung des Menschen vom Kleinkind an. Augen zu und durch, hieß die Überlebens-Devise. Es war eine Heim-Sozialisation, die in Deutschland lautstark als „Erfolgspädagogik in einer demokratischen Gesellschaft“ gepriesen wurde. Kaum einer hatte in jener Zeit die Möglichkeit, gegen solch einen Redeschwall Zwischentöne zu wagen. Chancenlos.
In den Sommerferien hatte ich mir als 13jähriger Hilfsarbeiter in der ostfriesischen Konservenfabrik mein erstes Geld verdient. Ich liebäugelte mit einem kleinen Transistorradio. Es sollte mich in den Heim-Nächten unterhalten. Oft lag ich zur Schlafenszeit hellwach auf meinem Bett. Ich lauschte den Schritten der Nachtwachen. Sie alle konnte ich durch ihren Bewegungs-Rhythmus identifizieren. Wenn Angelika abends spät in die Gruppe kam, öffnete sie wortlos einen winzigen Spalt meiner Zimmertür und ich verschwand flugs in ihrem Bett.
Schließlich durften die Schlaf-Genossen Stephan Toussaint aus Hannover und Ronald Bosien (*1959+2010) aus Berlin unter keinen Umständen durch einen empfindlichen Lichtstrahl aufgeweckt werden. Wenn ich lange Nächte auf sie warten musste, hatte ich nunmehr meinen kompakten, zwanzig Zentimeter kleinen Rundfunkempfänger der Marke Sharp/Osaka mit Lange-, Mittel- und Kurzwelle unter meinem Kopfkissen. Stolz war ich. Erste Anschaffung.
Ich hatte Obacht zu geben, höllisch aufzupassen. Radios in Kinderhand, die waren verboten. Sie wurden bei Kontrollen bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag beschlagnahmt. Einen Fernseher, habe ich das erste Mal zu den Olympischen Spielen 1964 in Tokio gesehen – im Gemeinschaftsraum hockten wir im Halbkreis vor der Glotze. Jeder hatte seinen Stuhl mitzubringen. Indes: Ich konnte nicht ahnen, dass mein kleines Rundfunk-Kästchen einen solch gravierenden Einfluss auf mich haben sollte, ja meine Entwicklung maßgeblich prägte.
Es waren vornehmlich Nachrichten, Berichte wie Radio-Reportagen des Deutschland-Funks in Köln, Sendungen über Politik und das Weltgeschehen faszinierten mich – speisten unaufhörlich meine Gedanken. Ich kam fortlaufend mit fernen deutschen Schauplätzen, fremden, mir bislang unbekannten deutschen Worten und auch Begriffen in Berührung. Es waren Daten und Fakten aus diesem Land und vom Erdball, die mir bislang vorenthalten worden waren. Bundesrepublik Deutschland und der Rest der Welt.
Etwa der bundesdeutsche Nationalfeiertag (1954 bis 1990) zum Volksaufstand in der DDR zum 17. Juni 195340. Feierstunde in der Schulaula. Spalierstehen klassenweise. Groß ausgerollte Deutschland-Karte mit den Grenzen von 1937 (einschließlich polnischer Gebiete). Leitmotto: „Drei geteilt niemals“. Deutschland-Fahne, Nationalhymne geschmettert aus allen Kehlen, Dokumentar-Film über die antistalinistische Arbeiter-Rebellion. Kalter Krieg.
In der Chronologie damaliger Ereignisse wurde Willy Brandt (*1913+1992) am 16. Februar 1964 zum Nachfolger von Erich Ollenhauer (*1901+1963) zum Parteivorsitzenden der SPD gewählt. Brandt blieb bis ins Jahr 1987 in diesem Amt. Am 31. März 1964 beginnt in Brasilien mit dem Militärputsch eine 21jährige Schreckensherrschaft über das Hundert-Millionen-Volk. Gleichfalls am 31. März 1964 eroberte die britische Musikgruppe The Beatles die ersten fünf Plätze der US-amerikanischen Hitparade, eine zuvor nie da gewesene Situation.
Am 12. Juni 1964 wird Nelson Mandela (*1918+2014), Führer des African National Congress gemeinsam mit sieben Mitangeklagten wegen Subversion und Sabotage zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Am 2. Juli 1964 unterzeichnete US-Präsident Lyndon B. Johnson (*1908+1973) das Bürgerrechtsgesetz zur Aufhebung der Rassentrennung. Dieses, nach Beendigung der Sklaverei im Jahr 1863, wichtigste Dokument zur Gleichstellung der Schwarzen, wurde von John F. Kennedy (*1917+1963) vorgeschlagen.
Am 27. Juli 1964 gibt die Deutsche Bundesbank in Frankfurt a/M die ersten Banknoten im Wert von 1000 Deutsche Mark, den höchsten von ihr emittierten Nennwert aus. Am 9. Oktober 1964 läuft im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) die erste Folge der Quizshow Vergiss mein nicht mit dem Conférencier Peter Frankenfeld (*1913+1979). Das Ratespiel um Postleitzahlen ist mit einer Benefizveranstaltung zu Gunsten der neu geschaffenen Aktion Sorgenkind verbunden.
Am 14. Oktober 1964 wurde Nikita Chruschtschow (*1894+1971) vom Plenum des ZK aus seinen Ämtern entlassen.
Am 16. Oktober 1964 startete die Volksrepublik China den ersten unterirdischen Atombombenversuch.
Am 22. Oktober 1964 der französische Philosoph Jean-Paul Sartre (*1905+1980) lehnt den Nobelpreis ab. Der aus Augsburg zum FC Bologna gewechselte Fußballstar Helmut Haller (*1939+2012) wird in Italien als erster Ausländer zum „Fußballer des Jahres“ 1964 gewählt. Er kickte 33mal für Deutschland.
Das Bildungsversprechen, das mir gegeben wurde, hieß Volksschule. Meine Volksschule lag im Osnabrücker Stadtteil Kalkhügel. Täglich marschierte ich die Sutthauser Straße entlang stadteinwärts – einem verdreckten, mit Fabrik-Ruhs überzogenen und scheinbar endlosen Autoschlangen vollgestopften Ausfahrt-Boulevard. Als Neubauten der Martin-Luther-Schule im Jahre 1961 eingeweiht wurde, wussten Bildungsplaner längst, dass sich diese evangelische Konfessions- und Volksschule längst überlebt hatte.
Das hinderte verantwortliche Politiker und katholische Bildungsplaner nicht daran, gemäß dem Konkordat41 des Landes Niedersachsen mit der Apostolischen Nuntiatur, weitere Konfessionsschulen einzuweihen. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Martin-Luther-Schule führte die Piusschule der Katholiken ihr abgeschottetes päpstliches Eigenleben. Auch diese katholische Lehranstalt verschwand schon nach kurzer Zeit. Gemeinschaftsschulen ebneten den Weg aus einem künstlich stilisierten, aberwitzigen Glaubenskampf besagter Jahre.
Mit der neu konzipierten Hauptschule sollte die alte, traditionelle Volksschule aufgewertet werden; insbesondere galt es, durch erweiterte Fächerangebote mit Englisch und Naturwissenschaften ins Curriculum diese oft vernachlässigte Schulform aus dem Keller zu holen, Bildungs- wie Berufschancen zu erhöhen. Und: Nicht mehr der sogenannte Allroundpädagoge, sondern ausgebildete Fachlehrer sollten auf einem höheren Niveau Schülern wie Schülerinnen ihren Weg in die Zukunft zeigen. In Niedersachsen besuchten im Jahre 1963 immerhin 699.000 Kinder Volks- wie Zwergschulen auf dem Lande.
Mein Klassenlehrer Willi Böhm (*1902+1969) war aber eben nur kein gewünschter Fachvermittler in der neu ausgerufenen Lernfabrik Hauptschule. Sein Lebensprofil entsprach auch nicht dem eines stereotypen Wissensvermittlers oder gar Wissensprüfers. Zensuren spielten bei ihm kaum eine Rolle. Alle Monate gelegentlich bei einer Klassenarbeit oder auf den Schulzeugnissen, wo sie nun mal zu stehen hatten.
Als Anthroposoph42 zählte der hagere Mann mit seinen grau melierten Haaren und seiner meist geröteten Knollennase zu den Anhängern der von Rudolf Steiner (*1861+1925) gegründeten, weltweit vertretenen spirituellen Weltanschauung des Menschen zum Übersinnlichen. So wollte er den Homo sapiens sehen, so ließ er sich als Pädagoge auf seine Schüler ein. Er strahlte Ruhe aus, die sich offenbar auf uns übertrug. Er konnte zuhören, ausreden lassen, Konflikte entschärfen, klären, Gewalt von ihm war undenkbar, unter den Schülern in seiner Gegenwart ausgeschlossen.
Wie Rudolf Steiner trachtete Willi Böhm danach, seine Pädagogik nicht von „den Qualifikations-, Reproduktions- und Selektionsanforderungen einer spätindustriellen demokratischen Leistungsgesellschaft“ zu bestimmen. Sein zentrales Anliegen war vielmehr, in den jungen Menschen „Seelenfähigkeiten im Denken, Fühlen und Wollen“ zu verankern. „Lass dir nie das Rückgrat brechen“, war einer seiner Lieblingssätze.
Meiner Geschichtslehrerin Adelheid Uffrecht, die um Jahre später Fischer hieß, blieb es vorbehalten, mich überhaupt erst einmal mit der Kulturtechnik des Buches vertraut zu machen, mich zum Lesen zu bewegen. Ich kannte keinen Lesestoff, auch kein Vorlesen, die Phonethik der gelesenen Sprache war mir nicht vertraut. Wenn überhaupt, dann stotterte ich mit einem verkrampften Zeigefinger die Druckspalten begleitend auf den Schulbüchern entlang. Berührungsängste in jungen Jahren aus bildungsferner Zeit.
Das Fräulein Adelheid, wie sie damals noch gerufen wurde, war von zierlicher Gestalt, mit kurz geschnittenem Haar, zuweilen listigen Blickes und zwei Grübchen auf ihren Wangen. Sie kam gerade mit ihrem Staatsexamen von der Pädagogischen Hochschule – eine couragierte wie unerschrockene Junglehrerin, das war sie.
Im Klassenraum sangen wir vor ihrem Unterrichtsbeginn gelegentlich aus Jux den Ohrwurm von Billy Sanders aus dem Jahre 1962, „Adelheid, schenk mir einen Gartenzwerg“. Stattdessen schenkte sie mir die Trilogie „Der Wind der Freiheit des Reiseschriftstellers Alfred E. Johann (*1901+1996)43. Es wurde erst für mich zu einer Pflicht-, sodann aber zur Lektüre der neu entdeckten Leselust. Der Bann der Lesefaulheit schien gebrochen. Oft hatte ich in ihrem Unterricht vorne an der Tafel zu stehen. Ich musste über aktuelle Tagesereignisse, aber auch Gräuel in der Nazi-Epoche berichten. Traurige Erfolgserlebnisse.
Erst später erfuhr ich, dass diese vermeintlich unscheinbare Adelheid Uffrecht, die sich nach ihrer Ehe Fischer nannte, erbitterte Kämpfe mit ihrem Rektor Gustav Gorontzi (*1904+2004) auszufechten hatte. Er war nämlich ein Mann brauner Vergangenheit mit „heldenhaften“ Kriegserlebnissen. Ihre täglichen Konflikte waren Vorläufer spätere Geschlechterkämpfe um die Emanzipation.
Er, der Schulleiter, war ein Mann der Waffen-SS44. Überall erhielt er für seine Militärattacken an Leib und Leben im „Namen des Führers“ hoch dekorierte Auszeichnungen – in Polen, Frankreich, Russland, bis er alsbald nach dem Kriege zum Rektor berufen wurde. Die Kontinuität von Hitler-Deutschland hatte auch im Bildungswesen, in diesem Fall auf dem Osnabrücker Kalkhügel einen Namen. Gorontzi. Dieser zackig auftretende, mit kurz geschorenem Fasson-Schnitt wollte sich nun mal – entsprechend seinem Frauenbild – nichts von „solchen Mädels“ sagen lassen. Sie hätten zu lernen, zu lächeln und in allgewichtigen Lehrerkonferenzen zuzuhören, sonst nichts. Es waren damals noch oft bagatellisierte und jeweils nur auf die Personen bezogenen Auseinandersetzungen, hinter denen sich das neu aufkeimende feminine Selbstverständnis verbarg – das um die Emanzipation, Autonomie und des Rollenbildes der Frau im Beruf.
Explizit jene eigentlich unverdächtigen Lehrer-Mädels um Adelheid Uffrecht wollten sich nicht Tag für Tag für vergilbte Kasernen-Zackigkeit auf dem Schulhof hergeben; still- wie strammstehen vor dem Macht-Faktor Mann, zum Morgen-Rapport des Rektors. Die Außerparlamentarische Opposition, ein zunächst zaghafter Bewusstseinswandel nach mehr Demokratie, nagte schon seit Anfang der sechziger Jahre an so manchen Gemütern. Ewig dieses von Mehlwürmern durchlöcherte Drill-Korsett – ewig dieser einzubläuende Gehorsam, stillgestanden, Augen geradeaus, singend, immer wieder singend, „Befiehl du deine Wege, was dein Herze kränkt. Der allertreusten Pflege Des, der den Himmel lenkt …“, Kirchenlied von Paul Gerhardt (*1607+1676).
Tag für Tag, Jahr für Jahr. Jeden Morgen um 7.45 Uhr hatten wir in der Schulaula in Klassenformationen zum Zählappell anzutreten. Jeden Morgen gab der Rektor eine Bibel-Losung aus, bevor die Gebetsmühle vom „Vaterunser“ durch die Vorhalle tönte – mithin das gesamte Lehrer-Kollegium tonverstärkend mit zu röhren hatte. Präsenzpflicht. Erst dann galt es in stramm gehenden Dreier-Formationen Klasse für Klasse in den Schulalltag abzurücken. Martin-Luther-Schule zu Osnabrück. Schulalltag, Kasernenalltag. „Gelobt sei, was hart macht“, war eine oder „Ein deutscher Junge weint nicht“, eine weitere pädagogische Standard-Maxime in jenen scheinbar geläuterten Jahren der Nachkriegs-Ära.
Zumindest mochte ich mich sehr präzise an jene, im Baustil ähnlichen Schulkappelle erinnern, als ich Jahre später – am 13. März 1969 – das Tor der Blücher-Kaserne in der Skagerrak Straße im ostfriesischen Aurich passierte. Ausgerechnet in der denkwürdigen Straße namens Skagerrak45, die als die größte Seeschlacht im Ersten Weltkrieg mit 35 gesunkenen Schiffen und über 8.645 Toten in die Geschichtsbücher einging, sollte ich zum Kriegsdienstverweigerer mutieren. Ausgerechnet in dieser kalt abweisenden Klinkerbau-Kaserne nach Gebhard Leberecht von Blücher46 (*1742+1819) benannt, wurde ich zum Pazifisten. Dabei hatte ich stets jenen Generalfeldmarschall vor Augen, der sich als Haudegen offensiver Schlachten ohne Rücksicht auf Verluste hervorgetan hatte. Deutsche Tugenden.
Zurück an die Martin-Luther-Schule in Osnabrück: ungeachtet linkisch eingeübter, innewohnender Nazi-Allüren stärkten Pädagogen mein Selbstbewusstsein, schärften mein Konfliktverhalten, machten mich zu einem widerstandsfähigen Jugendlichen. Ich besuchte auf dem Zweiten Bildungsweg in folgenden Jahren noch so manche höhere Schule bis zur Fach-Hochschulreife. Oft blieb dem Leistungs- und Zensurendruck folgend Mut, freie Rede, selbstständiges Denken oder auch Diskussionssinn auf der Strecke. Einschüchterungen vielerorts. Vordergründige Anpassungen des wohlfeilen Süßholzraspelns galten als Überlebensgarant auf dem damals noch sehr schmalen Pfad nach oben als bequemer Weg des geringsten Widerstands.
Indes: Die von Bildungsbürgern arg belächelte Martin-Luther-Schule zu Osnabrück mit meinen Lehrern Willi Böhm und Adelheid Uffrecht hingegen sollten mich geprägt haben. Sie waren die wichtigsten Bezugspersonen in meiner Jugend. Eben: Ausnahmen bestätigen die Regeln. Zu ihnen zählte gleichsam die couragierte Pädagogin Rena Petersen, von den Handelslehranstalten im ostfriesischen Emden, die mich lehrte, Konflikte auszuhalten und zu bewältigen.
Damals wie heute hefteten sich untrügliche Gefühle nach Vorahnung eines vorgekauten, verzerrten Lebens an meine Fersen; eine Prophetie, die mich Zeit des Lebens begleiten sollte. Damals wie heute, ob in Schulen oder später in Redaktionen, erspürte ich die Vereinzelung meiner Kameraden oder auch Kollegen. Ich erahnte auch ihre wie auch meine klammheimliche Isolation als sogenannte Einzelkämpfer mit belegter Zunge und wieselflinken Hab-Acht-Augen in jugendlicher Hab-Acht-Stellung. Kaum jemand, so wollte man glauben, kam angstfrei, spontan daher. Alles, ja fast alles unterlag dem unausgesprochenen Diktat zwanghafter, verschlagener Berechenbarkeit. Jugend-Jahre.
Wir leben und lieben in der flüchtigen oder auch flüssigen Moderne, wie ich es in reiferen Jahren der Nachdenklichkeit nannte. Eben Konsumgesellschaften beschränken sich auf den schnelllebigen Genuss. Viele, sehr viele erleiden mit ihren Befindlichkeiten und Lebenserwartungen ungewollte Einbrüche und immer wieder Enttäuschungen. Sie empfanden die Masse Mensch als anonym wie stumm, irgendwie austauschbar abgerichtet. Es schien, als hätte sich da ein jeder gänzlich der Konsumwelt verpfändet. Achselzucken. Keiner glaubte letztendlich, sich dem Druck, dem Konsumdruck widersetzen zu können. Und Menschen scheinen nur so lange wertvoll, wie sie Befriedigung verschaffen. Nur, was geschieht, wenn jeder eine menschliche Beziehung zum Umtausch in den Laden zurückbringen darf. Wo bleiben dann die Räume, in denen das Gefühl moralischer Verantwortung für andere wachsen kann?
Abermals kreisten meine Gedanken, Erinnerungen um meine Volksschule zu Osnabrück inmitten der sechziger Jahre. Dort, in der Klasse 7a, hatte ein Student der Pädagogischen Hochschule in den Schulbetrieb hinein zu schnuppern, ein Praktikum zu absolvieren. Gerd Erichsen (*1942+1965) hieß er, Struppi nannte er sich, weil sein Bürsten-Haarschnitt so gar nicht zu den aufkommenden, modischen Langhaar-Mähnen dieser Jahre passen wollte. Er sollte sich für zwei Jahre aus freien Stücken heraus um mich kümmern, mir Orientierung geben, mich prägen, zu meinem Freund, zu meinem Gesprächspartner oder auch zur väterlichen Bezugsperson werden. Glücksmomente für mich, sich meiner unverhofft angenommen zu haben. Wenn Struppi des Morgens den Klassenraum betrat, hatte er meist den Schalk im Gesicht, einen Jürgen
von Manger-Spruch47 auf der Zunge; etwa „Dat birken Frühschicht“ und ähnlichem. Locker wie angstfrei sollte spielerisch gelernt werden. Struppi als Spaßvogel, Paradiesvogel. Dafür hatte Struppi sein Banjo vorsorglich unter den Arm geklemmt. Das Banjo war für ihn sehr wichtiges Zupfinstrument. Es sollte an die Unterdrückung erinnern, vornehmlich an die Knechtschaft über die Schwarzen in Nordamerika. Das Banjo mit kreisrundem Klangkörper mit dem langen Hals war für ihn ein Symbol von Lebensschmerz, Aussteiger-Melodien, Sehnsüchte, Gitarre, Existenzialismus. Er wollte und sollte allein schon durch Gestik, Bewegung und Sprache nicht in jene angestrengten Zeitläufte passen. Er war wohl den Jahren weit voraus.
Struppi war Halbwaise eines evangelischen Pastors im niedersächsischen Celle, der sein Leben an der Ostfront ließ. Schon als Gymnasiast hatte er sich zudem den Modellbau Flugzeugen verschrieben. Überall dort, wo er seine selbst gebastelten Propeller fliegen lassen konnte, ob bei der Deutschen Meister- (1959), später bei den Modellflugweltmeisterschaften in Wien-Neustadt im Jahre 1963, da starrte er seinen Fliegern bedächtig in den Lüften hinterher. Beide Titel holte er.
Gerd, wie er eigentlich hieß, war offenkundig immer auf der Suche nach Orten tieferen Sinnes, an dem er seinen Lebensschmerz, seiner Melancholie entkommen oder auch begegnen konnte. Fernweh hatte er, weg aus der deutschen Unwirtlichkeit, weg aus dem Mief. Seine Lieder, Balladen, auch Chansons, allesamt waren es Musik-Einlagen gegen den deutschen Eintopf, jahrein, jahraus. Es war seine Art, in Melodien Gemütsverfassungen der Menschen, auch ihre Mentalitäten zu parodieren.
Aber es war auch seine Überlebenskunst, mit der in ihm hausenden Depression umzugehen. Sie holte ihn wohl immer wieder unberechenbar ein. Schwermut, Niedergeschlagenheit, Apathie – er wusste nicht, woher sie kamen. Er wusste nur sehr genau, dass seelische Blockaden ihn fortan begleiteten. Er hatte meist nur einen Wunsch. ein Bedürfnis, fremd wollte er sein, richtig fremd, undurchschaubar, unerkannt. Irgendwo hingehen, irgendwo hinfliehen. Mehr war aus ihm nicht herauszukriegen. Lebensschmerz. Dabei spielte Struppi Gitarre wie Banjo oft wie besessen, zuweilen hastig in sich hinein. Er trampte mit einem kleinen Rucksack klimpernd durch Europa, heute hier morgen dort. Als Bänkelsänger, der er eigentlich war, da hatte er mal hier eine Freundin, die er unisono „Täubchen“ nannte, mal dort. Flüchtige Blicke, flüchtige Berührungen, weiter ging’s.
Es kam vor, dass Struppi sich tagsüber unter seine Bettdecke verkroch, wollte er von sich und seiner Umgebung wenig wissen. Da lag er über lange Stunden in seiner kleinen Mansardenbude in Osnabrücks Parkstraße der vierten Etage auf seiner Pritsche zwischen klebrigem Geschirr, Zettelwirtschaft und seinem Banjo. Niemand kam zu ihm. Struppi starrte die Decke an. Er öffnete einfach nicht. Kontaktsperre. Erst in den frühen Abendstunden zog es ihn in den gewölbten PH-Keller, einer verwinkelten, kuscheligen Studenten-Pinte im alten Schloss. Dort, im Uterus der Pädagogischen Hochschule48, klimperte, begeisterte er mit seinem Zupfinstrument bis in die frühen Morgenstunden Banjo spielend. Er wollte sich und die Nähe zu anderen, zu seinen Kommilitonen probieren, ausprobieren.
Das Jazz-Souterrain im einstigen Osnabrücker Schloss49 war sein Trotz-Gemäuer, aus Protest und Geborgenheit. Hier durchlebte er nächtliche Momente von Nähe und Durchbruch. Sein Heimspiel. Ob mit Roy Orions „Pretty Woman“ oder auch „The Girl from Ipanema, unvergessliche Banjo-Melodien kreisten im Halbdunkel um das Flair von California Sun. Immer wieder, wie neu erfunden, neu kreiert, neu aufgelegt, hämmerte Louis Amstrongs (*1901+1971) „Oh when the saints go marching in“ durchs Kellergewölbe beinahe so, als habe die Zeit eine Atempause genommen. Struppi-Auftritte.
Lustig schien er morgens im Unterricht, ulkig war er. Oft den Lacher auf seiner Seite, vordergründig zumindest. Er intonierte meist zu Beginn der Schulstunde das Lied vom armen Dorfschulmeisterlein, in dem es unter anderem heißt „… In einem Dorf im Schwabenland, da lebt, uns allen wohlbekannt, da wohnt in einem Häuslein klein, das arme Dorfschulmeisterlein … Des Sonntags ist er Organist, des Montags fährt er seinen Mist, des Dienstags hütet er das Schwein, das arme Dorfschulmeisterlein. … Des Donnerstags geht er in die Schul und legt die Buben übern Stuhl. Er haut solange bis sie Schrein, das arme Dorfschulmeisterlein… Und wenn im Dorfe Hochzeit ist, dann könnt ihr sehen, wie er frisst. Was er nicht frisst, das steckt er ein, das arme Dorfschulmeisterlein. …“ Gedichtet von Friedrich Samuel Sauter,
(*1766+1846).
Die einklassige Dorfschule in Himmelpforten, ganz nah am verlassenen Örtchen Steinau im Landkreis Cuxhaven, in der oft als schwermütig empfundenen Wesermarsch kannte, nur für eine Kurzweil ihren Junglehrer Gerd Erichsen. Dorthin, „am Ende der Welt“, „fern der Heimat“ wie er zürnte, wurde er als frisch examinierter Junglehrer aufs Land verschickt.
In seinem letzten Brief, den er mir schrieb, formulierte er: „Ich habe die 1. - 4. Schuljahre und lasse den Laden laufen, mache mir keine großen Sorgen. Gerade habe ich noch ein Bier geballert, die ganze Umgebung besoffen. Hochzeit, Riesenfest. Trotzdem: Ich kann nicht hierbleiben. Ich bin Mensch und muss Mensch bleiben, hier oben packe ich es nicht. Keine Gitarre, kein Banjo, keine Frau, keine Gespräche. Meine Barbara studiert noch in Kassel und das ist so weit – zu weit.“ Es war sein Abschiedsbrief. Struppi wünschte mir für meine Zukunft alles erdenklich Gute. Viel „Glück und einen tieferen Lebenssinn“.
Einsam war es um Struppi geworden – durchbohrt, gebrochen schien sein Lebensmut. Er hockte in einem alten, mit tristen Farben bemalten Lehrerhaus. Er war umgeben von allseits Licht schluckenden Kastanien, einem eintönigen Sandstein zugeschütteten Schulhof, Wasserpumpe, Plumpsklo, schwarze Dachziegel, schwarze Fensterklappen, Obstbäume, drei Hunde, zwei Katzen, Hühner, zwei Wellensittiche. In seinen letzten Notizen schrieb er: „Die Hütte hat mich erstickt.“
Am 14. Oktober 1965 erschoss sich Struppi in der Dunkelheit mit einer Revolver- Kugel durch den Mund in seinem VW-Käfer (Standard, Baujahr 1957) auf einem Feldweg am Waldesrand des Ortes Himmelpforten.
Der Wetterbericht hatte für kommende Tage viel Nebel und Dunst mit einer Sichtweite von unter 200 Metern vorausgesagt. Die norddeutsche Tiefebene, so wissen Landschafts-Psychologen zu berichten, sei für die menschliche Neubesiedlung eigentlich nicht geeignet. Überall durchzieht dieser das Gemüt einschnürende Nebel, dieser Nieselregen, die blattlosen Baumsilhouetten vor steingrauen Wolken die Gemüter. Und immer und immer wieder – ohne Entkommen – verlieren sich Blicke wie Gedanken in das langweilige Land. Das kann böse, zornig machen. Ewig dieser matschige Boden unter kalt-angefeuchteten Gummi-Stiefeln, die mit jedem Schritt schwerer werden.
Jahre später las ich das Buch des französischen Autors Édouard Levé zum Thema Freitod. Vergangenheitsbewältigung. Der Autor brachte sich kurz nach Beendigung seines Manuskriptes um. Jedenfalls fühlte ich mich, wie sollte es auch anders sein, unweigerlich an meinen älteren Jugendfreund Gerd Erichsen erinnert. Nichts deutet noch daraufhin, dass dieser junge, sensible, oft verzweifelte Mann einmal unter uns weilte. Nichts. Flugsand. Nicht einmal ein Grabstein, nicht einmal ein Blümchen ist seiner auf dem Friedhof Birkenberg zu Leverkusen gewidmet – obwohl seine Familie recht vermögend war.
„Selbstmord“, schrieb Édouard Levé50, „ist das finster-triumphale Psychogramm einer Verstörung, fest- und sichtbar gemacht am prozesshaften Herausfallen eines Ichs aus seinem Leben und der es umgebenden Welt. Du hast Dein Ende genau geplant. Du hattest das Szenario bewusst entworfen, dass man deinen Körper unmittelbar nach deinem Tod finden würde. Du tatst deinem lebenden Körper zwar Gewalt an, aber deinem toten wolltest du keinen anderen Erniedrigungen aussetzen als jenen, die du ihm selbst zufügen würdest … Sterben Tiere an Hoffnungslosigkeit? Nein, sie funktionieren oder verschwinden. Vielleicht warst du ein schwaches Glied in der Kette. Eine Zufallserscheinung der Evolution. Eine kurzzeitige Anomalie.“ Kurz nach Beendigung des Manuskripts nahm sich der Autor sein Leben – das Ende.
Struppi und ich sprachen viel über den Tod, die Sinnlosigkeit des Daseins und das in unseren lebenswichtigen, jungen Jahren. Vital und witzig waren wir schon. Nur seit Monaten beobachtete ich, wie ein blauer abgewetzter Schnellhefter von zwanzig Seiten mit weißen schmalen, beschrifteten Zetteln angereichert wurde. Es war, wie sich herausstellte, eine Semesterarbeit der einstigen Adolf-Reichwein-Hochschule zu der Kritik von Albert Camus (*1913+1960), dem französischen Philosophen und Schriftsteller, am Christentum unserer Zeit.
Für Albert Camus ist der Tod ein absolutes Ende. Der Tod macht keinen Sinn, das Leben aber auch nicht. Nur der Tod kennt die einzige Schicksalsfügung, die vorbestimmt ist und der man nicht entkommen kann. Der Tod war für Camus’ Menschen der krönende Abschluss eines absurden Lebens. Albert Camus – der Zeitgenosse seiner Epoche. So und kaum anders war Struppis Selbstverständnis, das er mir nahe zu bringen suchte, seine gesellschaftliche Wahrnehmung, seine Ideen-Geschichte. So hat er Albert Camus gelesen und verstanden. Ersehnte Träume, erhoffte Utopien?
Es dauerte nicht lange, da lasen wir beide aus den Schriften, aus dem Leben von Albert Camus. – Neugierde. Identifikations-Merkmale. Nobelpreisträger Camus war ein religiöser Denker ohne Gott oder Transparenz. Im Buch „Mythos von Sisyphos – ein Versuch über das Absurde“ (1942) beschwört er Don Joan, diesen Helden der Haltlosigkeit, der grundlos von einer Frau zu nächsten wandert. In weiteren Erzählungen wie “Der Fall“, für die er 1957 den Literatur-Nobelpreis bekam, zeichnet er das düster-moderne Bild einer Ehe; einer Zweisamkeit als (Selbst)-Vernichtungsprogramm in ihrer unaufhaltsamen, neurotischen Fixierung.
Er, einst chancenloser aus Algerien kommende Camus, der seine Kindheit als elend bezeichnet hatte, war gemeinsam mit Jean-Paul Sartre (*1905+1980) zum Vordenker eines neuen existenzialistischen Denkens geworden. Er, der in einem bitterarmen und bücherlosen Haushalt in Algerien aufwuchs, ohne Vater und mit einer Mutter, die des Lesens und Schreibens unkundig war. Und ausgerechnet Camus, der bezeichnenderweise durch einen absurden Autounfall den Tod fand.
Ein verpufftes, folgenloses Geschehen lässt sich lediglich bei den Reichen entdecken, nicht doch bei Albert Camus. Für die Armen und Taugenichtse zeichnet er jenes Szenario eine undeutliche Spur – zum Tod. In späteren Jahren empfand ich den damals viel diskutierten Existenzialismus51 zuweilen als eine aufgesetzte intellektuelle Modeerscheinung, als mehr oder minder pubertäre, schicke Philosophie, zu der die Zigarettenmarke Gauloises und ein Ricard-Aperitif als Zugehörigkeitssymbol obligatorisch waren.
Für Camus hingegen schien der Selbstmord eine Lösung oder auch Loslösung von einer sinnlosen Welt. Und wir beide – der Struppi und der Reimar – hatten eine gedankliche Nähe zum Tod. Sie schienen fasziniert von diffusen Ängsten und auch von der prickelnden Sehnsucht nach Freiheit. Grenzüberschreitungen.
Ich hingegen wollte leben, richtig leben, mich mit meiner Beobachtung, Ansicht, Vitalität, auch Konflikten einmischen ins Geschehen, in politische Tages-Aktualitäten, gerade auch in die Groteske oder auch Absonderlichkeiten dieser Jahre. Ich kann mich noch sehr gut entsinnen, war diese Ära durchdrungen von einem subtilen Argwohn gegenüber all jenen jungen Menschen, die nicht so wollten, wie sie sollten. Überall und nirgends begegneten mir Männer mit prallen Leibesumfängen, Bierbäuchen, Umtata-Allüren und einer gezielten Ignoranz.
Ich spürte diese verborgene Kaltschnäuzigkeit, eine wegwischende Verächtlichkeit, Beliebigkeit, Dumpfheit. Die Deutschen? Jedenfalls fluteten Misstrauen, Belehrungen, Ausgrenzungen sicher geglaubte Hoffnungen – Befehl und Gehorsam. Junge Generationen waren in diesem Deutschland eigentlich nicht vorgesehen. Dialoge, welch ein pathetisches Wort, also Wortfetzen, die mit der Väter-Generation hin und her flogen, glichen Krisengesprächen nach einem Betriebsunfall. Wir, die Jugendlichen in den Sechzigern des vergangenen Jahrhunderts, waren die Missratenen, die Versager. Punktum. Jedenfalls meine entsagungsreiche Heim-Jahre und das eingelöffelte, autoritär verabreichte Fachabitur auf einer der Höheren Handelslehranstalten zu Osnabrück lagen hinter mir. Erleichterung.
Für gelebte Freundschaften gab es keinen seelischen Aufenthaltsort, jedenfalls nicht für mich. Viele husteten im täglichen Umgang Flüchtigkeiten, den sogenannten VGT – den vorgetäuschten Tiefgang. Oft schien es mir so, als guckte ich durch die Menschen hindurch. Meine Tagebuch-Aufzeichnungen aus dem Jahr 1968 skizzierten mir einen jungen Mann, der teils schwermütig, teils melancholisch sein Leben betrat. Damit ist wohl kein Krankheitsbild, sondern eher die Definition eines Weltschmerzes gemeint. Ich denke damit auch schon meine eigene Unzulänglichkeit, aber auch die Unzulänglichkeit der Welt, bestehende, unerträgliche Verhältnisse zu ändern, abschaffen zu wollen. Enge, beängstigende Enge vielerorts. Zugegeben: Zeitweilig gefiel ich mir in dieser Rolle schon, glaubte ich an die Exklusivität meiner selbst. So stärkte ich einstweilen mein Sendungsbewusstsein.
Selbst die schwerblütigen fünfziger Jahre, der heimliche Krieg gegen alle, schienen überwunden; das Aufbegehren vieler Ehefrauen gegen ihre oft hilflosen patriarchalischen Männer, die Gymnasiasten gegen die Volksschüler, Großunternehmen gegen den Mittelstand. Kleinbürgerliche Milieus, wohin ich auch schaute, waren eng, sehr eng. Atemnot. Beamte, Handwerker, Einzelhändler, ehemalige NSDAP-Mitglieder – sie alle trugen ihr Weltbild trotzig und unnahbar mit sich herum. Es war mein Kollege Peter Mosler52, der auch mein Lebensgefühl jener Jahre in seinem Buch „Was wir wollten. Was wir wurden“ formulierte. Einer jungen (studentische) Generation, die „ausgezehrt von einer tödlichen Leere“ gekennzeichnet war, die nur auf eine Gelegenheit gewartet hatte, „dem scheintoten Körper dieses Landes“ zu entrinnen.
Wir zählten das Jahre 1968. Ich wohnte im Zentrum an einem breiten Ausfall-Boulevard in einem kleinen, winzigen Zimmer nahe dem Schloss in der danach benannten Straße. Ich kannte niemanden, der mich finanziell unterstützte, mir des Abends meinen „Strammen Max“ (Rühreier, Bratkartoffeln) in der Gastwirtschaft zum „Timpen“ in der Sutthauser Straße, gar den monatlichen Krankenkassen-Beitrag bei der AOK bezahlte.
Ich liebte die „Timpen-Kneipe“ mit ihren aus Bunt Glas verkleideten Fenster und rustikalen Knobelbecher Tischplatten. Sie gab mir etwas von jener verschämt gemochten Romantik, zu der sich kaum jemand öffentlich bekannte. Zu kitschig. Kaum dort, drückte ich Tastaturen der Musikbox – die nur Chansons der französischen Schlagersängerin kannten. Da war ich Abend für Abend mit „mon amie la rose“ den Abendwind fragend. Françoise Hardy vermittelte in ihren Liedern tiefe Melancholie, die in mir schon schlummerte; alle seien verliebt, nur sie nicht. Sie schrieb Lieder und debütierte 1962 im französischen Fernsehen mit ihrem Lied „Tout les garçons et les filles“. Im Regenmantel schlich sie da, apart und schüchtern, durch enge, verschlungene Gassen. Au backe.
Ich jedenfalls schlich nicht – ich trampte einfach gen Frankreich drauf los. Natürlich schaute ich gedanklich schon lange, lange Zeit über die Grenze. Deutsch-Französische Jugendlager an der Ostsee hatte ich in den Sommerferien bereits erlebt. Nach Frankreich selbst zog es mich zu jeder Ferienzeit zu meinem Freund Jean-Louis Damble nach Lyon-La Duchère. Frankophil nannte ich mich auch ungefragt. Dort ins Land von Albert Camus wollte ich hin, dort im Land der Französinnen und Franzosen wollte ich leben, lieben und auch lachen können. Es sollte noch Jahre dauern, bis ich mich westlich des Rheins heimisch fühlte.
Der Stadtteil La Duchère im neunten Bezirk mit seinen grau in grau hochgeschossenen Beton-Bananen sollte mein Ort des Rückzugs werden. Rechts und links ragten eilig montierten Platten des sozialen Wohnungsbaus in den Himmel, dem flüchtigen Einblick des Autofahrers entzogen. In diesem Getto lebten etwa 20.000 sogenannte Pieds-noirs (Schwarzfuß), Algerien-Franzosen, die nach der Unabhängigkeit Algiers 1962 Nordafrika verlassen mussten. Viele Pieds-noirs waren geradezu über Nacht umgesiedelt worden. Viele von ihnen hatten keine Wurzeln in Frankreich, La Duchère sollte ihre neue Heimat werden.
Mit meinem Freund, dem Pied-noir Jean-Louis, verband mich ein Fremdheits-Gefühl beschriebener Jahre. Wir beide waren Zugereiste. Wir lebten in einem anonymen Quartier mit Mutter Clairette und Schwester Ninou in der neunten Etage. Wir gingen oft wahllos durch die Straßen und lasen in Gesichtern der Passanten. Wir sprachen über die Ausdrucksweisen jener Menschen, denen wir begegneten. Wir redeten über ihre aufgesetzte Mimik, hinter der sich der wirkliche Ausdruck verbarg, den wir erraten wollten.
Sein und Schein Anderer, Gebrochenheit und Fremdheit blieben unsere Antriebsfedern. Das Zitat des ungarischen Schriftstellers György Konrad kannten wir damals noch nicht. Viel später drückte er aber zeitversetzt unser Lebensgefühl in jenen Jahren aus. „In der Heimat vermisst dich niemand, in der Fremde erwartet dich niemand.“ Seinerzeit konnten wir noch ahnen, dass uns die Jugendfreundschaft noch weit ins kommende Jahrzehnt tragen würde. In Schulferien bügelten wir Kleider wie Hosenanzüge in Reinigungen, putzten WCs im VW-Werk in Emden. Wir standen winkend an Autobahn-Auffahrten nach Barcelona, nach Stockholm usw. Nur über ein zentrales Anliegen hatten wir uns einvernehmlich verständigt, die Freundin des Freundes, die blieb tabu. Voilà.
Immerhin hielt es mich bei den Studenten-, Schüler- und Arbeiterrebellion nicht in der deutschen Provinz. Über Nacht trampte ich auf Autobahnen über die Schweiz nach Lyon; 5.40 Mark hatte ich in der Tasche. Von Autobahn zu Autobahn, von Raststätte zu Raststätte; Abfahrt um 14 Uhr in Osnabrück, 16 Uhr in Hagen, 20 Uhr Frankfurt am Main, 5 Uhr morgens in Genf am Grenzübergang St. Denis ins französische Département Ain. Endstation. Einreiseverbot für deutsche Schüler und Studenten. Angst vor weiteren Massenprotesten. Was also tun? Flüchten oder Standhalten? Rein in den unkontrollierten Kofferraum eines Franzosen, in dem ich mich kauernd krümmte und so die Grenze passierte. Weiter ging’s.
Ich wollte in Frankreich dabei sein, wenn Aufbruchs-Parolen nach Gerechtigkeit in Löhnen und Ausbildung über die Avenuen hallten, zischten. Ich erlebte, was in Deutschland unvorstellbar schien und bisher noch fortwährend ist. Generalstreiks, Massenproteste landauf, landab. Frankreich, unser Nachbar, lahmgelegt durch wochenlange Arbeitsniederlegungen und das ohne Streikgelder. Nichts ging mehr in der Republik mit ihren Institutionen. Morgenluft, Durchbruch.
Zehntausende, Hunderttausende von Menschen, ob Studenten oder Arbeiter (ein Novum), marschierten gemeinsam eingehakt auf den Boulevards. Autos flogen reihenweise um, kaum ein PKW fuhr, Pflastersteine aus Straßen rausgerissen und zu Schutzbarrieren aufgetürmt, Räumungsdiktate, Prügelattacken, Tankstellen ohne Sprit, kein Brot wurde gebacken, Barrikaden. Bürgerkrieg. Euphorie auf ein neues Leben. Rotwein, Chansons und Liebe in eng gewundenen Gassen. Klischees waren Wirklichkeit. La France.
Krieg machten freilich die Amerikaner in Vietnam (1965-1975), westwärts des Rheins probten junge Franzosen und Französinnen den Aufstand gegen selbstgerechte Väter, Unrecht, Willkür, gegen gesellschaftliche Verkrustungen. Sie forderten die freie Liebe. Sie suchten die sexuelle Revolution vielerorts auf dem Weg zu einer neuen Selbstverwirklichung, fernab vom moralischen Diktat katholischer Würdenträger. Der Mai 1968.
Meine Françoise Hardy im realen Leben war die um vier Jahre ältere Germanistik-Studentin Pierrette Michel53 aus Lyon. Ich lernte sie im deutsch-französischen Jugendlager in Heiligenhafen an der Ostsee im Juli 1966 kennen. Sie betreute in den Semester-Ferien oft als Monitrice viele Jugendliche aus beiden Ländern. Es war der Beginn des deutsch-französischen Jugendaustausches. Er ist bekanntlich nach dem deutsch-französischen Vertrag zwischen den Staatsmännern Charles de Gaulle (*1890+1970) und Konrad Adenauer (+1876*1967) geschlossen worden.54
Schon ihr französischer Akzent – wenn Pierrette deutsch sprach, „isch abbee disch geseenn“ (ich habe dich gesehen) – öffnete mein Herz. Ich war fasziniert von ihrem Temperament. Ich war beeindruckt von ihrem Selbstbewusstsein, von ihrem Selbstverständnis zu reden, sich einzubringen, ihre gesellschaftskritischen Beobachtungen in beiden Ländern coram publico zu formulieren. Letztendlich war ich berauscht vom Zärtlichkeits-Gefühl, als Pierrette meine Liebkosungen erwidern mochte. Solch seine feminine Vehemenz war mir in Deutschland noch nicht begegnet. Für mich war in diesem Sommer jeder Tag ein emotionaler Ausnahmezustand, wie ihn der Sänger Pascal Danel in seinem damals aktuellen Schlager „Kilimandjaro“ einzufangen suchte. Ich liebte süße, sentimentale Augenblicke, die in der Wirklichkeit kaum eine Entsprechung fanden. Kitsch.
Wir schrieben uns. Zu Weihnachten 1966 fuhr ich noch in den alten Bahnhof Perrache in Lyon ein. Ich eilte zu Pierrette in die rue de Dieu im Stadtteil Villeurbanne. Typisch Frankreich, dachte ich, Baguette, Baskenmützen, Gauloises, Gitanes Papier Maïs, freundliche Menschen, an jeder Ecke eine Bar mit Musik und Wehmut. Durch Gänge und Treppenhäuser eilten hier inmitten der Stadt die Menschen, durch ein labyrinthisches Gewirr der Traboules, deren Passagen sich hinter ganz gewöhnlichen Haustüren verbergen. Allzu leicht kann man sich verlaufen. Lyon. Doch ich wollte bei ihr bleiben, mit Pierrette mein Leben teilen, für immer sein. Dort in dem heruntergekommenen Altbau mit seinen morschen Fensterrahmen, auf den ausgetretenen, knarrenden Treppenstiegen. Ja dort und nur dort, wollte ich mein neues Leben beginnen, Franzose werden.
Sie lachte, schien gerührt und antwortete: Wir machen Revolution in diesem Land, ich bin in der Uni und bei den Demos auf den Straßen. „Ich habe keine Zeit für einen Mann, für die Liebe. Ich brauche auch keinen Typen – weder Softie noch Macho. Ich bin eine radikale Marxistin. Radikal zu sein heißt, das Übel an der Wurzel zu packen. Dies und nichts anderes realisieren wir jetzt. Morgens arbeite ich in der Fabrik, um mein Studium zu bezahlen, nachmittags Vorlesungen, abends Demos. Und das Tag für Tag, Monat für Monat. Geh zurück nach Deutschland, lies im philosophischen Werk „Das Sein und das Nichts“ (1943) von Jean-Paul Sartre (*1905+1980) und lerne, lerne denken und handeln. – Adieu. Es sollte 23 Jahre dauern, bis ich Pierrette wiedertraf.
Eine alte Regel besagt, Urerlebnisse wirken am nachhaltigsten. Sie beeinflussen Einstellungen, sie bestimmen Verhaltensweisen, sie prägen sich unauslöschlich ein. Fernab meiner Affinität nach Romantik lernte ich als Schüler in Frankreich an den Elite-Universitäten zu Lyon für junge Leute in meinem Alter unvorstellbare gewalttätige, sadistische Rituale kennen. Wie zu Beginn oder auch mitten des Semesters zu Neujahr haben sich die Aspiranten der Grandes Écoles einer besonderen Tauglichkeits-Disziplin zu unterwerfen: „le bizutage“ genannt.
Ich war verstört, schockiert, als ich erlebte, wie junge Franzosen etwa in meinem Alter, sich draußen auf dem Land mit Alkohol abfüllten und angetrunken mit Latten, Stöcken wie Fäusten aufeinander einschlugen. Debattierten wir nicht sonst über Chancengleichheit in der Bildungspolitik oder auch soziale Gerechtigkeit? Nichts dergleichen. Ich war entsetzt, wie sorglos sich Studentinnen für ihre „Miss Nympho“-Wahl entkleideten, sich filmen ließen. Elite-Rituale, Klassen-Rituale, Männer-Spiele wiesen einen schmalen Weg in ein längst vergessen geglaubtes Milieu.
In früheren Jahrzehnten war die Bizutage, die seit der Zeit von Napoleon III. (1851-1870) existiert, quasi eine Taufe; nichts anderes als ein „hübscher“ Schabernack, den ältere Studenten mit den Neuankömmlingen erlesener Lehranstalten trieben. Ein Initiationsritus, der mit der Fuchstaufe in deutschen schlagenden Verbindungen vergleichbar ist. Einfach deshalb, um den Schülern einerseits Ehrfurcht vor den Grandes Écoles zu nehmen, andererseits eingeschworenen Korpsgeist sinnlich erfahrbar zu machen – als einen neuen Lebensabschnitt sozusagen.
Zumindest bekamen mein französischer Jugendfreund Jean-Louis Damble und Reimar Oltmanns ein klassisches Aufnahmeritual jener sonderlich bizarren Frohsinns-Fassade zu spüren. Brav dinierten wir ein „Elite-Menü“ aus Katzenfutter und Urin. Wir tranken Unmengen frisch gezapftes Bier aus großen Krügen. Mittelalter am Ende des 21. Jahrhunderts mit designierten Oberschicht-Allüren. Nein Danke.
Zeitenwende, Epochensprung in die Moderne, gedanklicher Einschub: Im Mai 1968 erlebte Frankreich eine Jugendrevolte der Hoffnung. Im neuen Jahrtausend eine der Hoffnungslosigkeit. Im Mai 1968 wurde noch im Namen einer idealisierten Vergangenheit an die Politik, an Pläne, Projekte, Programm geglaubt; vier Jahrzehnte nur noch ans Faustrecht. Für die Achtundsechziger war die Droge ein poetischer Versuch. Ganz allmählich ist sie zur Plage geworden, eine Krankheit zum Tode.
1968 hatten viele Jugendliche Angst, „vom System vereinnahmt“ zu werden, ängstigten sie sich vor der Unmenschlichkeit der Wirtschaftsgesellschaft. Nunmehr fürchten sie sich fortwährend davor, noch weiter ausgegrenzt zu werden. Seinerzeit hätten die drei Toten während der Unruhen beinahe Staatspräsident Charles de Gaulle (*1890+1970)55 die Macht gekostet. Nunmehr sind Tote in den Gettos seelenloser Vorstädte zum Regelfall geworden. Ausgrenzung, Härte, Grausamkeit, Tod sind Routine. Alltag.
Aber auch dies: Hastiger, immer schneller rast die Zeit im zweitausendsten Jahrhundert. Der Mensch in seiner Maßlosigkeit hat die Orientierung weitgehend verloren. >Echtzeit< zwischen den Erdteilen ist fortan ein Erfordernis; Realraum, Telekontinente, Daten-Autobahnen, Cyber-Parks, Cyber-Sex lassen natürliche Grenzen verschwinden, jahrhundertealte gesellschaftspolitische Strukturen verwischen. Staaten zerfallen. Neue Begriffe, neue Lebensformen.
Die Länder auf dem Weg zum Einheitsgesicht, die Städte machen es vor. Atemlos zerhackt die Tele-Technokratie räumlich gewachsene Eigenarten mit ihren historischen Bezügen, Wahrnehmungen, Empfindungen. Kulturen werden unwiederbringlich ausgelöscht. Postindustrielle Unternehmen brauchen vieles, nur keinen Zeitabstand zu anderen Völkern und zur Erhöhung ihrer Produktivität keine Arbeitsplätze, keine Menschen mehr. Überall beklagt man Sinnverluste, Misstrauen, Zynismus – und das weltweit.
Damals vor mehr als vier Jahrzehnten konnte ich mir solch eine bahnbrechende Zäsur in unseren Gesellschaften nicht vorstellen. Sie sprengte meine Phantasie, mein Denkvermögen. Auch ich befand mich seinerzeit im Umbruch, Phasen neuerlicher Orientierungssuche. Aber was für eine konventionelle Wandlung, welch ein Häutungsprozess auf dem Weg ins Erwachsenenleben war das schon. Ich wusste es nicht, konnte es nicht einmal ahnen – noch nicht. Das Zuhause, das es für mich in dieser Form kaum gab, war längst zu einer Art Jugendherberge verkommen. Man begnügte sich damit, pünktlich zu sein und die Mahlzeiten regelmäßig einzunehmen.
Ich war ja nicht der einzige Zeitgenosse, der sich keineswegs in einem halbwegs intakten Elternhaus eingebettet wusste. Für all meine Freunde oder auch Kumpane waren ihre Familien längst kein geborgenes Zuhause, kein Hort zum Auftanken mehr. Irgendwie waren und fühlten wir uns vogelfrei; vielleicht auch „ausgesetzt“, wenngleich das niemand so klar zu formulieren wagte. Zumindest gab es keine sogenannten Eltern-Schutzräume mehr, selten Gespräche, zu selten, in denen seelisch labile oder auch leistungsgeplagte Jugendliche ihre Kräfte sammeln konnten. Familien-Zerrissenheit.
Verständlich, dass ich keine sonderlichen Berührungspunkte zu meiner Mutter suchte. Ich wollte, wie viele meiner Freunde, ein anderes, sinnerfülltes Leben. Diese einsilbigen „Friss-Vogel-oder-stirb“-Diktate blieben erstickend. Ich bekam schon Atemnot, wenn ich hörte, miterlebte, wie die Älteren bedingungslose Anpassung an fragwürdige Normen in der Arbeitswelt von uns einforderten. Dem zu folgen, wäre einer Selbstaufgabe gleichgekommen. So bekam ich reichlich wenig mit für meine Zukunft; kaum Verwertbares aus dem Elternhaus, keine gedanklichen Perspektiven, keine Dialoge, weder Geld zum Lebensunterhalt, keine Fresspakete oder Jeans, noch Ratschläge, wobei diese auch Schläge sein können. Nörgelnde Apathie. Desinteresse.
Meinen Lebensunterhalt, von Frankreich kommend wieder in Osnabrück, sicherte ich mir zwischenzeitlich als Lagerarbeiter in der Spedition Hellmann in den Morgenstunden ab 5 Uhr. Tag für Tag Kisten zu stapeln und Kartons zu entladen hatte ich praktisch zehn Stunden lang. Sperrgüter im ohrenbetäubenden Lärm der Lagerhallen unter Neonbeleuchtung hefteten sich an mein Gemüt. Immer und ewig diese schweren Kartonagen, sie ließ mich nicht mehr los in meinen Gedanken. Sie sollten mich auch in Träumen späterer Jahre unliebsam begleiten. Knochenarbeit.
Tagsüber träumte ich davon, als Jungpolitiker die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Gedankenverloren, vielleicht ein wenig weltfremd betrat ich schon des Morgens den Tag. Mich interessierte keine Berufsausbildung, kein Studium. Meine Perspektive hieß Politik, Parlament, Diskussionen, Resolutionen, Demonstrationen. Ich fühlte mich auch im gesellschaftlichen Gefüge irgendwie „draußen vor der Tür“.
Auf meinem Bett-Hocker lag in besagten Tagen das Drama „Draußen vor der Tür“56, das der Schriftsteller Wolfgang Borchert (*1927+1947) noch kurz vor seinem Ableben über den Kriegsheimkehrer Beckmann verfasst hatte. Beckmann hatte Hunger, fror, humpelte, nur noch eine Kniescheibe und einen Soldatenmantel, der ihn in der Nachkriegszeit wärmte. Ihm, dem Außenseiter Wolfgang Borchert, dem lang verkannten Literaten, glaubte ich schon seit jeher verbunden zu sein.
Es war sicherlich das gefühlte Außenseiter-Dasein, das mich zu einer stoischen Besessenheit verleitete. Ich hörte auch gar nicht richtig hin, wenn beispielsweise mein staatlicher Vormund, das Fräulein Helene Klaebig, mich eindringlich ermahnte, wenigstens eine Lehre zu beginnen. Gedanken, Fühlen wie Handeln galten den häufig erwähnten „Marsch durch die Institutionen“. Er entsprach meiner Seelenlage, meinem Bedürfnis. Diese Strecke wollte ich gehen, komme, was da wolle bis nach Bonn als Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
Zu meiner gedanklichen Richtschnur jedweder Maßstäbe gesellte sich neben der Freiheit gleichsam der Begriff von der Gerechtigkeit. Zudem träumte ich von einem selbstbewussten, intellektuell angehauchten Mädchen, das in ihrer Außenwirkung vielerlei Diskussionen zu bestreiten vermochte. Trotzdem sollte sie eine Frau sein, die mich des Abends mit einem Steak oder auch „Strammen Max“ bediente. Sie sollte den Haushalt, auch mich versorgen und mir mitten in der Nacht meinen Exegesen zum gesellschaftlichen Kampf um Emanzipation, Gerechtigkeit und Mitbestimmung lauschen. Ich sah mich schon als einen jungen Pascha. An dieser eingeübten Rolle fand ich nichts Absonderliches, Abweichendes. Ein junger Pascha, der fortwährend über Politik fabulierte. Gleichsam auch ein kleiner Macho, der von der zweiten Phase der Frauenbewegung57 noch keinen Deut, keinen Impuls mitbekommen haben will.
Wir lernten uns am 27. November 1968 im Kaufhaus Hertie in Osnabrück kennen, genauer gesagt in der Eingangshalle, die zwischen dem Neuen Graben und der Seminarstraße lag. Wir redeten so viel, so unablässig aufeinander ein, als würde uns die Zeit gestohlen, als hätten wir nichts, auch uns nicht zu verschenken. Meinen ersten Kuss gab ich Hilde im Eingangsfoyer. Dabei hatten wir offenkundig ganz vergessen, dass wir beide akkurat gekleidete Hertie-Mitarbeiter waren.
Fünf Jahre zuvor wurde hier im edel wirkenden Kaufhaus Hertie schon üppig gefeiert mit Musikkapellen und einer langen Tafel für Bauarbeiter und geladenen Größen aus Politik und Wirtschaft. Das hypermoderne Hertie wurde neu eröffnet und galt als Inbegriff des neuzeitlichen, bahnbrechenden Fortschritts mit Dachparkplatz und „Autofahrstuhl“, mit einer eigenen Parfümerie-Abteilung, weitflächigen Restaurants, Getränke-Bar. Der Publikumsandrang war jedenfalls so gewaltig, dass Polizisten den Auto-Verkehr auf dem Neumarkt umleiten mussten. Staus an den Verkaufsständen, Staus auf den Straßen, nur keine Staus im Portemonnaie. Eines der Kaufhäuser, das nach 23 Jahren wegen Misswirtschaft kleinlaut schließt musste, war seinerzeit die Hauptattraktion in diesem Ort. Wer von sich etwas hielt und erhobenen Hauptes zeigen lassen wollte, der flanierte um und in Hertie. – Zeitgeschmack.
Die Verkäuferin in der Eingangshalle hieß Hilde Meinders, sie war 21 Jahre alt, von recht kleiner Gestalt, blonder Bubikopf, Grübchen in den Wangen, Witz wie Lebenslust signalisierten ihre blauen Augen. Sie lachte viel, auch wenn es an diesem frühen, schon bitterkalten, abweisenden Morgen wenig schelmisch zu lachen gab, weil der Wind nur so durch den Eingangsbereich zischte. Aber Hilde lachte. Sie kam aus Nordhorn, einem etwa 50.000 Einwohner zählenden Emsland-Städtchen direkt an der Landesgrenze zu den Niederlanden gelegen. Hilde studierte eigentlich im dritten Semester an der Pädagogischen Hochschule, Hauptschul-Lehrerin wollte sie werden. Sie verkaufte in der Eingangshalle in den vorweihnachtlichen Wochen Adventskränze. Nebenjob.
Keine zwanzig Meter von ihr entfernt, da bediente ich Hertie-Laufkundschaften an meinen Regalen, dem Schallplattenstand mit einlullenden Melodien, auch ewigen Gassenhauern. Zum Verkaufsrepertoire des Massengeschmacks zählte nun mal das Liedchen „Wenn du einsam bist“ vom Schlagersänger Ronny (Wolfgang Roloff *1930+2011). Da hatte ich entsprechend der Verkaufsförderung täglich dreißig-, gar vierzigfach die „Hohen Tannen“ und „Dunja du“ herunter zu nudeln.
Die Komik unserer Hertie-Begegnung war nur, dass wir beide uns tatsächlich einsam fühlten und wohl auch waren. Wir, Hilde und Reimar, redeten ja viel, sehr viel, so als lauerte allein schon im Faktor Zeit oder im Tagesablauf eine uns bedrohende Gefahr, die uns auseinanderreißen könnte. Wahrscheinlich wollten wir keine Leere entstehen lassen, die unsere beiden Ängste des Verlassens sein in den Vordergrund spült.
Hildes Mutter starb, als sie noch ein Kind war. Die zweite Ehe ihres Vaters Hermann Meinders (*1916+2007), Pädagoge in einer einklassigen Dorfschule im Örtchen Bookholt, scheiterte an den Alltag zerfressenden Eifersüchteleien zwischen Stiefmutter Renate und ihrem anvertrauten Töchterlein. In dem jungen Mädchen wurden Ängste gezüchtet, die irgendwo hinwanderten, aber nie abgebaut, verarbeitet worden sind. Oft waren es berechtigte Gefühle des Bedroht seins, die die Studentin vereinnahmten. Schlug die Stiefmutter in regelmäßigen Abständen mit flacher Hand auf sie ein – natürlich vom Vater unbemerkt.
Vater Hermann, ein rechtschaffender Pauker, zeigte wenig Einfühlsamkeit für sein Töchterchen. Er konnte sich derlei rüde Handgreiflichkeiten seiner weitaus jüngeren Frau so gar nicht vorstellen. Kinderfantasien seien das, so vermutete er; dort draußen im flachen Emsland, wo das einsilbige Diktat dem Mädchen ihren Lebensatem zu unterbrechen vermochte. Ob Schule oder Lehrerhaus, sie blieben halt stets, was sie waren und ausstrahlten: bäuerlich, pingelig, engherzig.
Zumindest blieb Hilde mit ihrer Furcht allein, ganz allein, mutterseelenallein im großen Schulhaus, umgeben von weiten Marschfeldern, Koppeln und die Seele einschläfernden Blicke auf Kühe wie Lämmer, die nicht weichen wollten. Meist verzog sie sich auf ihr Zimmer, was blieb ihr auch anderes übrig. Nun starrte sie in ihrer kleinen Butze auf den alten Kleiderschrank, der vor ein paar Jahren noch das Schlafzimmer ihrer Eltern schmückte, schaute auf ihr Lundia-Regal, in dem sich Kafka, Beckett und Walser aneinanderreihten.
Hilde lag oft auf ihrem Mädchen-Bett und versuchte ihre Gedanken zu bündeln, was ihr aber nicht gelang. Sie fühlte sich elend, „kotzübel“, wenn sie an die immer und immer wiederkehrenden Szenarien und Ausfälle ihrer Stiefmutter dachte. Und sie hatte eine immense Wut auf ihren Vater, der lange Zeit nichts unternommen hatte. Das jedenfalls war und blieb ihre Ohnmacht, die sie seither begleitet. Misstrauen, Furcht abermals enttäuscht zu werden.
Seit dem Tag des Kennenlernens teilten wir unser Bett, waren und fühlten uns unzertrennlich. Wir bedurften einander, gaben uns Halt, Zärtlichkeit. Wir spürten schon, dass wir in eine Zeit hineingehen, die keinen Raum mehr lasse für menschliche Tragik, da sie mittlerweile zu banal, zu selbstverständlich geworden war. Wirklich?
Es war tatsächlich der Beginn einer, wie ich es später nannte, „Kinder-Ehe“ zwischen Hilde und Reimar. Hier hatten sich zwei noch minderjährige Jugendliche gefunden. Sie hatten kein Geld, um zu überleben. Sie hatte praktisch nichts außer ein paar Bücher und Textilien. Auch war es nicht die Suche nach Sex, nicht die Leidenschaft, nicht die Suche nach Nähe in Diskotheken, nicht die gemeinsame Gestaltungskraft künftiger Jahre, die sie prägten. Vielmehr war es das in ihnen schlummernde Bedürfnis nach verlässlichen konstanten Gefühlen, eine wahrhaftige Partnerin, vielleicht im Gegenüber ein Zuhause gefunden zu haben. Behutsamkeit.
Drei Wochen blieben wir in einem Zimmer. Drei Wochen waren wie ein Tag, sie huschten im Nu an uns vorüber. Wir rührten uns wenig. Wir redeten, schauten uns immer wieder an, als wollten wir das Unbegreifliche in unseren Blicken festhalten, stumm andeuten – Hilde und Reimar. Wir schliefen miteinander, lasen uns Texte und Gedichte vor, hörten Mozart58, unaufhörlich Mozart. Zwischendrin tönten dann mal The Beatles59 mit ihrem Song „Hello Goodbye“, das wir uns nicht sagen wollten oder auch konnten.
Wir spürten unsere Beklemmungen, unsere Verwirrungen. Wieder stockte unser Atem. Wieder schlich sich Vergangenes mit irgendwelchen scheinbar belanglosen Einzelheiten in die Gegenwart ein. Diese ewig dauernden Sonntagsspaziergänge, die Hilde Sonntag für Sonntag zu befolgen, die sich in die Erinnerungen eingenistet hatten und nicht weichen wollten. Artig hatte sie zu sein, einfach artig.
Es war ein Promenadenlauf, gähnend langweilig bei Wind und Wetter. Sie hasste ihn, weil er sich so kleinbürgerlich-artig und damit auch auffallend borniert ausnahm. Unnahbar waren die Leute, die sich einander begegneten, verklemmt, verschlossen. Später mit Beginn des Studiums hockte Hilde oft in verqualmten Buden wie Kneipen. Nähe und Durchbruch? Wohl eher nicht. Ok, das war sie schon im legendären Jazz-Keller in der Pädagogischen Hochschule. Man redete über die neue Linke, über Sein oder Nichtsein in diesem Land. Jedenfalls gab es damals noch keine Naturfrische oder gar Fitnessstudios. Stumpfe Blässe, dunkle Augenringe und die Nickelbrille waren >in<.
Nach drei Wochen schlenderten wir über das Einkaufszentrum namens Große Straße. Vorbei an der neuen heilen Welt kunterbunten Schaufenster-Auslagen. Auch wir konnten nicht widerstehen. Beim Juwelier Heinrich Kolkmeyer probierten wir Verlobungsringe für 160 Mark. Die hatten wir ja noch vom Schallplatten- und Adventskranz-Verkauf im Hertie-Kaufhaus. Kaum vorstellbar, dieser Fingerschmuck aus Leichtmetall sollte uns noch lange Jahre begleiten. Am 10. September 1970 heirateten wir.
Dessen ungeachtet bereitete ich mich in den Sechzigerjahren unbewusst auf politische Um- wie Aufbrüche vor, von denen damals eigentlich niemand ahnen konnte, dass sie bevorstanden. Intuitiv spürte ich es schon. Nur vermochte ich es intellektuell nicht zu benennen. „Das Morgen im Heute lebt, es wird immer nach ihm gefragt“. In diesem vom marxistischen Philosophen Ernst Bloch60 (*1885+1977) formulierten Satz fand ich mich wieder. Und Ernst Bloch formulierte weiter: „Die Gesichter, die sich in die utopische Richtung wandten, waren zwar zu jeder Zeit verschieden, genauso wie das, was sie darin im Einzelnen, von Fall zu Fall, zu sehen meinten.“
Mein avisierter Trampelpfad führte mich selten auf die Schauplätze des Protests, zwischen Wasserwerfern, Barrikaden wie Fernsehkameras. Dabei gab es mehr als nur einen berechtigten Grund die „Väter als Täter“ zu brandmarken. Es waren nicht so sehr Demonstrationen, Straßenkämpfe, die mich anlockten. Das hatte ich hinlänglich in Frankreich mit wild um sich schlagenden, speziell ausgerichteten CRS-Polizisten erleben müssen. Gewalt gegen Personen, aber gleichsam Gewalt gegen Sachen befand ich nach meiner Drangsal-Zeit – auch mit meinen Heim-Erlebnissen – als rückwärtsgewandt, nicht lebensfähig.
Stattdessen faszinierten mich Ideen-Momente über den Liberalismus61, den zentralen Gedanken des Menschen um über die Freiheit, seine individuelle, geistige, gesellschaftliche Freiheit; Liberalität als idealtypisches Gedankenmuster. Derlei Gedankensplitter zogen mich nach Kriegsjahren, Konzentrationslagern wie unsäglichen Barbareien in seinen Bann. Danach waren gemäß dem Volkslied des Dichters Hofmann von Fallersleben (*1798+1874) nicht nur „die Gedanken frei“.
Es war die Reisefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Berufswahl und gegen staatliche Bevormundung, die Religionsfreiheit, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung – eben ein freies Land, in dem das freie, angstfreie Individuum die größte Wertschätzung widerfuhr. Faszination. Durchatmen. Von derlei Visionen, von diesem Verfassungstext war ich überzeugt, wollte ihn in der Verfassungswirklichkeit eingeklagt wissen.
Folglich machte ich mich auf zur FDP – der Freien Demokraten Partei Deutschlands62. Es war die Überzeugungskraft von einem der markanten Gründerväter des Liberalen Thomas Dehler (*1897+1967), Bundesminister der Justiz von 1949 bis 1957. Der Politiker Dehler zählte zu jenen FDPlern, die sich ergebnisorientiert gegen einen rechtskonservativ, braun angehauchten Kurs der nationalen Vereinigung aussprachen. Seine von freiheitlichen Geist getragenen Reden und Vorträge hörte ich mir des Abends auf Wahlveranstaltungen an, seine Schriften las ich, zugeschickt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Es war eine kantige Politiker-Sprache, die ihres gleichen suchte – fernab von griffigen, aalglatten Parteislogans aus der Abteilung Werbung und Marketing.
Thomas Dehler positionierte seine Partei in Weitsicht vieler Jahrzehnte zwischen dem konservativen wie auch sozialdemokratischen Block – eine liberale Bewegung der Mitte und des gesellschaftlichen Ausgleichs. Er vergaß dabei keineswegs auf die soziale Verpflichtung des Eigentums hinzuweisen. Er sollte mich in meinem politischen Denken beeinflussen. Thomas Dehler war ein unverwechselbares Ur-Gestein der Liberalen. Einst war er Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Personen seines Formats gab es damals wenige. Sie wurden auch in späteren Jahren zunehmend rarer.
Es war die beherzte Juristin Emmy Diemer-Nicolaus (*1910+2008), die mich mit Begeisterungsfähigkeit für politische Reformen um die Humanisierung des Deutschen Strafrechts, um den Abtreibungsparagraphen 218, um die Teilzeitarbeit für Frauen nachhaltig politisierte. Unweigerlich lenkte sie das Augenmerk auf mein Engagement bei der FDP-Nachwuchsorganisation der Jungdemokraten. Heute wissen wir, dass die Juristin und Bundestagsabgeordnete Emmy Diemer-Nicolaus als Bundestagsabgeordnete (1957-1972) ihrer Epoche um Jahrzehnte voraus war. Kärrnerarbeit. Frauen-Arbeit. Lange Jahre sollte es noch dauern, sehr lange.
Zurück in die FDP-Verhältnisse gen Osnabrück. Sie trafen sich regelmäßig an den Abenden der Donnerstage zu ihrem Stammtisch, die ehrenwerten Herren des FDP-Kreisverbandes, die Honoratioren dieses Städtchens. Sie waren, wie sollte es auch anders sein, unter sich. Sie bevorzugten es, im Halbdunkel ihre Reihen zu schließen. Sie trafen sich hinter Butzenscheiben und Fachwerkfassaden bei Bier und Korn am runden, rustikalen Stammtisch im Ratskeller des im spätgotischen Stil erbauten Gewölbes. Keine Frage, sie liebten allesamt altdeutsche Heimeligkeiten und das Gemauschel untereinander. Ämter schachern, Posten verschieben, Diäten kassieren. Männer.
Nicht etwa auf Verladebahnhöfe des Tauschhandels, sondern auf die Schaltzentralen politischer Macht hatten sie es abgesehen. Schon ihre Bier lallende Präsenz im Halbrund des Saales verriet ausladende knorrige, patriarchale Züge. Ihre Sprache lebte von kaltschnäuzigen Tönen und wegwischender Verachtung politischer Konkurrenten. Als Mitglied der Jungdemokaten (djd), sogenannter Abgesandter der jungen Generation, durfte ich in diese FDP-Gesichter im Kreise gucken einmal, zweimal, dreimal – dann nicht mehr. Aha-Bekanntschaften. „Gelobt sei, was hart macht“, dachte ich mir. Das war seinerzeit ein Bundeswehr-Leitmotiv, das ich mir auch als Kriegsdienstverweigerer zu merken hatte – notgedrungen. Alt-Herren-Liberalen.
Im übertragenen Sinne waren es ja unsere Väter, unsere politischen Väter, die sich da in den Ratskellern der Republik im Halbdunkel verschanzten. Ich blickte abwartend in das zerfurchte und verlebte Antlitz des FDP-Matadors dem Landtagsabgeordneten Erich Konrad (*1910+1987). Er war kein irgendjemand, er war ein in den fünfziger Jahren einflussreicher Senator63 dieses Ortes, ein Strippenzieher. auch Vorsitzender des Schlachthof-Ausschusses in Osnabrück.
Erich Konrad, der im Polizeibataillon 101 im August 1941 das Getto im polnischen Lodz errichtet hatte. Er, der im Jahre 1944 als Sturmbandführer, das entspricht einem Major der Wehrmacht, in das Führerkorps der Schutzstaffel der NSDAP aufgenommen wurde. Allseits akzeptiert, bewundert. Er hatte sich nicht zu rechtfertigen, in Partei und Öffentlichkeit zu erklären. Jede Frage nach seiner Vergangenheit glich einer persönlichen Beleidigung, Verunglimpfung seiner Person. Diskussion verpönt. Leitfiguren.
Vis-à-vis hockte Konrads zugereister niedersächsischer Landtagskollege Gustav Ernst (*1914+1999) aus Braunschweig, als „Gustav Pattje-Fuss“ verniedlicht. Welcher Zufall im Plenarsaal des niedersächsischen Parlaments tuschelten die Herren Parlamentarier emsig, ihm, dem „Pattje-Fuss“ eine Rolle vom dänischen Komiker Duo Pat & Patachon aus der Stummfilmzeit zuzuweisen. Des Abends in den Kneipen gerierten sie sich als Opfer, als Verführte der Nazi-Zeit. Selbstmitleid. Dabei einte sie ihre braune Vergangenheit als unbarmherzige Väter-Täter.
Auch Ernst hatte in Hitler-Jugend und Partei als hoher Funktionär Schleifspuren angelegt. Sie einte auch gleichsam ihre Zukunft, ihre Gestaltungskraft: nämlich ausgerechnet diese erste von der braunen Vergangenheit unbelastete, frech daherkommende junge Generation aus den politischen Gremien fern zu halten. Sie, die Aufmüpfigen in späteren Jahren als Feinde der Verfassung64 durch Parteiausschluss aus der FDP verschwinden – über die Berufsverbote in den siebziger Jahren brandmarken zu lassen. Freiheit in Deutschland. Sendungsbewusstsein. Leitfiguren verflogener Epochen.
Ob die Politiker Konrad oder Ernst – nicht nur diese Provinz-Figuren der Zeitgeschichte waren in ihren Köpfen, in ihrem Denken und Verhalten noch immer in den Schützengräben unrühmlicher Dekaden des Krieges. Sie wollten partout nichts dazu lernen, keine Erkenntnisprozesse, keine Reue, keine Reflektion, keine Nachdenklichkeit. Trotz, Selbstbehauptung, Bockigkeit waren die Charakter-Merkmale jener Väter-Täter. Nichts kennzeichnet die geistige Verwirrung, ja die Restauration des Landes besser als ausgerechnet ihre unentwegte, ungefragte Bereitschaft, die „wehrhafte Demokratie“ zu verteidigen.
Wer hatte sie gerufen, diese selbst ernannten Verteidiger der Freiheit? Gegen wen wollten sie, die einstigen Nazi-Täter, ihre Freiheiten geschützt wissen? Stand die parlamentarische Demokratie auf dem Spiel? Nein. Musste in der Bundesrepublik gar ein Umsturz befürchtet werden? – Nein. Es waren die Knüppel mit Totschlag-Argumenten weitestgehend gegen eine lästige, hinterfragende Jugend, oft links von SPD und FDP. Gesellschaftliche Ausgrenzungsversuche. Wie charakterisierte der Frankfurter Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich (*1908+1984)65 die Gemüts- und Erkenntnisfähigkeit, den Verdrängungszustand schlechthin. in den sechziger Jahren:
„Statt einer politischen Durcharbeitung der Vergangenheit als dem geringsten Versuch der Wiedergutmachung, vollzog sich eine explosive Entwicklung der deutschen Industrie. Wertigkeit und Erfolg verdeckten bald offene Wunden, die aus der Vergangenheit geblieben waren. Wo aufgebaut wurde, geschah es fast buchstäblich auf den Fundamenten. Das trifft nicht nur auf die Häuser, sondern gleichfalls auch für den Lehrstoff an unseren Schulen, für die Rechtsprechung und für die Gemeindeverwaltungen zu. Die politische Routine, die sich immer mehr in ein spanisches Zeremoniell des Proporzes hinein entwickelt, bringt kaum originelle Versuche, produktive Phantasien in die politischen Gegebenheiten wirksam werden zu lassen.“
Wenige Monate stand ich mit vielen Hunderten Gleichgesinnten in der Halle Gartlage in Osnabrück klatschend auf den Stühlen. Damals dichtete und sang der Protest-Barde und APO-Anwalt Franz-Josef Degenhardt (*1931+2011): „Nun wisst ihr es. Uns ist es nicht genug, in jedem vierten Jahr ein Kreuz zu malen. Wir rechnen nach und nennen es Betrug, wenn es gar keine Wahl gibt bei den Wahlen.“
Dessen ungeachtet hatte der langen Marsch durch Institutionen, Gremien und Ämter auch für mich begonnen. Es war ein Aufbruch ohne Ankunft, Abend für Abend für Liberalen Schülerbund und Deutsche Jungdemokraten auf Podien und Diskussionsveranstaltungen. Dort in verlassenen, in sich gekehrten, dahin schlummernden niedersächsischen Provinzen. Angekommen bin ich nirgendwo, weitergezogen bis heute – immer und immer wieder.
Dabei wollte ich raus aus den eng empfundenen Quadraten in ländlicher Umgebung, raus aus dem Neoproletarier Mief jener niedersächsischen Autostädte, die sich mit dem VW-Initial schmückten. „Warum bleibe ich in dieser Provinz“, fragte ich mich? Demos in Berlin, Hamburg, Frankfurt oder auch Amsterdam gab es hinlänglich. „Warum kam ich nicht los vom sogenannten „Dumpfbackentum“. Dort, wo hinter Butzenscheiben und Fachwerkfassaden, der altdeutschen Heimeligkeiten, so manche Misthaufen versteckt wurden, die niemand zu lüften gedachte. Wollte ich mich nicht ein für alle Mal verabschieden von Adjektiven, die mit Eigenschaften wie „weltfremd, dörflich, kleinbürgerlich wie spießbürgerlich“ an mir hefteten; ein miefiger Stallgeruch, der nicht weichen wollte.
Und nun das, Hinwendung zu ausgerechnet dieser ehedem bespöttelten Provinz. Kehrtwende? Was faszinierte mich denn da an ausgemergelten deutschen Provinzen? Zu Menschen in Ländern, die damals intellektuell ausgegrenzt, belächelt wurden, nicht en vogue waren, sich ignorant gaben? Sie waren es ja auch, die hinlänglich den Verdacht kultivierten, einer Remythisierung oder auch neuerliche deutsche Nationalisierung durch den damaligen NPD-Vorsitzenden Adolf von Thadden (*1921+1996) gehörig Vorschub zu leisten.
Es zog mich dorthin, wo die moderne linke Bewegung, die studentische Avantgarde der Außerparlamentarischen Opposition bislang noch nicht vorbeigeschaut hatte weder durch Demonstrationen noch durch Teach-ins. Ich schien wieder hier angekommen zu sein, woher ich kam. Ein Provinzler aus deutschen Landen zwischen Kühen, Stoppelfelder, Waldwegen und Baggerseen; vielleicht auch bei dem Italiener oder Griechen zum Abendessen auf Marktplätzen. Genauer gesagt zwischen Harz und Nordsee, wo fünfmal so viele Hühner wie Menschen (fünf Millionen) lebten. „Sturmfest, erdverwachsen sind die Niedersachsen …“, so lautet der Refrain der vom Komponisten Hermann Grote (*1885+1934) vertonten Welfenhymne.
Aufklärung war nun einmal der zentrale Begriff meines Denkens, der mich fortan faszinierte. Ein Zitat des Philosophen Immanuel Kant (*1724+1804) schmückte über Jahre mein Bücherregal. „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbst verschuldeten Unmündigkeit.“