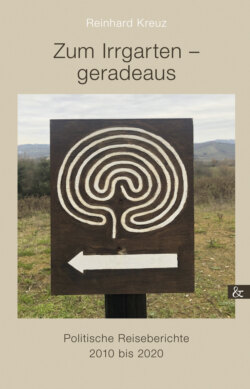Читать книгу Zum Irrgarten - geradeaus - Reinhard Kreuz - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTHE DECLINE AND FALL OF EVERYTHING
Amerikanische Erschütterungen 2011
Die Amerikaner nennen es that sinking feeling, das leicht hohle Gefühl im Bauch, wenn plötzlich der Boden zu schwanken scheint, wenn sich Abgründe auftun und die Annahmen des Vortags, die Grundlagen unseres Handelns, wie naive Träume dastehen. Ich sitze auf der Terrasse meiner Freunde in Maryland und suche nach etwas, das bleibt. Die alten Bäume vielleicht – einige wurden kürzlich gefällt, um bei Sturm nicht auf das Haus zu fallen – oder die wilden Tiere, die seltsam weltvergessen ihrem Tagwerk nachgehen. Eichhörnchen mit ihren buschigen, grauen Schwänzen jagen die Bäume hinauf und hinunter und ganz oben, ganz langsam, kreisen Bussarde.
Vor mir die Zeitung und der Bildschirm meines Handys verkünden nur Schreckensmeldungen. Wir schreiben den August 2011, soeben wurde Amerikas Kreditwürdigkeit herabgestuft und weltweit stürzen die Aktienmärkte um mehr als 20 Prozent.
Bad News Sells, das weiß ich wohl, und häufig sind es ja nur die Titelblätter, die den Untergang verkünden, während die Analysen durchaus differenziert ausfallen. Mit »Aus der Traum. Was das Ende der Supermacht für uns bedeutet« hatte die Wirtschaftswoche kürzlich aufgemacht und am Ende das Wort vom »Ende« dann doch zurückgenommen. Dass der Spiegel, mit »Gelduntergang«, die übliche »Systemkritik« ohne Alternativen betreibt – geschenkt.
Aber Time Magazine? The Decline and Fall of Europe (and Maybe the West) titelt das renommierte Wochenblatt und das wahre Gruseln kommt erst im Textteil. Von einer »neuen Wirklichkeit« schreibt Rana Foroohar und macht auch in ihrer Analyse den Untergang Roms1 zum Sinnbild der Gegenwart. Die Erwartung einer stets besseren, reicheren Zukunft müsse aufgegeben werden, kein »Ausrutscher« (blip) sei die gegenwärtige Krise, sondern der Vorbote einer neuen Weltordnung. Plötzlich will mir der Morgenkaffee aus JoAnns italienischer Espressomaschine nicht mehr schmecken. Kenneth Rogoff, der bekannte Finanzökonom, spricht von der Second Great Contraction, der zweiten großen Schrumpfung der Weltwirtschaft nach 1929, in der wir unsere Erwartungen an Lohn- und Beschäftigungsniveaus, Bildung und öffentliche Dienstleistungen massiv reduzieren müssten. Die westliche Idee der Wohlstandsmehrung sei am Ende, resümiert Time, a whole new era habe begonnen.
Auch wenn sich eine »Ära« immer erst im Nachhinein bestätigt – aus den meisten Kommentaren spricht ein Gefühl von Abschied und Trauer. Etwas scheint zu Ende zu gehen: die Zeit des lockeren Geldes und des Quantitative Easing, der niedrigen Zinsen und der Aufnahme stets neuer Hypotheken auf eine als blühend erwartete Zukunft. Wenn Probleme der Gegenwart, mittels Schulden, auf die Nachwelt verschoben werden, spricht der Amerikaner vom kick(ing) the can down the road. Now, spottet ein Witzbold im Fernsehen, the can is kicking back. We’ve downgraded ourselves, schreibt Fareed Zakaria in Time. Unser politisches System ist zerrüttet, wir wollen eine starke Regierung und gleichzeitig niedrige Steuern und ohne Magie führt nur ein einziger Weg dorthin: Schulden.
Auch die haben am Ende nichts genützt, Borders Books ist pleite. Die größte amerikanische Buchhandelskette hat ihren Kampf mit der digitalen Welt verloren. Die Nachricht geht mir nah und das nicht nur, weil ich gern auf Papier lese. Fast ist mir, als hätte ich ein Stück Heimat verloren. Ich fahre extra nach Bowie, um mich zu vergewissern. Der ehemalige Laden ist leer und dunkel und auf dem Fenster klebt ein schlichter weißer Zettel: Borders Books is now closed.
Ob es ein Segen ist oder ein eher zweifelhaftes Vergnügen, dass ich Tage später doch noch eine offene Borders-Filiale finde? Auf der anderen Seite der Hauptstadt, in Sterling, VA, grüßt mich von Ferne ein buntes Schild auf dem vertrauten Gebäude: Going out of Business! Gibt’s da was zu feiern? Innen ist nichts mehr vertraut. Im ehemaligen Café, wo ich oft und lang vor meinem Brownie und einem Cappuccino gesessen habe, werden jetzt die Regale an den Meistbietenden verhökert. Was an Büchern noch da ist, ist teils lieblos am Boden gestapelt und drastisch reduziert. Die Gunst des Rabatts ist dabei recht ungleich verteilt: Sex and Romance oder Fantasy gibt’s um 40 Prozent billiger, Politik und Philosophie um 70 Prozent. ›Geschieht ihnen recht‹, fährt es mir durch den Kopf, als ich unter dem Politikramsch auch Autoren finde, die der Würde des Wortes so manchen Schlag versetzt haben: Glenn Beck und Sarah Palin, Ann Coulter und George W. Bush.
Plötzlich scheint mir alles in trübe Farben gehüllt, so als würde ich durch dunkle Gläser blicken. ›Wer das Wort nicht schätzt, kann wohl auch nicht mit Zahlen umgehen‹, denkt es in mir als ich die langen Tabellen an den Wänden finde. Prozentrechnen leicht gemacht – viel scheint das Management von unseren Rechenkünsten nicht zu halten. Ein Buch, das 22 Dollar gekostet hatte, lese ich, sei bei 50 Prozent Rabatt schon für 11 zu haben. »Na denn«, sage ich mir und unter die Trauer mischt sich die stille Lust am Sparen. Dann decke ich mich in einem Maße mit Neuheiten ein, dass ich um das Höchstgewicht meines Fluggepäcks fürchten muss.
Trübe Gedanken verscheucht am besten die Natur und da trifft es sich gut, dass mich die Freunde nicht nur mit gutem Essen und guten Gesprächen verwöhnen, sondern auch mit Ausflügen ins Umland von Maryland. Bevor wir an die Küste aufbrechen, ins malerische Städtchen Solomons, schauen wir noch bei Jan vorbei. Die Witwe aus der Nachbarschaft ist für ihr soziales Engagement bekannt und lebt vom Verkauf von Eiern. Sie besucht Kranke und Sterbende, singt ihnen vor, und hat auf ihrem Grundstück geschundenen Tieren eine letzte Zuflucht bereitet, darunter einem Esel. Wie so häufig wird Gutes mit Gutem vergolten: Statt der 2 Dollar, die sie für das Dutzend Eier verlangt, gibt JoAnn ihr regelmäßig 3.
Die nächste Unterbrechung unserer Fahrt ist nicht geplant. Ein quer zur Fahrbahn geparkter Pickup veranlasst David zu einer scharfen Bremsung und noch bevor ich das Ganze begreife, begrüßen JoAnn und David den Fahrer.
Douggie the Sharkman ist eine Institution in Calvert County und sein Pickup ein Verkaufsstand. Das Produkt ist ungewöhnlich. Haifischzähne, ca. zwanzig Millionen Jahre alt, werden vermehrt entlang der Küsten von Calvert gefunden und zeugen von der einst tropischen Unterwasserwelt des hiesigen Miozän. Blaugrau schimmernd mit kleinen Zacken trotzen die antiken Beißer dem Zahn der Zeit und werden an Schnüren einzeln zum Verkauf angeboten. Die Freunde suchen sich je eine Kette aus und auch mich überzeugt die Geschenkidee. Vielleicht hilft ja das Fossil, die eigenen wenigen Lebensjahre, deren Fortschreiten uns so nahe geht, in einen weiteren Kontext zu stellen.
Auch scheint der Kauf eine gute Tat zu sein denn JoAnn unterbindet mit einem Rippenstoß meinen Versuch, den recht hohen Preis per Mengenrabatt zu reduzieren. Er wolle das Geld für eine dringende Reparatur benutzen, sagt Douggie und öffnet den Mund zu einem breiten Lachen. Darin prangt, ca. fünfzig Jahre alt, ein einsamer, schadhafter Zahn.
Die Küsten von Calvert bewahren das sorgsam gepflegte Andenken an ein Geschehen, das hier vor zweihundert Jahren erstmals Zweifel am Bestand des amerikanischen Experiments auslöste. Die Zweifel waren wohl begründet. Im britisch-amerikanischen Krieg von 1812 landeten die Engländer an diesen Stränden, zogen siegreich plündernd nach Washington hinauf und brannten die unfertige Hauptstadt nieder. Auch das Weiße Haus wurde ein Raub der Flammen. Seither wird immer wieder, vom Bürgerkrieg bis in die Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts2, der Abgesang auf Amerika angestimmt. Auch in diesen Tagen erklingt er laut und vielstimmig. Die Probleme sind tatsächlich gravierend und Besserung scheint nicht in Sicht. Für die allgemeine Überschuldung und den Verlust an Industriekompetenz, für die schleichende »Verdummung« und eine nie dagewesene »Gehässigkeit« des öffentlichen Diskurses (Fritz Stern) lassen sich glaubhafte Zeugnisse finden. Dennoch lebt in mir ein gewisser Widerstand gegen die vorausblickende Geschichtsschreibung. Ich beschließe, mir Arthur Hermans The Idea of Decline in Western History3 wieder vorzunehmen. Dort kann man nachlesen, wann und warum schon früher, angeblich, immer alles am Ende war. Neigen wir im Westen nicht dazu, das manchmal recht banale, irdische Geschehen mit endzeitlichen Kategorien zu überfrachten? Schließlich wurde das Weiße Haus wieder aufgebaut und auch heute sind die Voraussetzungen nicht schlecht für einen Turnaround. Wir könnten also, wenn im weltlichen Kontext von »Anfang« und »Ende« die Rede ist, und von dem, was dazwischen liegt, von »Ära« und »Epoche«, eine gewisse Skepsis walten lassen und kritische Prüfung der Fakten.
Natürlich geht manches den Bach runter. Spontan fallen mir gewisse Umgangs- und Vergnügungsformen ein. In David McCulloughs Buch »1776« lese ich, wie die Engländer im Unabhängigkeitskrieg, als die amerikanischen rebels Boston belagerten, unter Kanonenbeschuss Bälle abhielten und Theaterstücke aufführten, auch selbst geschriebene.4 Ich stelle mir heutige Truppen in ähnlicher Lage vor.
JoAnn, die Meisterköchin, denkt eher an die Qualität ihrer Töpfe. So etwas wie das Kochgeschirr der Marke All-Clad, das sie von der Mutter geerbt hat, gebe es heute nicht mehr. Auch sei das moderne Leben hektisch und nervös geworden, zu reichlich das Angebot und zu groß die Sorge, das Beste darunter zu verpassen. Und weil sie auch gern kommuniziert und alle immer gleich Antwort wollen, sitzt sie oft ein bis zwei Stunden am Computer. Auch David schätzt seinen alten Grill von GE; ansonsten aber ist er kategorisch: No sane person wünsche sich eine Zeit zurück »ohne Antibiotika, Wasserklosetts und schmerzloser Zahnbehandlung«.
Ich auch nicht und doch möchte ich manchmal gern gefragt werden bevor sich etwas ändert. Seltsames Ansinnen. Ein vertrautes Fleckchen Erde in Tyson’s Corner, VA, erkenne ich kaum wieder und bin beleidigt. Die bekannte und breite Route 7, die hier durchführt, ist anfangs unauffindbar und erst allmählich begreife ich warum: Über der Straße wird auf riesigen, vorgefertigten Betonpfeilern die Silver Line geführt, die neue U-Bahn zum Flughafen Dulles. Monsterkräne auf Kettenraupen heben und senken die Betonpfeiler während ich unten durchfahre. Alles ist neu. Ein kleines Shoppingcenter am Straßenrand, das einige meiner Lieblingslokale- und Geschäfte vereint und mir über die Jahre ein Stützpunkt geworden war, liegt völlig verändert und geduckt im Schatten der Betongiganten. Missmutig verzehre ich auf den gewohnt harten Eisenstühlen vor Panera mein biologisch korrektes Mittagessen. Plötzlich bebt die Erde – ein scharfes kurzes Rucken ohne sichtbaren Ursprung, das sofort wieder einhält. Nur der Sonnenschirm über mir schwankt noch eine Zeit lang bedenklich. Ich verdächtige die Baumaschinen oder Racheakte des rundum aufgewühlten Bodens, aber die Mittagsgäste um mich, die sofort ihre Handys zücken, bringen schon bald eine andere Kunde: Es hat ein Erdbeben gegeben an Amerikas Ostküste und die Stärke betrug 5.9 auf der Richterskala.
Im Wegfahren sehe ich die Menschentrauben vor den Bürohäusern – Evakuierungen aus Vorsicht – und alle Radiokanäle sind auf Call-in geschaltet für die teils besorgten, teils kuriosen Berichte der Betroffenen. Bisher scheint kaum jemand verletzt. Die ersten Gouverneure treten auf und versichern uns ihrer Wachsamkeit, Moderatoren beruhigen mit sanfter Stimme und im Äther entsteht – an einem Nachmittag, der »normal« zu werden drohte – die Gemeinschaft der Erschütterten. Keine Stunde nach dem Ereignis verkündet die erste Restaurantkette im Radio das Special des heutigen Abends: Alle Hauptgänge gibt’s aus aktuellem Anlass für 5 Dollar 90.
Nicht um einen Mangel zu beheben oder das Ende von Borders zu kompensieren, sondern aus purer Freundschaft und Fürsorge haben JoAnn und David in meinem Zimmer ein paar Bücher deponiert. Darunter finde ich die 100 Decisive Battles von Paul K. Davis5 – Kampfdarstellungen mit hervorragender weltgeschichtlicher Einordnung – und unter ihnen wiederum eine Überraschung: nicht Gettysburg wird als Entscheidungsschlacht des amerikanischen Bürgerkriegs gewertet, sondern Antietam (oder Sharpsburg, wie die Südstaatler sagen). Und da ich schon fast alle Schauplätze des Krieges im Großraum Washington besucht habe und noch nie in Sharpsburg war, mache ich mich an einem trüben Tag auf in den westlichsten Winkel von Maryland.
Als ich in Leesburg die Washingtoner suburbs hinter mir lasse wird die Gegend mit einem Male ländlich und lieblich, mit weißen Zäunen und roten Scheunen, und gleichzeitig hellt sich der Himmel auf und die noch regennassen Wiesen und Felder leuchten in fast unwirklicher Schönheit. Unwirklich vielleicht auch deshalb, weil ich gleichzeitig vor meinem geistigen Auge die Marschkolonnen in Grau erblicke, abgerissene, aber siegesgewisse Südstaatler, wie sie hier erstmals im Sommer 1862 in Feindesland vordringen und sich entlang des Antietam River zum Kampf aufstellen.
Über eine Schlacht gelesen zu haben und an ihrem Schauplatz zu stehen ist für mich immer zweierlei. Eine schmale Senke, die damals völlig mit Leichen gefüllt war, markiert als Bloody Lane den blutigsten Tag der amerikanischen Militärgeschichte (12. September 1862, ca. siebentausend Tote). Ich brauche den »realistischen« Film im Visitor Center gar nicht, um eine Mischung aus Grauen und Staunen zu empfinden. Einblick in die Motive erhoffe ich mir vom Werk eines bekannten Autors, das ich im Bookstore finde: James McPhersons Antietam6.
Rollende Hügel und Wiesen durchsetzt mit Monumenten, Schrifttafeln und Kanonen – Bürgerkriegsschauplätze sind in Amerika sorgsam gepflegte »Nationaldenkmäler«. In einem historischen Haus am Rande des battlefields begrüßen mich zwei freundliche Park Rangers in Uniform und beginnen ein Gespräch mit ihrem einzigen Besucher. Als ich meine Herkunft aus Deutschland offenbare, strahlt einer der beiden und zeigt auf ein deutsches Wort auf seinem Namensschild. Ich kann es anfangs kaum glauben, aber er nickt eifrig und stellt sich vor: »My name is Freiheit.«
Freiheit war das gemeinsame Motiv der Kriegsparteien, behauptet James McPherson in seiner klassischen Gesamtdarstellung des Bürgerkriegs. Ihr Titel, »Battle Cry of Freedom« (»Für die Freiheit sterben«), ist dem gleichnamigen Kampflied der Nordstaatler entlehnt, das die Südstaatler, mit eigenem Text unterlegt, bald ebenfalls sangen.7 Zwei unterschiedliche Ideen von Freiheit hatten offenbar die Kraft, von Menschen das größte aller denkbaren Opfer, Lincolns last full measure of devotion8 einzufordern. Und auch wenn man mit McPherson »handfestere« Motive als Triebkraft hinzufügt bleibt die Erkenntnis, dass manchem ein Leben ohne bestimmte Formen und Inhalte als nicht lebenswert erscheint.
Dieser Wille zum Absoluten ist weder historisch konstant noch segensreich, behauptet eine neue provozierende Gesamtschau des Krieges, auf die mich David hinweist. America Aflame von David Goldfield9 beschreibt das Denken und Fühlen des Landes vom Second Great Awakening der 1830er bis zum Ende der Wiederaufbauphase (Reconstruction) um 1880. Von der protestantischen Erweckungsbewegung der frühen Jahre »entflammt« war auch die Politik rigoros und moralistisch geworden, schreibt Goldfield. Von »gut« und »böse« ist jetzt viel die Rede und davon, den Westen »rein« zu halten von der »Sünde« der Sklaverei als ein »Neues Jerusalem« und Hoffnungszeichen für den Rest der Welt. Worauf die Pfarrer des Südens die Sklavenhaltung als »natürliche«, gottgewollte Ordnung entdecken, die es zu verteidigen gelte gegen die gottlosen »Lohnsklaven« des Nordens. Im Senat kommt es zu ersten Prügeleien und erst auf den Leichenbergen des unerwartet blutigen Krieges findet Ernüchterung statt. Schnell wendet sich die Nation dann anderen Göttern zu: dem Fortschritt, dem Wohlstand, und dem »natürlichen« Recht des Tüchtigen.
»Die politische Mitte schrumpfte«, »gemäßigte Politiker verschwanden«, »Demagogen triumphierten über Besonnene«, »Geister spukten in Washington« (ghosts haunted Washington), die Wirklichkeit floh (reality fled) – Worte, die die Politik der Bürgerkriegszeit charakterisieren sollen und die doch auch auf das Washington unserer Tage zutreffen. Aflame, again, nach einhundertfünfzig Jahren? Eines will das Buch uns sicher mitgeben: Brände sind leichter gelegt als gelöscht.
Dann darf mit Löschwasser nicht gespart werden, denken sich einige Milliardäre (billionairs) und stellen gewaltige Summen für wohltätige Zwecke zur Verfügung. Der reichste unter ihnen geht dabei am weitesten. Warren Buffett beklagt öffentlich, dass er prozentual weniger Steuern zahle als seine Mitarbeiter10 und lässt es zu, dass eine von Obama geplante Sondersteuer auf Millioneneinkommen Buffett Rule genannt wird. Die Antwort erhält er in einem Buch, das auch bei 70 Prozent Rabatt noch deutlich überbezahlt ist. Titel und Text will ich im Original zitieren, um eine bestimmte »Kultur des Wortes« zu illustrieren. In »Demonic. How the Liberal Mob is Endangering America« nennt Ann Coulter die wohltätigen Spender heads up their asses billionairs.11
Man muss ja nicht alles lesen. Vor allem das nicht, was unentwegt und unaufgefordert und auf unseren Bildschirmen aufscheint und sich »Info-Brief« nennt oder News Alert. In grellen Farben und großen Lettern wird uns der Untergang verkündet, vom »schlimmsten Börsencrash aller Zeiten«, »schlimmer als 1929«, bis zum »Ende unseres Finanzsystems«, dem man nur dann entgehen könne, wenn man bestimmte Edelmetalle kauft oder der »Aktie, die immer steigt«. Bezahlung für den heißen Tipp wird dann meist in jener Währung eingefordert, deren Ableben man soeben prophezeit hat. Und für den Fall, dass mit dem Geld auch die soziale Ordnung zusammenbricht, gibt’s im Internet ebenfalls guten Rat: Eine Website empfiehlt als beste Waffe im kommenden Überlebenskampf – die Armbrust.
Da tröstet es, zu wissen, dass die Schreckensmeldung von heute wahrscheinlich schon morgen überholt ist und ins Museum kommt – genauer gesagt ins Newseum, ins brandneue Museum für Medien an Washingtons repräsentativer Pennsylvania Avenue. Am Eingang kann man sich – mit Mikrophon in der Hand und dem Kapitol als Hintergrund – als Reporter fotografieren lassen und schon ist man mittendrin im großen Thema von Bild und Wahrheit, Geschehen und Geschichte. Lage und Architektur allein lohnen den Besuch und die gut erklärten, interaktiv präsentierten fünf Jahrhunderte Mediengeschichte – für die man allerdings Zeit mitbringen muss – gibt’s oben drauf.
Für Sophie, Karl und mich ist der Besuch ein trip down memory lane. All das kann uns nicht mehr erschrecken, all das haben wir schon hinter uns, sagen uns die Bilder des Vietnamkrieges und das Riesenstück Berliner Mauer samt Originalwachturm. Selbst die verbeulte Spitze eines Twintowers ist schon – wenn auch noch recht frische – History. Von ihr bleibt, sagen uns die großen, bekannten »Fotos des Jahres«, vielleicht nicht mehr als ein paar starke Bilder.
The American people don’t believe anything until they see it on television. Richard Nixons prominent platzierter Satz führt uns ein in die Problematik der »Mediengesellschaft«. Da gibt es die »Helden«, die eine Nachricht unter Gefahren ans Licht bringen, und da gibt es die vielen und wachsenden Gefahren ihres Missbrauchs: Nachricht als Desinformation, Nachricht als Unterhaltung, Nachricht als Nervenkitzel und Spielfeld des Vordergründigen zum Schutze lichtscheuer Wahrheit. Für all dies gibt es hier Beispiele und allmählich bin ich ganz benommen vom Dauergewitter alter und neuer Breaking News. Ich suche im Giftshop Zuflucht und erstehe ein T-Shirt mit einem Spruch, der, wie alle guten Sprüche, Winston Churchill zugeschrieben wird. 1940, am Tiefpunkt von Englands Fortune, sei er gefragt worden, was er jetzt zu tun gedenke. Keep Calm and Carry on. Der Satz wird mir, in den Turbulenzen der kommenden Tage, freundliches Lächeln eintragen und manch wissendes, zustimmendes Kopfnicken.
Ich brauche kein Museum, das mir die Zeitgeschichte spiegelt und anderen die Geschichte, um meine Jahre nachzuzählen. Es genügt schon, dass ich ein neues elektronisches Gerät zu »konfigurieren« versuche, meinen instinktiven Widerstand gegen »Schulden« spüre oder ab und an, schlichtweg, etwas vergesse. Sophie, die demnächst in Pension geht, schenkt mir ein Buch zum Thema: »Gettin’ Old Ain’t for Wimps« (etwa: »Altwerden ist nichts für Feiglinge«) von Karen O’Connor12. Der Bestseller mit humorvollen, »wahren« Geschichten aus dem Leben jener, die man hier lieber elderly oder older nennt, ist selbst schon etwas in die Jahre gekommen und so unterstreicht Sophie ihre Medienkompetenz, indem sie mir einen aktuellen »Link« zum Thema anfügt. Darin räumen ungenannte senior citizens zwar augenzwinkernd die eigenen Schwächen ein, behaupten aber mit Emphase, sie seien es nicht gewesen, die uns
»Beziehungen ohne Liebe
Benehmen ohne Höflichkeit
Elternschaft ohne Verantwortung
Ausgaben ohne Maß und
Sprache ohne Stil«
eingebrockt hätten. Die Liste geht weiter und wird wohl kaum ungeteilte Zustimmung finden mit Ausnahme vielleicht des letzten Aufrufs, der das Thema »Altern« übersteigt: Go Green – Recycle Congress!
Der aufmunternde, positive Grundton des Rundbriefs – das let’s be happy while we’re here – erregt den Zorn der amerikanischen Sozialkritikerin Susan Jacoby. In ihrem neuen Buch Never Say Die13 kämpft sie an gegen das Trugbild des Alters als einer sich ständig verlängernden Phase von Weisheit und Wohlergehen – Eldertopia. Der Jugendwahn der Boomergeneration mit ihrem Glauben an die therapeutische Formbarkeit von Wirklichkeit, die Hoffnung auf medizinische Wunder und die Geschäftemacherei der Anti-Aging-Industrie hätten uns den Blick verstellt für die Wirklichkeit. Da hilft Jacoby nach und zeichnet aus Alzheimer und Altersdepression, Armut und Abhängigkeit ein ernüchterndes Bild vor allem der letzten Lebensjahre –lohnende wenn auch oft schmerzliche Lektüre. Materiell seien Amerikas »Alte« (wie sie sie immer nennt) nicht nur durch mangelnde Ersparnisse und unsichere Anlagen in Häusern und Wertpapieren bedroht. Paradoxerweise geraten sie als Empfänger der einzigen wenn auch unterfinanzierten staatlichen Sicherungssysteme – Medicare uns Social Security – in die Schusslinie der Politik: als Neidobjekt im Generationenkampf und Sparpotenzial für die unumgängliche Sanierung der Haushalte. Dabei reicht’s schon jetzt hinten und vorne nicht. Und künftig erscheinen die Probleme als derart gewaltig, dass schwer zu erkennen ist, wie Jacobys Forderung eines »gerechteren Generationenvertrages«, einer more perfect union of generations, durch mehr collective social responsibility – sprich Umverteilung – allein erreicht werden kann.
Vielleicht sind am Ende ja doch auch jene Qualitäten gefragt, gegen die Jacoby so herzhaft polemisiert: Haltung und »Weisheit« als die spezielle Form der Horizonterweiterung, die der Einsicht in Vergänglichkeit entspringt. Als bekennende Atheistin versagt sie sich alle höheren Tröstungen, spart ihre Kraft für das große Reformwerk auf und verspricht uns, mit fünfundsechszig, an angry old woman zu sein und zu bleiben. Na denn. Immerhin schenkt sie uns, auf der letzten Seite des Buches, den letzten Satz ihrer neunundneunzigjährigen Großmutter: »Es ist gut, zu wissen, dass die Schönheit der Welt auch ohne mich fortbesteht.«
Wenn sie es denn tut. Irene ist im Anmarsch, und wie immer wenn schöne Mädchennamen das amerikanische »Sommerloch« füllen ist Gefahr im Verzug. Ein hurricane, ein Monster von einem Sturm, zieht aus der Karibik herauf und fordert schon lange vor seinem Eintreffen sein erstes Opfer: das Nervenkostüm von Millionen. Das zweite Naturereignis dieser Woche ist eines mit Ansage und was das bedeutet muss man erlebt haben: Full media coverage oder Fernsehen ist gleich »Sturm gucken«. Ein riesiger, dick drohender Wolkenwirbel füllt die allgegenwärtigen Bildschirme und im Minutentakt malen Computer den wahrscheinlichsten Pfad der Zerstörung. Washington liegt ebenso darauf wie New York und Neuengland. Autofahrer werden gezeigt, wie sie in Panik die Küstenstraßen verstopfen, Ladenbesitzer, wie sie ihre Schaufenster vernageln, und in Nordkarolina, wo Irene auf Land trifft (landfall), schreien windgezauste Reporter im Ölzeug gegen das Wetter an. Wer nicht selbst darauf kommt, den erinnern auch gern die Experten: Katrina ist erst sechs Jahre her.
Dummerweise kommt Irene am Tag meines Rückflugs in Washington vorbei. Keep calm, sage ich mir am Morgen, und beobachte die Golfspieler, wie sie seelenruhig vor meinem Hotelfenster ihre Abschläge üben. Gerade in Zeiten der (Medien)stürme will ich den eigenen Augen trauen. Per E-Mail wird mein Flug für den Abend bestätigt und gegen Mittag setzt leichter Regen ein, der langsam stärker wird. Ich beschließe, auf die allenthalben stattfindenden HurricaneParties zu verzichten (obwohl ich das passende T-Shirt hätte). Ich bin lieber früher am Flughafen und betrachte mein windgepeitschtes Flugzeug durch die Scheibe. Per Handy versuche ich, meine Lieben zu beruhigen. Wir starten pünktlich. Kraftvoll und ohne Erschütterung schraubt sich der Riesenvogel auf einen scharf nördlichen Kurs und lässt Irene rechts liegen. Ich atme durch. That lifting feeling.
Dezember 2011
1 Edward Gibbons berühmte Geschichte vom Niedergang und Untergang Roms ist hier zur Metapher geworden: The Decline and Fall of the Roman Empire, London 1776–89.
2 Ich kann mich noch gut an das Jahr 1968 erinnern, als sich in unserem Blätterwald das Vietnam-Debakel, die Ermordungen Robert Kennedys und Martin Luther Kings und die brennenden Slums zum »Ende des amerikanischen Traums« verdichteten.
3 Arthur Herman, The Idea of Decline in Western History, New York 1997
4 David McCullough, 1776. America and Britain at War, London 2006
5 Paul K. Davis, 100 Decisive Battles. From Ancient Times to the Present, New York 2001
6 James M. McPherson, Antietam. The Battle that Changed the Course of the Civil War, New York 2002
7 Ders., Battle Cry of Freedom. The Civil War Era, New York 1988. Ders., Für die Freiheit sterben. Die Geschichte des amerikanischen Bürgerkrieges, Köln 2011
8 Lincolns berühmte Umschreibung des Soldatentodes aus seiner Gettysburg Address wird mit »höchstes Maß an Hingabe« nur unzureichend übersetzt.
9 David Goldfield, America Aflame. How the Civil War Created a Nation, New York 2011
10 Während die amerikanische Einkommensteuer bis zu 35 Prozent beträgt, werden Kapitaleinkünfte, die den Löwenanteil von Buffetts Einnahmen ausmachen, lediglich mit 15 Prozent besteuert.
11 Ann Coulter, Demonic. How the Liberal Mob is Endangering America, New York 2011, S. 4
12 Karen O’Connor, Getting’ Old Ain’t for Wimps, New York 2004. 2010 wurde der Titel von Joachim Fuchsberger »geguttenbergt«.
13 Susan Jacoby, Never Say Die. The Myth and Marketing of the New Old Age, New York 2011