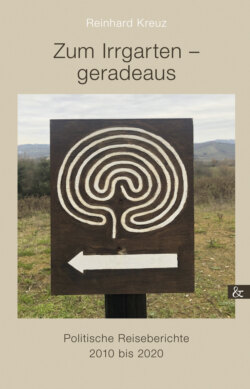Читать книгу Zum Irrgarten - geradeaus - Reinhard Kreuz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеYES WE CAN – WITHOUT YOU
Amerikanischer Volkszorn im dritten Krisensommer
Ich lasse mich gern überraschen und weiß, dass ich auch diesmal, im Sommer 2010, Unerwartetes erleben werde, wenn ich erneut, wie in jedem Sommer, die mir wohlvertraute Gegend von Washington besuche. Diesmal aber habe ich mir etwas Konkretes vorgenommen. Bereits im Vorfeld habe ich so viel Erstaunliches gehört, dass ich mit einer offenen Frage ins Land komme und hoffe, aus der Summe meiner Erlebnisse eine Antwort abzuleiten. Vielleicht bin ich ja auch ein wenig irritiert, dass manche Vorgänge in diesem so oft bereisten Land mir neuerdings nicht in den Kopf wollen.
Wie kann es sein, dass ein Präsident, der mit so viel Hoffnung und klarer Stimmenmehrheit gewählt wurde, den die Quasi-Totalität der Europäer, auch ich, gern gewählt hätten, nach achtzehn Monaten wie gelähmt dasteht, von Misstrauen umgeben und tief gesunken in der Gunst der Wähler? Warum kann Barack Obama das Land nicht reformieren mit der coolen Brillanz, die ihn doch weiterhin auszeichnet? Offensichtlich fehlen mir da ein paar Steinchen im Baukasten meines Erklärungspuzzles.
Natürlich weiß ich, dass die Amerikaner traditionell ihrer Regierung misstrauen. Dies sei Teil ihrer cultural DNA und eine gute Sache, hat der Präsident selbst erst kürzlich bei einem Townhall Meeting erklärt. Ich muss nicht einmal meine Landung in Washington abwarten, um eine erste Illustration dieser Neigung zu erleben. Aus dem Filmprogramm meines Fluges wähle ich Brooklyn’s Finest, einen Action-Thriller mit Richard Gere. Er zeigt uns die Menschen von ihrer miesesten Seite: kleine und große Gangster – und Polizisten –, die mit Gewalt einen Ausweg aus dem Sumpf der Gewalt suchen. Die Cops sind sogar die treibende Kraft dieser Blutorgie und am schlimmsten treiben es ihre Vorgesetzten. Um der nächsten Beförderung aus Washington willen werden »kleine Fische« gnadenlos ans Messer geliefert. Macht, sagt uns der Film, auch öffentliche Macht, korrumpiert. Die Polizei nicht als Freund und Helfer, die Polizei – der Staat – als Problem!
Aber muss man mir diesen Gedanken derart drastisch nahebringen? Die Einreiseformalitäten, Immigration genannt, sind seit jeher ein Geduldstest, aber an diesem Abend wird eindeutig übertrieben. Aus der Endlosschlange müder Wartender, Deutsche und Spanier, Inder und Russen mit Omas und schreienden Babys, steigt missmutiges Gemurmel auf. Ganze zwei officers sind damit beschäftigt, Fotos zu machen und die richtige Antwort auf die Frage zu prüfen, ob man je Terrorist gewesen sei. Was nicht ist, kann ja noch werden, schießt es mir durch den Kopf, als ich nach zweieinhalb Stunden endlich drankomme. Selbst die Faust in der Tasche ballen geht nicht, die Finger werden für Fingerabdrücke gebraucht. Ob der Zweck meiner Reise Business oder Pleasure sei? »We shall see«, höre ich mich sagen.
Damit nicht genug der Behinderung. Mein Koffer ist kurzfristig verschwunden, beim Autovermieter wartet die nächste Menschenschlange und auf dem Beltway, Washingtons berühmtem Umgehungsring, steht der Verkehr. Erst nach weiteren Stauerfahrungen und Lektüre der stolz formulierten Hinweistafeln werde ich es später begreifen: Hier werden Mittel aus dem American-Recovery-and-Reinvestment-Programm verbaut, dem gewaltigen Stimulus Package der Regierung Obama.
Mir ist nach anderem Stimulus. Als ich um Mitternacht endlich durch die Eingangstür des Hauses meiner Freunde in Maryland wanke, fällt meine Begrüßung ungewöhnlich trocken aus: »Ich brauche einen Drink!«
JoAnn und David sind das, was man im amerikanischen Sprachgebrauch als Liberals bezeichnet. In unser europäisches Verständnis übertragen ist damit die linke Hälfte des politischen Spektrums gemeint, wenn man die rein europäischen Konnotationen von »links« dabei abzieht: ein wenig Sozialdemokratie ohne kommunistische Ahnherrschaft, Mitgefühl mit den Schwachen ohne Zweifel an deren Chancen, Kritik an selbst begonnenen Kriegen ohne Ablehnung alles Militärischen, Sorge um Natur und Umwelt ohne Verurteilung der Atomkraft. Aufgewachsen mit Rockmusik und Vietnamprotest, offen für neue Trends und Technologien, begreifen sich Liberals gern als »kritisch« und »bewusst«. Dass sie ihr Land lieben, schließt dabei nicht aus, seine Schattenseiten zu reflektieren: So sei sie halt nun mal, die amerikanische Mentalität, sagt JoAnn: Give it to me now! ›instant gratification‹, alles möglichst sofort, auch der versprochene Wandel. Dabei könne der Präsident doch keine Wunder wirken, etwa beim oilspill im Golf von Mexiko. Und dann sei da noch die »hässliche Rhetorik der Rechten«.
Ich meine sie zu kennen, the ugly rhetoric of the right, und stehe doch sprachlos vor ihren jüngsten Steigerungen. Ich stehe – buchstäblich – vor einem Kunstwerk der Ironie: Bei Barnes & Noble in Bowie teilen sich die Abteilungen True Crime und Current Affairs ein Regal – und ein Thema: wie man die Bösen zur Strecke bringt. Dabei sind die Inhalte der Hate-Obama-Literatur derart dürftig, dass ich mir das Resümee erspare. Mögen die Titel für sich selbst sprechen:
• Newt Gingrich, To Save America: Stopping Obama’s Secular-Socialist Machine
• David Limbaugh, Crimes Against Liberty: An Indictment of President Barack Obama
• Michelle Mackin, Culture of Corruption: Obama and his Team of Tax Cheats, Crooks and Cronies
• Pamela Geller with Robert Spencer, The Post-American Presidency: The Obama Administrations’ War on America
• Dick Morris, Eileen McGann, Catastrophe: How Obama, Congress and Special Interest are Transforming a Slump into a Crash, Freedom into Socialism and a Disaster into a CATASTROPHE … and how to Fight Back.
Warum verhaftet man den Kerl im Weißen Haus nicht einfach und sperrt ihn ein? Aus dem Regal, vor dem ich stehe, widerspricht kaum jemand. Ich suche die Träger des Hoffnungsbanners, die wortgewaltigen Polemiker der Linken, und finde keinen. Bill Maher, einer von ihnen, hat Obama gerade als »Bush light« beschimpft. Nur Jonathan Alter legt eine wohlwollende Bilanz des ersten Regierungsjahres vor1 und schreibt, Washington habe sich als Bollwerk des Business-as Usual erwiesen und die Obstruktionspolitik der Republikaner als knallhart und effektiv.
Woher aber nimmt die Opposition ihre Feuerkraft, nach acht Jahren Bush, Wirtschaftskrise und Irak-Krieg? Haben sich die Machtverhältnisse derart grundlegend verschoben? Seit vor dreißig Jahren ein anderer Kandidat den »Wandel« versprach und die Mehrheit junger Wähler ihren »Ronny« wählte, seit finanzstarke Thinktanks und Stiftungen2 täglich das marktliberale Credo zementieren und mächtige Medien wie Fox News und das rechte Talkradio ihre stündlichen Attacken reiten, hat die Linke ihre Meinungsführerschaft verloren. Sie reagiert mit Naserümpfen und überlegenem Kopfschütteln auf die Propagandakapriolen der Rechten, auf den Unfug mit den Deathpanels3 bei der Gesundheitsreform oder der angeblich fehlenden Geburtsurkunde des »Muslims« Barack Hussein (sic) Obama – und nährt so das Feindbild von der abgehobenen Elite. Die Tea-PartyBewegung erntet allenfalls Spott oder jene Art naturkundlichen Interesses, das man für Abnormalitäten bereithält. Von Flat-Earthern wird gerne gesprochen, zurückgebliebenen Deppen vom Schlage derer, die die Erde noch für eine flache Scheibe halten. Im Fernsehen reagieren der liberale Sender MSNBC und der Komiker Jon Stewart auf Glenn Beck und Sarah Palin mit Humor und Ironie – Florett gegen Hammer, aber manch feiner Geist, so mein Eindruck, lässt auch diese Waffe stecken.
Auch David macht Medienlügen für Obamas Bedrängnis verantwortlich und zeigt mir zustimmend einen Artikel der New York Times, dem Timothy Egan den schönen Titel Building a Nation of Know-Nothings4 gegeben hat. Microphone demagogues vom Schlage Rush Limbaughs oder die Talkmaster von Fox würden so lange Falschmeldungen wiederholen und sich gegenseitig zitieren, bis ein erheblicher Teil des Volkes diese Meinung übernimmt und etwa am Christentum Barack Obamas zweifelt. Eine culture of disinformation beklagt Egan, wachsende Unwissenheit, die gefährliche Kräfte an die Macht bringen könne.
Ich teile Davids Ärger über diese Methoden und werde doch den Eindruck nicht los, dass die Erklärung zu kurz greift. Die Reaktion der Liberals erinnert mich an einen Werbespot von AT&T, bei dem ein tapferes kleines Mädchen einen Geist mit Hilfe ihres Handys abwehrt. »It says, you’re not real. Sorry« – und der Geist verschwindet. Im November aber sind Wahlen und bei denen droht die demokratische Kongressmehrheit – tatsächlich – verloren zu gehen. So something’s real, der Geist bleibt.
Gestern wusste ich noch nicht, was ein Luau ist, und heute bin ich schon zu einem eingeladen. Das Wort bezeichnet auf Hawaiianisch ein Fest, bei dem ein ganzes Schwein verzehrt wird, und in amerikanischen suburbs dient die Idee gern als Rahmen für zwangloses Feiern im bunten Hemd. Zwanglos heißt nicht regellos, berichtet JoAnn, denn man habe sich abstimmen müssen unter den ehemaligen Arbeitskollegen und sich für das Fest jedes politische Wort verboten. Der Gastgeber sei strammer Republikaner, die anderen Gäste Liberals und sie wisse, wie das enden könne: Erst kürzlich habe sie bei einem Floridaurlaub eine Gesprächspartnerin auf offener Straße stehen gelassen, weil sie Obama schmähte.
In Columbia, Maryland, empfängt uns sanfte Hawaiimusik und die beschwingte Runde nimmt mich herzlich und selbstverständlich auf, auch ohne buntes Hemd. Blumenbekränzt und leicht bekleidet – wir sind auf einer poolparty – nähern wir uns den Genüssen. Es gibt tatsächlich ein Schwein, ein knuspriges Ferkel mit Orange im Maul. Ein Teilnehmer hatte abgesagt, weil der Gedanke an diese Mahlzeit seine Gefühle verletze.
Plätschern und Gelächter dringt vom Pool zu uns herüber. David erzählt vom Krieg. Hawaii sei die Zwischenstation auf seinem Weg nach Vietnam gewesen und als guten Sportschützen habe man ihn zum Dschungelkampf auf einem flatboat eingesetzt. »Just like in ›Apocalypse Now‹.« Der Horror des Nahkampfs beschleicht mich. Obuns aufgefallen sei, dass alle nach Kriegsende heimgekehrten Gefangenen, John McCain etwa, Offiziere gewesen seien? Einfache Soldaten nämlich habe der Vietcong nicht gefangen genommen, sondern nach meist tagelangen Foltern umgebracht. Deshalb habe er stets eine Kugel für sich selbst aufgespart und sei entschlossen gewesen, sie einzusetzen.
Ein Bündel widerstreitender Emotionen ergreift mich beim Blick in seine festen, leicht melancholischen Gesichtszüge: Bewunderung für diesen »liberalen«, herzensguten Mann, der diesen Krieg ablehnen kann ohne den Feind zu verklären, wie es bei uns gerne geschieht; dazu kommt bei mir ein leichtes Gefühl der Unterlegenheit, gepaart mit Dankbarkeit, dass ich diesen Teil der Wirklichkeit nie erleben musste. Der Kampf sei verloren, klingt es vom Nebentisch aus einer Damenrunde zu uns herüber: gemeint ist der Kampf ums Idealgewicht. Auf einem Hügel am Rande des Gartens tauchen zwei Rehe auf und blicken verwundert auf die schwankenden Girlandenträger.
Manchmal nützen mir die unzähligen Besuche im Land und die persönliche Vertrautheit gar nichts: Die »Andersartigkeit« Amerikas erwischt mich kalt. Ganz beiläufig erwähnt JoAnn auf der Rückfahrt vom Luau, sie habe nächste Woche shooting lesson. Die friedliebende, umweltbewegte JoAnn! Sie wolle vor ihrer Pistole nicht mehr Angst haben als vor einem möglichen Eindringling. Es sei schon manches passiert in der Nachbarschaft und David ergänzt im Propagandajargon des Vietnamkrieges: Er habe schon so manche Giftschlange »befriedet« (pacified). Tatsächlich liegen die Häuser weit verstreut in Dunkirk, MD., und Hügel und tief eingegrabene Flussläufe (ravines) machen die Landschaft unübersichtlich – und reizvoll.
Ob ich nun diesem Reiz folge oder mich um mein Idealgewicht sorge – ich will spazieren gehen in der späten Dämmerung dieses Abends. Der Himmel ist noch rot erleuchtet, aber die ersten Sterne blitzen schon und am Boden wandeln sich Bäume und Sträucher in schwarze Schatten. Ein Pick-up-Truck kommt mir entgegen auf der schmalen country road. Ich muss an die Geschichten vom Revolver denken und ein mulmiges Gefühl ergreift mich. Liegt da etwa einer entsichert auf dem Beifahrersitz? Zwei Gründe kennt man hierzulande, um bei Dunkelheit zu Fuß zu gehen: Autopannen und böse Absichten. Der Wagen wird langsamer, bleibt stehen und eine resolute Frauenstimme fragt, ob ich ok sei. »Ja«, sage ich und der Wagen fährt im Schritttempo weiter, bis er im driveway unserer Nachbarn zur Rechten verschwindet. Sie sei gewarnt worden, empfängt mich JoAnn später und lacht, vor einem nächtlich streunenden Sternengucker.
Zu unserem Amerikabild gehört die Mangelhaftigkeit des Sozialstaates, die Dürftigkeit staatlicher Leistung und Fürsorge. Dann aber begreife ich ein Phänomen nicht, das mir jetzt auf dem Luau erneut bestätigt wurde: Die Teilnehmer, ehemalige Staatsdiener, NASA-Mitarbeiter zumeist, einige von weniger auskunftsfreudigen Diensten, sind alle mit Mitte fünfzig in Pension gegangen, bei vollen Bezügen und Sozialleistungen. Einige haben danach das sogenannte revolving door gewählt und als consultants in der Privatwirtschaft noch einmal »richtig schön« Geld verdient. Sie habe manchmal fast ein schlechtes Gewissen, sagt JoAnn in einem stillen Moment zu mir, aber so seien nun einmal die Gesetze.
Mitte der Achtzigerjahre, noch bevor ich sie kennenlernte, hatte eine andere Freundin namens Carolynda einen schweren Autounfall. Ihren Beruf als selbstständige Inneneinrichterin konnte sie danach nicht mehr ausüben und die immensen Folge- und Operationskosten trägt seither die Allgemeinheit. Kürzlich musste ihr auch noch ein Bein abgenommen werden und ich besuche sie in ihrer Spezialklinik. Bei allem Leid, das sie umgibt, gewinne ich doch den Eindruck freundlicher, fachgerechter Zuwendung im Nursing and Rehabiltation Center.
Ein anderes befreundetes Paar muss mit einem anderen Schicksal fertig werden: Die Frau ist dreiundsechzig und muss noch arbeiten (in der Privatwirtschaft). Ihr deutlich älterer Mann ist an Alzheimer erkrankt und kann nicht mehr allein gelassen werden. Das Day Care Center in der Nachbarschaft verlangt 75 Dollar pro Tag und ist somit unerschwinglich. Da haben sie einen Antrag an den Landkreis (Montgomery County, MD) gestellt und zahlen für die Ganztagesbetreuung seither 7 Dollar 50. Es scheint ihn also zu geben – den Vater Staat.
Und wenn es ihn, den Staat, nicht nur gäbe, sondern wenn seine Allmacht und Allgegenwart uns gar unterdrücken würde? Eine Denkrichtung, die sich »libertär« (libertarian) nennt, behauptet genau dies und hat Hochkonjunktur. Der Staat sei nicht nur ein »Problem« (Ronald Reagan), sondern der Urquell allen Übels. Ein Hauptwerk des Genres, Robert Ringers Restoring the American Dream von 19795, steht frisch aktualisiert in den Regalen und verkauft sich gut. Zwar sei die Realität stärker als alle Ideologie und gewisse Freiheitsbeschränkungen müssten akzeptiert werden zugunsten von Sicherheit und Zivilisation, räumt Ringer ein, ansonsten aber bleibe er dabei: Der Mensch ist frei geboren und kann mit seinem Leben machen was er will, solange er gewaltfrei bleibt. Gewalt aber erfahre er täglich durch eine Politikerkaste, die ihn unter edlen Vorwänden beraubt und bevormundet.
Vernünftiges und Hanebüchenes stehen bei Ringer eng beisammen: vom Gesetz von Angebot und Nachfrage und dem Grundsatz, »dass man nicht mehr haben kann, ohne mehr zu produzieren« gelangt er schnell zur »Obamapression«, Obama’s war on prosperity, und »the current Marxist regime in Washington«. Um seine Freiheit wiederzuerlangen müsse der Mensch allmählich der staatlichen Daseinsfürsorge entwöhnt werden und auf beliebte Absicherungen wie Medicare, Medicaid und Social Security verzichten. Darin, dass dies auf Sicht eher unwahrscheinlich ist, stimme ich Robert Ringer zu.
Sophie und Karl haben mich zu »Red Lobster« eingeladen, einer auf Seafood spezialisierten Restaurantkette. Wer mit dem Meeresgetier »leichtes Essen« verbindet, wird schnell eines Besseren belehrt. Die Speisekarte besteht aus Fotos von farbig-fettglänzender Unwiderstehlichkeit und die Portionen sind groß. Man muss ja nicht alles »aufessen«, habe ich mühsam gelernt. Wer weiterblättert in der Karte und über die Nachtische hinausgelangt, den erwartet am Ende die Punktetabelle von Weightwatchers. Bin ich der einzige, der dies als Hohn empfindet – oder als Sonderleistung für Masochisten?
Offensichtlich nicht. Zwei Gruppen von Gästen an den Tischen dicht neben uns teilen bei aller Unterschiedlichkeit ein gewichtiges Faktum: Keiner von ihnen, Jugendliche eingeschlossen, wiegt weniger als 2 Zentner – die drei weißen Paare nicht, die einen schüchternen »Harry« hochleben lassen, und die drei Generationen Farbiger nicht, deren Jüngster ebenfalls Geburtstag hat. Man muss keine Magermodels mögen, um bei den Damen ein Gefühl von »zuviel« zu bekommen. Zum Schluss singen alle Happy Birthday und funkensprühende Sahnebomben werden gebracht, die bestimmt in keiner Tabelle stehen. Mir fällt das Schlagwort vom nationalen Notstand der obesity ein, aber da sei Robert Ringer vor: »No group of people […] has the right to tell you what you can smoke, drink or eat.«6
Ich habe meinen ganz persönlichen Seismografen in Amerika, ein Politbarometer aus Rattan und Glas: Es ist der Couchtisch meiner Freunde in Virginia und auf dem liegt stets der letzte politische Bestseller und verrät mir zuverlässig die jüngste Drehung des Windes. Nach Al Gore und Barack Obama in den Vorjahren finde ich in diesem Jahr ein Buch von Glenn Beck mit dem Titel »Glenn Beck’s Common Sense«7.
Meine Freunde sind nicht die einzigen einer durchaus gebildeten Schicht, die ich als hin und hergeweht erlebe von den Medienstürmen, verunsichert von Krise und Existenzangst, schwankend auf einmal, ob Barack Obama überhaupt Amerikaner sei, geschweige denn ein echter (real) Amerikaner. Glenn Beck sieht es so: Wir haben die Tugenden und Freiheiten der Gründergeneration verloren. Wir haben uns verführen lassen durch die Regierung und unsere Aufsichtspflicht verletzt. Die eigentlichen Übeltäter aber sind die inkompetenten, selbstsüchtigen, kontrollwütigen politicians beider Parteien. Make no mistake, this is a fight of Us versus Them … Ein Kampf sei entbrannt gegen those in Washington …
Es ist ein Sonntagvormittag im August und ich bin im Auto unterwegs zu Freunden, als mir der Ernst dieser Worte klar wird. Glenn Becks Stimme ist im Radio zu hören vor der tosenden Kulisse von hunderttausend Anhängern. Er spricht auf den Stufen des LincolnMemorials in Washington, in der Höhle des Löwen sozusagen, an genau jenem Augusttag, an dem Martin Luther King hier vor siebenundvierzig Jahren seine I-have-a-Dream-Rede gehalten hat. Symbolischer geht’s nicht. Restoring Honor heißt die Veranstaltung und nicht zum ersten Mal fällt mir das Wort restoring auf in diesen Tagen. Patriotische Gemeinplätze sind zu hören, das bewegende Zeugnis einer Kriegerwitwe und eine Rede von Sarah Palin. Dem berühmten Vorredner wird durchaus Respekt gezollt und die verwendeten Symbole sind im Vergleich zu früheren Auftritten fast konsensfähig. Dass aber diese Rally überhaupt stattfindet, auf dem holy ground zu Füßen Lincolns und in Hörweite des Weißen Hauses, ist an sich ein Symbol. Offensichtlich gelingt es der Tea-Party, an etwas anzuknüpfen, was Amerika in seinem Innersten bewegt.
Es ist heiß an diesem Sonntag, drückend heiß wie so oft im August, und unser Ausflugsziel, die wildromantische Canyonlandschaft Potomac Falls kurz vor der Hauptstadt, hinterlässt uns beeindruckt, aber nicht erfrischt. »Wir könnten zu Hooters gehen«, schlägt jemand vor und erntet kichernde Zustimmung. Ein Hauch von Verworfenheit umgibt die Restaurantkette Hooters, die wohl nur dort reüssieren kann, wo sich Restvorstellungen einer allgemein verbindlichen Moral erhalten.
Die hooters, umgangssprachlich für Brüste, werden von den ausschließlich weiblichen Bedienungen zwar nicht gezeigt, aber doch hervorgehoben, die kurzen Röckchen erinnern an Eislauftänzerinnen. Ob derlei Zurschaustellungen reizvoll sind, ist Geschmacksache, aber Jenny, unser server, gibt ihr Bestes. Sie strahlt und posiert und ruft auch noch ihre Kolleginnen herbei für Gruppenfotos, die auf die Toleranz der Daheimgebliebenen bauen. Die Kost ist deftig und reichlich – wir essen Zwiebelringe – und dass das Bier nicht im Glas, sondern im pitcher serviert wird, im 2 ½-Liter-Krug, sorgt für den nötigen Hauch von Exzess. Zum Schluss holt die strahlende Jenny noch den Hula-Hoop-Reifen hervor und tanzt für uns. Dass für uns ältere Semester – darunter zwei Frauen – ein solcher Aufwand getrieben wird, mag von genuiner Freundlichkeit herrühren – oder von der Aussicht aufs Trinkgeld.
Ich blicke aus dem Fenster und sehe einen »Hummer« vorfahren, eine üppig mit Chrom verzierte Mischung aus Panzer und Geländewagen. Dem Ungetüm an Auto entsteigt ein Ungetüm an Mann: 2 ½ Zentner schwer, geschoren, mit weißem T-Shirt, Shorts und Sonnenbrille. Ich kann nur beten, dass er nicht bemerkt, wie ich ihn fotografiere – oder dass er es als Kompliment auffasst. Friedlich betritt er das Lokal und bestellt sein Essen. Vielleicht weiß er es ja gar nicht oder in seinem mächtigen Brustkorb pocht ein verwundetes Herz: Vor kurzem hat General Motors seine Marke »Hummer« an den Chinesen Tengshong verkauft als Teil des Versuchs, sich aus der Insolvenz zu befreien. Dass die Regierung im Land der Marktwirtschaft den einstigen Weltmarktführer GM dann doch rettete, verstehe ich in diesem Moment etwas besser als sonst: aus Angst vor Ärger.
Natürlich gibt es Ärger im Land, massiven Ärger, aber muss man deshalb derart reißerische Titel machen? »The Next American Civil War«8 heißt ein neues Buch von Lee Harris und aus Ärger über derlei verbale Übertreibungen hätte ich es fast im Regal gelassen. Als ich es dann doch aufschlage, stoße ich auf ein gut argumentiertes, mit reichen Quellen unterlegtes Plädoyer für die Idee, die populistische Aufmüpfigkeit unserer Tage erst einmal ernst zu nehmen. Vielleicht hilft es dem Autor ja, dass er in Stone Mountain, Georgia, lebt und Nachbarn und Bekannte hat, hilfsbereite, herzensgute Menschen, die Obama für einen Muslim oder Sozialisten halten. Was sie antreibt, schreibt Harris, ist der Wunsch, ihr Leben so zu leben, wie sie es für gut und richtig halten. Don’t tread on me, don’t boss me around sei die Grundhaltung und nicht Intoleranz. Die Krise habe die seit Jahren wachsende Kluft nur vertieft zwischen einer arroganten, übergriffigen Elite und einfachen, traditionsgebundenen Schichten, die sich nichts sagen und nichts vorschreiben lassen.
Allerdings sind diese natural libertarians auch ihre eigenen schlimmsten Feinde. Oft erliegen sie »paranoiden Ängsten«, glauben an »finstere Verschwörungen«, fallen auf »populistische Demagogen und Scharlatane« herein, die sie dann ausnutzen. Auf die richtige Einsicht, dass »Macht Arroganz gebiert«, folgt, bei seinen Nachbarn, oft eine allzu simple Weltsicht.
Harris beschreibt ein weltgeschichtliches Kuriosum: In Gesell-schaften, die sich ihre Freiheit erkämpft und alte Traditionen durch eigene ersetzt haben, kann eine »Tradition der Rebellion« entstehen, eine tiefe, vorbewusste Entschlossenheit, sich nichts mehr gefallen zu lassen und den Rückfall in Abhängigkeit zu verhindern. Wird dies befürchtet, können zerstörerische Emotionen losbrechen mit allen unschönen Begleiterscheinungen aufgebrachter Mobs. Oft trifft es dann die Falschen auf der Suche nach den »Schuldigen«.
Dass auch »welthistorische Veränderungen« »schuld« sein könnten an aktuellen Problemen wird dann meist zuletzt vermutet und doch ist auch Amerika nicht immun gegen diese Trends. Seine »Ausnahmestellung«, sein viel zitierter exceptionalism, ist schon länger in Gefahr, von der Normalität hochkomplexer Gesellschaften eingeholt zu werden: »Funktionseliten« regieren das Land. Allerdings, so Harris, stehen Teile dieser Elite als liberal elites in der Tradition der europäischen Aufklärung und wollen die Welt und den Menschen nach abstrakten Grundsätzen verbessern. Dabei geraten sie in Konflikt mit den Anhängern anderer Traditionen und die haben Freiheit im Herzen – und Gewehre im Schrank.
Vielleicht muss es ja nicht zum Äußersten kommen, wenn man, wie Harris vorschlägt, das menschliche Biotop in seiner ganzen Diversität anerkennt und keine Homogenität verlangt. Civil Ecology nennt er das und räumt dabei auch dem radikalen Freiheitsdenken seinen Nutzen ein, wenn es nicht auf die Ideologie beschränkt wird. Diese sei, wie jedes Dogma, voller Widersprüche. Auch der libertarian hofft auf »Elite«, wenn er in den Operationssaal gefahren wird, und eine Weltmacht ist undenkbar ohne beträchtliche Macht des Staates. Als Haltung aber, als innerer Antrieb, sei die passion for liberty durchaus segensreich und könne als Humus und Rückgrat wirken in einer Gesellschaft, die frei und beweglich bleiben wolle.
Ich bin wieder viel zu lange bei Barnes & Noble gesessen und jetzt, in einem abgelegenen Winkel von Manassas, Virginia, überkommt mich der Hunger. Ein Kentucky-Fried-Chicken-Schild lockt mich in ein Einkaufszentrum, das wegen der späten Stunde schon halb im Dunkeln liegt. Wie so oft habe ich Mühe, den Mexikanerinnen hinter der Theke zu erklären, dass ich ein Bruststück und einen Schenkel in der altbewährten (traditional) Panierung möchte, dazu Krautsalat und Kartoffelbrei. Ich verzehre gerade das zweite Hähnchenteil, als mir meine Lage bewusst wird. Ich bin allein im Lokal mit einer Gruppe schwarzer Jugendlicher, und die proben gerade den Aufstand. Lautes Gejohle und Schaukämpfe füllen den Raum, darunter Versuche, aus dem Stand auf Bänke und Tische zu springen. Immer häufiger blicken sie zu mir herüber. Jeder einzelne von ihnen macht den Eindruck, als habe er in seinem kurzen Leben schon mehr Sport betrieben als ich in dem meinigen. Die ausschließlich weiblichen Angestellten bleiben hinter der Theke und schweigen. Ein Gefühl ganz dicht am eben verzehrten coleslaw mit mashed potatoes rät mir dringend, das Weite zu suchen. Da fällt mir Lee Harris ein und die von ihm beschriebene amerikanische Tradition, dem bully, dem angeberischen Schlägertypen, nicht nachzugeben, sondern standzuhalten. Also hole ich ein soeben erstandenes Buch hervor, Richard Hofstadters »The American Political Tradition«, richte es vor mir auf und beginne zu lesen. Vielleicht will mir ja der Eindruck schmeicheln, aber ich habe das Gefühl, dass der Tumult ein wenig nachlässt. Schließlich entspannt sich die Lage, als andere Gäste hereinkommen. War da vielleicht magisches Denken im Spiel? Habe ich ein Buchcover mit Motiven des Sternenbanners zur Hypnose benutzt? Oder habe ich unbewusst ein Ritual nachvollzogen, das ich erst später begreifen werde: den Rückgriff auf Tradition in Zeiten der Krise?
Manchmal bedarf es des Abstands vom Geschehen, um klarer zu sehen. Nach Hause zurückgekehrt habe ich eine politische Runde bei mir zu Gast, der ich meine Eindrücke schildere. Vielleicht erscheine ich ein wenig besorgt, so als hätten sich mir in diesem dritten amerikanischen Krisensommer die Summe aus publiziertem Hass, gezielten Lügen und der allgemeinen rowdiness des politischen Diskurses zu einem unschönen Gesamtbild verdichtet. Mir gegenüber sitzt ein erfolgreicher amerikanischer Anwalt schwarzer Hautfarbe und lächelt fein. Er sei da nicht so pessimistisch, sagt Keith und erzählt von seiner Schulzeit in den Sechzigern. Monatelang sei im südlichen Virginia der Unterricht ausgefallen, weil sich die örtlichen Behörden geweigert hätten, die staatlich verordnete Rassenintegration zu vollziehen. Da werde man doch mit Glenn Beck und Sarah Palin fertig werden! Don’t bet against America!
Auch in anderen westlichen Ländern herrscht dicke Luft in diesem Herbst. Ich bin gerade in Frankreich, als die moderate Anhebung des Rentenalters eine Protestwelle auslöst, die im Ausland mit Kopfschütteln und Spott quittiert wird – Liberté, Égalité, Frührenté. Und in Deutschland hat das Ringen um ein ehrgeiziges Bahnhofsprojekt ebenfalls sachfremde, vom latenten Groll gespeiste Untertöne. Einmal unterstellt, die Ursachen des Ärgers seien vergleichbar – der Unmut über Banken- und Regierungsversagen, die latente Fremdbestimmung in der globalisierten Welt – so erstaunt doch die unterschiedliche Reaktion in den einzelnen Ländern. Woran liegt das?
Nationen erleben ihre Krisen durch das Prisma der eigenen Erfahrung und greifen bei der Suche nach Erklärungen und Lösungen fast instinktiv auf ihre Gründungsmythen zurück. Dabei handelt es sich um alte, tief in der »kulturellen DNA« eines Volkes verwurzelte Erzählungen, wie es entstand, was ihm ursprünglich Kraft zum Wachstum gab, was gut und richtig war in jener großen Zeit des Aufbruchs. Im Spiegel dieses Mythos wird deutlich, was heute im Argen liegt und was jetzt zu tun sei: Das Gute von einst wieder herzustellen (to restore), zurückzukehren zu den Ursprüngen (ritornare ai principi), wie Machiavelli dieses Prinzip nationaler Gesundung einst genannt hat9.
Dabei ist die historische Genauigkeit der Erzählung weniger wichtig als ihre Bild- und Bindungskraft und was das betrifft, ist der amerikanische Mythos ganz besonders stark. Er handelt von Freiheit: von Befreiung zunächst, von der Überwindung des Alten, vom Aufstand gegen eine als tyrannisch erlebte Zentralmacht; von gelebter Freiheit sodann, von Bewährung unter widrigen Umständen, von der Stärke jener, die sich auf Gott und sich selbst verließen und dabei ihr Glück fanden. Der Erfolg amerikanischer Politik bemisst sich an dem Ausmaß, in dem sie an diese Grunderfahrung anzuknüpfen weiß.
Anfangs entsprach Obamas Politik diesem Anspruch, verband sich mit dem Wunsch nach Wandel, nahm den Zorn auf über die Unfähigkeit »Washingtons« und die Privilegien der Wenigen. Auf den Wahlsieg, auf die »Befreiung«, folgte dann aber politics as usual, auf die brillante »Erzählung« im Wahlkampf eine kaum lesbare Botschaft im Alltag. Wohin wollte Obama das Land eigentlich führen? Für viele Amerikaner, die ihre Gegenwart unter dem Signum der »Verirrung«, des Abweichens vom rechten Weg erleben, war sein Versprechen des »Ausgleichens« und »Zuhörens« schlicht nicht gut genug. Schlimmer noch: seine Politik ließ sich als Verlust von Freiheit interpretieren, als Stützung gescheiterter Großstrukturen und Gängelung durch eine bürokratisch missratene Gesundheitsreform. Dass die Krise ihre schlimmen Folgen am Arbeits- und Häusermarkt erst mit Verzögerung entfaltete, tat ein Übriges.
Und so wartet die Nation denn, zwei Jahre nach der Wahl, auf einen neuen Hoffnungsträger, einen wie Ronald Reagan vielleicht, der einst »Wandel« und »Rückkehr« gemeinsam versprechen konnte.
Dezember 2010
1 Jonathan Alter, The Promise. President Obama, Year One, New York 2010
2 Hier sind vor allem die Heritage Foundation, das American Enterprise Institute (AEI) und das Cato Institute zu nennen.
3 Ein »Ausschuss«, der nach einer Falschmeldung der Republikaner angeblich darüber entscheidet, wer unter »Obamacare« noch Gesundheitsleistungen erhält und wer nicht.
4 Timothy Egan, Building a Nation of Know-Nothings, The New York Times, August 25th, 2010
5 Robert Ringer, Restoring the American Dream. The Defining Voice in the Movement for Liberty, New York 2010
6 Ringer, loc. cit., S. 17
7 Glenn Beck, Glenn Beck’s Common Sense. The Case Against Out-Of-Control Government, Inspired by Thomas Paine, New York 2009
8 Lee Harris, The Next American Civil War. The Populist Revolt Against the Liberal Elite, New York 2010
9 Niccolò Machiavelli, Discorsi III,1