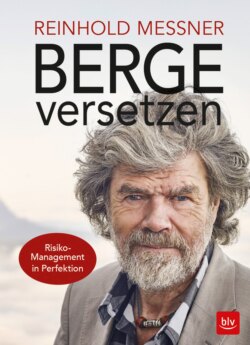Читать книгу Berge versetzen - Reinhold Messner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Für mich war es immer ein Traum, einen Schritt weiter zu gehen. Dieser Traum hält wach.«
Immer einen Schritt voraus
Wenn es etwas Unnützes gibt, ist es mein Tun. Also sind meine Leistungen schwer zu rechtfertigen. Einen moralischen Anspruch erhebe ich nicht. Ob Abenteuer »gesund« sind, wissen die Götter. Ich weiß es nicht. Mir geht es um Leistung als Anspruch an sich, um ein Tun, das außerhalb von ethischen Maßstäben abläuft. Ich rechne mich nicht zu den »vernünftigen« Menschen, und meine Reflexionen über das Abenteuer und die Alpinistik sind so notwendig wie mein Tun. Beides ist nur möglich – für mich manchmal zwingend.
Ich tue, was andere als Unsinn abtun. Ich laufe und klettere aber nicht gegen Vorurteile an. Darin läge wenig Reiz. Ich habe die höchsten Berge der Erde auch nicht bestiegen, um auf Umweltprobleme hinzuweisen. Mit meinem Marsch über den Südpol wollte ich nicht in erster Linie für einen »Weltpark Antarktis« demonstrieren. Mir ging und geht es bei der »Eroberung des Nutzlosen« um das Spiel, das ich als »Grenzgang« in den Sprachgebrauch einführen möchte: sich selbst bewusst an den Rand seiner Möglichkeiten und Existenz führen und dabei immer wieder einen Schritt weiter gehen, ohne dabei umzukommen.
Dieses Spiel habe ich 30 Jahre lang gespielt – in der Vertikalen und in der Horizontalen, in der Höhe und in der Weite. Die Ziele wurden immer anspruchsvoller. Nun hat die Erde nach oben tatsächlich ein Ende; sie gipfelt im höchsten Berg der Welt. In der Weite ist ein Ende nie in Sicht. Ginge ich um die Erde herum, käme ich nirgendwo an und immer zurück, um weitergehen zu können.
Für mich begann die Zukunft in meiner Kindheit. In Südtirol. Im Villnösstal. Aufgewachsen in einem engen, tiefen Gebirgstal, unter den Geislerspitzen in den Dolomiten, konnte ich immer nur einen schmalen Ausschnitt des Himmels sehen. Die Wolken kamen aus dem Nichts, und ins Nichts verschwanden sie. Als Kind schon habe ich mich gefragt, wo diese Wolken herkommen und wo sie hingehen. Mit fünf Jahren stieg ich zum ersten Mal auf einen Dreitausender. Dort oben wurde mir klar, dass die Welt größer ist als das, was ich von daheim aus hatte sehen können. Die Wolken verschwanden hinter einem weiteren Horizont. Mit 15 war ich ein besessener Felskletterer, bald auch Eisgeher. Mit 25 war ich in der Lage, die damals schwierigsten Eis- und Felswände der Alpen allein und ohne Seil zu klettern. Mit dem freiwilligen Verzicht auf den Bohrhaken gab ich dem alpinen Bergsteigen Ungewissheit und Steigerungsfähigkeit zurück. Eine neue Welle des Freikletterns entstand.
Meine Begeisterung wuchs mit einer Expedition in die Anden Südamerikas. Also wollte ich noch einen Schritt weiter gehen, höher hinauf. 1970 wurde ich zu einer Nanga-Parbat-Expedition eingeladen. Mir ging es dabei nicht in erster Linie um den Berg, den Gipfel, einen der 14 Achttausender. Mir ging es um die Rupalwand. Diese Südwand am Nanga Parbat, fast 5000 Meter hoch, beginnt dort, wo die Eiger-Nordwand aufhört, und sie gipfelt in der Todeszone, in einem Bereich, wo der Sauerstoffpartialdruck der Luft so gering ist, dass der Mensch kaum noch Leistung erbringen kann. Reichten meine Instinkte, meine Fähigkeiten aus, um dort oben zu überleben? Über die großen Höhen wusste ich damals wenig. Die Höhenkrankheit kannte ich nur aus der Literatur. Noch weniger wusste ich über die Weigerung des Körpers, bei Sauerstoffmangel weiterzumachen, über das Nachlassen von Konzentration und Willen in großer Höhe.
Die Rupalwand am Nanga Parbat war früher schon versucht worden. Vergeblich. Sie galt in Fachkreisen als das »Problem« im Himalaja. Vielen erschien sie undurchsteigbar. Unsere Expedition hatte nach 40 Tagen »Arbeit« Erfolg. Aber um welchen Preis! Mein Bruder Günther starb, ich erlitt schwere Erfrierungen.
Nach der Amputation von Zehen und Fingerkuppen war ich Invalide. Ich musste erst wieder gehen lernen. Mit viel Ausdauer und autogenem Training holte ich mir meine alte Kondition zurück. Mit derselben Eindeutigkeit, mit der ich früher geklettert war, verfolgte ich mein neues Ziel: Grenzgänge in großer Höhe, wo Kletterkönnen weniger zählt als Ausdauer, Instinkt, Kreativität. Ich wollte wieder Realutopien realisieren.
Visionen, als Projektionen in die Zukunft, habe oft auch beim Bergsteigen ihre Lichtquelle in der Vergangenheit. Dazu gehört neben Geschichtskenntnissen das Erinnern an all jene, die bei ihren Abenteuern umgekommen sind. Bergsteigen war und ist gefährlich. Nur ein Narr steigt auf die höchsten Gipfel der Erde und glaubt, er könne dabei nicht umkommen. Natur ist Chaos und Ordnung zugleich. Niemand ist so erfahren, so gut, so ausdauernd, dass ihm nichts passieren kann. Keiner ist perfekt. Bei meiner Art des Bergsteigens zählen das Erfahren, das Grenzenverschieben, das Überleben. Nicht immer ist all das organisierbar. Nur im Respekt vor den großen Bergen, im Wissen, dass der nächste Schritt der letzte sein kann, ist eine Annäherung an die jeweiligen Grenzen verantwortbar. Ich muss den letzten Schritt verinnerlicht haben, bevor ich den nächsten wage.
Die Einheimischen in Tibet, die tief religiös sind, leben vielfach als Halbnomaden in einem menschenfeindlichen Hochland. Auf Berge steigen sie aus eigenem Antrieb nicht. Sie wissen, dass es dort oben weder Gold noch Getreide zu holen gibt. Sie gehen auf Almen, überqueren Pässe, die 5000 oder 6000 Meter hoch sind. Auf jedem Pass rufen sie »Lhagyelo«, was so viel heißt wie: »Die Götter haben gesiegt« und/oder: »Die Götter sind gnädig.« Wenn ich – wie auch in die la-maistische Lebenshaltung hineininterpretierbar – die Götter mit den Naturkräften gleichsetze, habe ich die Einstellung der Einheimischen den Bergen gegenüber verinnerlicht. Unser Verständnis von Natur ist identisch. Wir ordnen uns ihr unter. Nur wenn die Götter (als Naturkräfte) gnädig sind, können wir Menschen den Tanz mit ihnen überleben. Die Naturkräfte, die auch in uns sind, sind stärker als wir. Wir sind nur Teil. Die Welt, die Erde wird sich immer wieder selbst reinigen und heilen können. Wir nicht. Wir sind in diesem Zusammenhang begrenzt. Die Natur braucht die Menschen nicht, aber wir brauchen die Natur. Nur in diesem Zusammenspiel kann Ökologie verstanden werden. Es muss uns Menschen bewusst werden, dass die Fehler im Zusammenspiel Mensch – Natur von Menschen ausgehen, denn die Erde ist da und macht keine Fehler.
Fünf Jahre nach der Tragödie am Nanga Parbat, meinem ersten Achttausender, wagte ich am Hidden Peak (Gasherbrum I, 8068 m) in Pakistan jenen Schritt, der das Höhenbergsteigen revolutionieren sollte.
Worin bestand nun nach der Schwierigkeitssteigerung meine zweite Revolution beim Bergsteigen, mein Schritt weiter, jene »Spur in die Zukunft«, die ich bei der Besteigung des Hidden Peak gelegt habe? Sein Gipfel war vor 1975 ein einziges Mal erreicht worden (1958). Ich wollte ihn nicht nur ein zweites Mal und über eine neue, schwierige Route, die Nordwand, besteigen. Mir ging es um den Stil. Meine Logistik dazu – zwei Mann, ein Basislager und keine weitere Fremdhilfe – galt damals an den Achttausendern im Himalaja und Karakorum als untauglich. Dabei war sie in den Alpen seit 100 Jahren eingeführt: als das selbstständige Bergsteigen. Ich wollte nicht mit Hunderten von Trägern bis ins Basislager kommen, nicht Tonnen von Material verschieben und Dutzende Hochträger befehligen, um einen Gipfel zu »erobern«, wie es bis dahin die Regel gewesen war. Ich wollte zu zweit Erfahrungen sammeln. Ausschließlich in Eigenregie auf einen Achttausender zu steigen bedeutete mehr Einsatz, mehr Ausgesetztsein, mehr Risiko. Möglicherweise das Scheitern.
Mit 200 Kilo Gepäck – einem Zehntel von dem, was die kleinste Achttausender-Expedition bis dahin eingesetzt hatte (Broad Peak, 1957) – erreichten Peter Habeler und ich den Fuß des Berges. Wir blieben zwei Wochen lang dort. Aus dem Gasherbrum-Tal beobachteten wir »unsere Wand« mit dem Fernglas, um die bestmögliche Aufstiegslinie zu finden. Durch diesen Aufenthalt akklimatisiert, an die sauerstoffarme Luft gewöhnt, konnten wir einen Besteigungsversuch wagen.
Meinem Partner, dem Zillertaler Bergführer Peter Habeler – ein schneller und vor allem ausdauernder Kletterer, den ich erst kurz vor dem Start in meine Pläne eingeweiht hatte –, konnte ich am Berg vertrauen. Ich hatte ihn eingeladen, weil er einer der intuitivsten Bergsteiger in Europa war. Ich sah in ihm in jeder Hinsicht den gleichwertigen Partner. Rechte und Pflichten waren dementsprechend zwischen uns aufgeteilt.
Jeder nahm seinen Rucksack. Wir hatten Ausrüstung, Brennstoff und Proviant für gut eine Woche dabei, ein kleines Zelt. Das Seil ließen wir in 6000 Meter Höhe zurück. Es wäre eine zu große Belastung gewesen, vom Gewicht her und von der Zeit, die sauberes Sichern kostet. Über steilen Fels, immer ungesichert, jeder für sich kletternd, stiegen wir nach oben. Mit jedem Schritt kamen wir weiter weg von der Zivilisation, den Sicherheiten, den anderen Menschen. Keiner gab Befehle. Stillschweigend, in Symbiose erlebten wir den letzten Anstieg. Nach drei Tagen standen wir bei herrlichstem Wetter am Gipfel. Aus der Welt herausgehoben, sahen wir uns um. Nur unser gutes Zusammenspiel hatte uns so weit gebracht. Jeder spürte die Nähe des anderen, ohne mit ihm reden zu müssen.
Zwei Tage später waren wir im Basislager. Mit dem Schlüssel, das Höhenbergsteigen umkrempeln zu können. Dieser neue Stil war elegant, schnell, fair. Die Tour aufregender als jede Großexpedition. Und die Kosten waren um ein Vielfaches geringer als bei einer Expedition in herkömmlicher Art. Dieses Bergsteigen wurde der Auseinandersetzung Mensch – Berg eher gerecht als die Materialschlachten zur Zeit des Eroberungsalpinismus. Heute, da es beim Bergsteigen nicht mehr um die Eroberung der Gebirge geht, nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse oder um die Fahne am Gipfel, sondern allein um die Auseinandersetzung mit einer menschenabweisenden Natur, ist der Alpinstil aktueller denn je.
Meine Kritiker, von denen es seit damals zum Glück genügend gab, hatten sofort einzuwenden, mein Stil funktioniere nur an den »kleinen Achttausendern«, von denen es neun gibt. Die fünf größten Berge aber, die sogenannten »großen Achttausender«, die achteinhalbtausend und mehr Meter hoch sind – der Mount Everest vor allem –, wären ausschließlich mit Sauerstoffgeräten besteigbar, im alpinen Stil also unmöglich zu erreichen.
Wenn ich Sauerstoffgeräte, Masken und schwere Stahlflaschen – wie damals üblich mit 2 Kilo komprimiertem, reinem Sauerstoff gefüllt – auf diese Berge hinaufschaffen muss, um auf den Gipfel zu kommen, brauche ich Trägerkolonnen als Helfer. Trägerkolonnen brauchen Fixseile und Hochlager. Damit waren wir wieder bei der althergebrachten »klassischen Expedition«. Um bis zum Everest-Gipfel zu gelangen, benötigte ein Mann damals in der Regel sechs bis sieben Flaschen Sauerstoff. Bei einem Flaschengewicht von 6 Kilo waren das 40 Kilo Sauerstoffausrüstung. Ein Alleingänger hätte mit diesem Gewicht, ergänzt durch Zelt, Proviant, Schlafsack, keine Chance gehabt, den Gipfel zu erreichen.
Im Alpinstil war der Mount Everest folglich nur ohne Sauerstoffgerät zu schaffen. Der »Everest ohne Maske« war ein letztes Tabu.
Auf den höchsten Bergen der Erde kann es auf Dauer kein menschliches Leben geben. Darin bestand das Problem. Der scheinbare Widerspruch zwischen der Tatsache, dass diese großen Berge absolut menschenabweisend sind – niemand kann dort oben längere Zeit ohne Technologie überleben –, und meiner Idee, es trotzdem ohne Technologie zu versuchen, förderte meine Motivation, meinen Leistungswillen.
Mein Plan, den Mount Everest zuerst ohne Sauerstoffgerät, dann im Alpinstil, im Idealfall zuletzt im Alleingang zu besteigen, wuchs in Schüben. 1978 brachich, wieder zusammen mit Peter Habeler, im Rahmen einer österreichischen Expedition auf, um den Everest-Gipfel erstmals ohne Maske zu erreichen. Die übrigen Teilnehmer des von Wolfgang Nairz geleiteten Teams wollten mit Sauerstoffgeräten klettern. Beim ersten Vorstoß zum Gipfel scheiterte ich am Südsattel. Ein Sturm trieb mich zurück. Peter hatte vorher schon aufgegeben, weil er keinerlei Chancen sah, ohne Maske auf den Gipfel zu kommen.
Zwei Wochen später, am 8. Mai, nach langer Rast im Basislager und Wiederaufstieg, versuchten wir es erneut. Meter für Meter stiegen wir aufwärts. Anfangs recht zügig, im Schlussteil unendlich langsam. Für die letzten 50 Höhenmeter brauchten wir eine ganze Stunde. Mit dem Langsamerwerden wuchs der Berg, der Wille schwand. Die Leistungsbereitschaft wurde mit jedem Meter Höhe kleiner. Sie nahm ab wie die Motivation, die Ausdauer, die Kraft, die Hoffnung.
Der Sauerstoffmangel in großer Meereshöhe kehrt das Leistungsprinzip um. Je länger einer braucht, umso hilfloser wird er in seinen Aktivitäten. Im Blut zirkuliert zwar genügend Zucker, im Kopf aber ist keine Energie. Es fehlt an Sauerstoff, ohne den nichts verbrannt werden kann. Es ist, als ob der Mensch unter einer Luftglocke leben würde, ihm alle Lebensenergie genommen wäre.
Unsere Vorstellung – die jahrelange Auseinandersetzung mit diesen Problemen im Geiste – war zu guter Letzt der Schlüssel zum Erfolg. Schnelligkeit und Leidensfähigkeit waren die Voraussetzungen für das Durchhaltenkönnen. Die im Vorfeld der Besteigung angestaute Motivation, eine Art Überwille, war es, die trotz der Weigerung des Kopfes, gegen die Müdigkeit im Körper anzukämpfen, ein Höhersteigen möglich machte. Der Hoffnungslosigkeit angesichts des vor uns scheinbar unendlich hoch aufragenden Gipfelgrats in 8800 Meter Höhe setzten wir Sturheit entgegen. Hinaufzukommen! Wir kamen hinauf.
Ich hatte daran geglaubt. Bis zuletzt. Wie selbstverständlich saßen wir auf dem Gipfel. Wir hatten uns in eine Realutopie hineingesteigert, und plötzlich war sie gelungen, Realität. Glaube kann Berge versetzen.
Beim Absteigen wusste ich, dass eines der letzten Tabus im Bergsteigen gefallen war. Es interessierte mich nicht. Jetzt war die Voraussetzung gegeben, noch einen Schritt weiter zu gehen: Alle Berge der Erde waren ohne Sauerstoffmaske besteigbar; es war bewiesen, dass der Mount Everest auch im Alleingang möglich war.
Trotzdem, sofort hätte ich nicht den Mut gehabt, allein zum Mount Everest aufzubrechen. Die Ängste hätten mich aufgefressen. Auch fiel ich nach dem Erfolg in ein schwarzes Loch der Enttäuschung. Die Vision, die mich vorher ausgefüllt hatte, war Realität geworden. Als Utopie war sie tot. Mit ihr die Begeisterung, Konzentration, Motivation, die der unerreichte Gipfel gebunden hatte.
Ich brauchte eine neue Idee, die zur Realutopie werden konnte. Und ich wusste: Das Vorankommen an der Grenze der Leistungsfähigkeit ist nur für den möglich, der den Weg der kleinen Schritte wählt. Schrittchen für Schrittchen sind Grenzen verschiebbar. Wenn ich weiß, dass A und B möglich sind, kann ich C möglich machen. Meine neue Realutopie hieß jetzt Mount-Everest-Alleingang.
Vor 1978 hatte nie jemand einen Achttausender von der Basis bis zum Gipfel im Alleingang bestiegen. Wenige Wochen nach dem Everest-Aufstieg versuchte ich einen der kleineren Achttausender im Alleingang und natürlich ohne Maske. In drei Tagen stieg ich mit einem Rucksack von etwa 15 Kilo Gewicht über eine neue Route zum Gipfel des Nanga Parbat und über einen anderen Weg ab. Trotz unerwarteter Schwierigkeiten – ein Erdbeben beim Aufstieg zerstörte die Kletterroute hinter mir, Schneesturm hielt mich beim Abstieg in 7400 Meter Höhe fest – kam ich ohne größere Schäden vom Berg herunter.
Nun erst war ich zum letzten Schritt bereit: allein bis ans Ende der Welt! Die beiden Erfahrungen zusammengenommen – Mount Everest ohne Sauerstoffmaske und Nanga Parbat im Alleingang – gaben mir die psychische Kraft, Selbstsicherheit und genügend Erfahrung, den höchsten Berg der Welt im Alleingang zu versuchen. 1980 erhielt ich von der chinesischen Regierung die Erlaubnis, den Everest ein zweites Mal zu besteigen. Diesmal von Norden, von Tibet her. Bis auf eine Höhe von 7000 Metern gab es keine Probleme. Dann zu viel Schnee. Ich wartete eine Unterbrechung des Monsuns ab und versuchte es wieder.
Problematisch wurde es erstmals an einer Spalte knapp unter dem Nordsattel. Vorsichtig wollte ich über diese Randspalte setzen, die nur andeutungsweise zu erkennen war. Ich hatte die bergseitige Spaltenwand, eine steil aufragende Schneeflanke, mit dem Pickel noch nicht erreicht, als mein talseitiger Fuß nachgab. Ohne mich halten zu können, fiel ich 8 Meter tief in ein Loch, in eine ASpalte. Unverletzt blieb ich auf einer Schneebrücke liegen. Zum Glück. Zitternd sah ich nach oben. Es schien keinen Ausweg zu geben. Da war nur ein baumstammdickes Loch, über dem die Sterne funkelten. Ich war gefangen. Lebendig begraben im Eis. Die Spalte ging nach unten hin weiter auseinander, der Abgrund unter mir war unergründlich. Im Spreizschritt hätte ich aus meiner Position nicht hochsteigen können. Was tun?
Mit viel Glück fand ich – nachdem ich mir geschworen hatte, aufzugeben und nach Hause zu reisen, wenn ich lebend aus der Spalte herauskäme – ein Höhlensystem, eine Art Rampe im Berginnern, über die ich nach außen klettern konnte. Als ich wieder im Freien war, stieg ich aufwärts. Ich hatte meinen Vorsatz, aufzugeben, vergessen oder verdrängt. Wie in Trance, als wäre ich auf den Gipfel programmiert, ging ich zum Loch zurück, durch das ich gefallen war, setzte vorsichtig darüber. Zügig stieg ich weiter zum Nordsattel und dann den Nordgrat hinauf. 1400 Höhenmeter schaffte ich an diesem Tag. Ich hatte den Aufstieg, bevor ich ihn ausführte, so verinnerlicht, dass ich jetzt den ganzen Weg gehen musste. Zwei Jahre lang hatte ich die Idee als Tagtraum mit mir herumgetragen, sodass ich nun nicht anders konnte, als weiterzumachen. Die eindeutige Identifikation mit meinem Ziel, meiner Idee führte nach oben.
Die Schneeverhältnisse am Nordgrat des Mount Everest wurden schwieriger. Am zweiten Klettertag konnte ich nur 400 Höhenmeter schaffen. Auch weil ich die Nordflanke querte. Viel zu langsam ging es voran. Zweifel kamen auf. Zudem verschlechterte sich das Wetter. Trotzdem erreichte ich am dritten Tag über Steilstufen und Rinnen, zuerst nach rechts hin, dann über Schneefelder nach links, den höchsten Punkt. Mit letzter Kraft. Es war spät, und ich war so kaputt, dass ich mich weder umschaute, noch viel fotografierte oder nachdachte. Ich saß nur da und rastete. Ich hatte alles vergessen, vergaß sogar, wo ich war.
Nach einer Stunde hatte ich genügend Kraft, um wenigstens aufzustehen für den Abstieg. Zwei Tage später war ich im Basislager zurück. Erst unten packten mich starke Emotionen. Es war nicht die Freude, den Mount Everest im Allein-gang bestiegen zu haben. Es war das Erlebnis, ins Leben zurückzufinden – zu den anderen Menschen, zu den ersten Pflanzen, zu den Insekten, zum fließenden Wasser. All dieses Lebendige hatte ich oben nicht vermisst. Die schier grenzenlose Lebensfeindlichkeit, in der ich mich fünf Tage gegen Wahnsinn und Verzweiflung gewehrt hatte, wurde mir erst jetzt richtig bewusst.
Ich war fünf Tage lang mit mir allein gewesen, in einer völlig toten, kalten Umwelt. Es war immer anstrengend, immer bedrohlich, oft zum Verzweifeln. Ich schlief dort oben wie ein Vogel: ständig wach und bereit, aufzubrechen, immer auf der Hut. Trotzdem war es das Zurückkommen in die belebte Welt, das mich erschütterte. Obwohl ich müde war wie nie zuvor in meinem Leben. Ein Mehr an Anstrengung, an Lebensfeindlichkeit und Alleinsein hätte ich nicht ertragen können.
Wenige Jahre später, 1986, stand ich auf dem Gipfel des Lhotse, der dem Mount Everest im Süden vorgelagert ist. Es war mein vierzehnter Achttausender. Einige der 14 höchsten Berge auf dieser Erde hatte ich zweimal bestiegen. Vortragsanfragen und Werbeangebote häuften sich. Ich hätte praktisch ein Leben lang von diesen Erfolgen in den Bergen zehren können. Von meinen gestrigen Erfolgen aber konnte ich seelisch nicht leben. Geleistetes, Gelungenes ist es nicht, was mich ausfüllt. Das Gestern gehört zu meiner Biografie. Fehler genauso wie Erfolge. Ich verstehe mich aber als kreativen Menschen, der sich ausdrücken will, der weitergehen muss, der immer neue Ansprüche an sich stellt.
Also nahm ich – zuerst im Geiste, dann in der Praxis – ein Projekt in Angriff, das mich noch einmal ganz fordern sollte: die Antarktis-Durchquerung auf Skiern. Wohl wissend, dass die extremen Bedingungen bei dieser Reise nicht fünf Tage wie am Mount Everest, sondern 100 Tage dauern würden, bereitete ich mich drei Jahre lang vor. Für eine Gegend, die allerorts lebensabweisender ist als der Himalaja im Gipfelbereich und weiter weg von der Zivilisation als das Herz der Takla-Makan-Wüste in China: nie fließendes Wasser, nirgendwo Tiere, nirgendwo Menschen. Ich brauchte von alldem eine Vorstellung.
Die Antarktis war vor gut 200 Jahren entdeckt worden, in diesem Jahrhundert näher erforscht. 1986 reiste ich zum höchsten Berg der Antarktis, dem Mount Vinson. Klettertechnisch war der Aufstieg kein Problem, aber es war kalt: –50 °C. Dazu kamen Stürme. Mehr als alles andere beeindruckte mich der Blick vom Gipfel. Eine Weite, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Und diese Stille! Nach der Besteigung, am Fuße des Berges, fasste ich den Entschluss, den antarktischen Kontinent zu Fuß zu durchqueren. Ich packte im Basislager probeweise einen Schlitten. Zuerst mit 80, dann mit 120 Kilo Gewicht. Ich schleppte ihn, auf Skiern laufend, eine Stunde weit. Dabei schaffte ich knapp 4 Kilometer. Wenn ich nun diese 4 Laufkilometer mit 8 Marschstunden pro Tag hochrechnete, ergab das 30 Kilometer Tagesleistung. Und wenn ich die 30 Kilometer mit 100 Tagen multiplizierte, kamen – Rasttage abgerechnet – 2800 Kilometer heraus: die Länge, die einer Antarktis-Durchquerung entspricht.
Amundsen hatte den Südpol 1911 als Erster erreicht. Mit Hundeschlitten. Sir Vivian Fuchs führte in den Fünfzigerjahren eine Expedition mit Raupenfahrzeugen und Flugunterstützung quer durch die Antarktis. Ein gigantisches Unternehmen, das heute Hunderte Millionen Dollar kosten würde. Zu Fuß aber hatte noch nie ein Mensch die Antarktis durchquert. Mehr noch, an ein solches Unternehmen dachte in unserer technologischen Zeit kein »vernünftiger« Mensch. Im festen Glauben an die Möglichkeit moderner Technik gab es die ausgefallensten Expeditionsprojekte und Wissenschaftsstationen in der Antarktis. Meine Idee wurde also vom Kontrapunkt genährt. Mit menschlichen Kräften wollte ich nach einem menschlichen Maß der Antarktis suchen. Die Umweltfragen – in der Antarktis, die zu 98 Prozent von Eis bedeckt ist, liegen 70 Prozent des gesamten Süßwasservorkommens der Erde – wuchsen mir also zu.
Wieder daheim, stellten sich mir logistische Fragen: Wie sollte ich an den Ausgangspunkt meiner Schlittenreise und am Ende wieder nach Hause kommen? Auch brauchte ich einen Partner. Ich entwickelte eine Strategie und fand Arved Fuchs als Mitstreiter, einen norddeutschen Seemann, der Grönland mit Hundeschlitten durchquert hatte und die Navigation beherrschte. Er wollte zwar nicht mitfinanzieren, aber mitlaufen.
Nie zuvor in meinem Leben bin ich vor einem Start von so vielen Zweifeln geplagt worden wie vor der Antarktis-Durchquerung. Angstträume in jeder Nacht. Wir hätten ja dem gleichen Schicksal wie einst Captain Scott erliegen können. Immer wieder sah ich mich im Traum gefesselt, empfand mich als gelähmt. Ich hatte der Weite, der Unendlichkeit der Antarktis nichts entgegenzusetzen. Erst mit dem Aufbruch lösten sich die Zweifel auf. Jetzt wurde Wirklichkeit, was vorher Tagtraum gewesen war. Harte Wirklichkeit.
Drei Sommermonate blieben uns für die Durchquerung. Vorher und nachher war es zu kalt. Als Arved Fuchs und ich – völlig auf uns alleine gestellt – losgingen, kamen wir anfangs langsamer voran als geplant. Viel zu langsam. Arved navigierte, ich zog die Spur. Probleme zwischenmenschlicher Art gab es nicht. Nur Probleme mit der Geschwindigkeit. Arved wollte weniger, ich wollte mehr laufen. Wir einigten uns bald auf eine Tagesleistung von sechs Marschstunden. Ein Kompromiss, der uns täglich zurückwarf. Schon nach drei Wochen hinkten wir 200 Kilometer unserem Soll hinterher. Mit diesem Rhythmus war es aussichtslos, die gesamte Antarktis zu durchqueren. Wenn ich im Geiste vorausschaute, überfiel mich Hoffnungslosigkeit. Um unser Tempo zu steigern, beluden wir die Schlitten verschieden schwer. So kamen wir an die erforderlichen 30 Kilometer Tagesleistung heran. Jetzt erst kam bei mir die Hoffnung auf, die Südpolregion bis nach McMurdo zu durchqueren.
Nach knapp 50 Tagen erreichten wir den Südpol. Wir hatten noch nicht die Hälfte der Strecke geschafft, aber eine erste Zwischenstation erreicht. Mit der Taktik, zu der wir uns gemeinsam hatten durchringen können, wollten wir weitermachen.
Der Marsch vom Südpol nach McMurdo sollte schwieriger werden als der Anfang. Es gelang uns nur kurzzeitig, mit Hilfe von Segeln den Wind nutzend, schneller zu reisen. Bald blieb der Wind ganz aus. Wieder kamen wir in Bedrängnis. Immerzu waren wir mit unserer Marschleistung im Soll. Eisbrüche und der trockene Schnee bremsten unser Vorankommen. Die Schlitten wogen mehr als 100 Kilo.
Die kühnste Idee und die Identifikation mit dieser Idee nützen nichts, wenn die nötige Ausdauer fehlt. Arved war anfangs nur mit Tricks und gutem Zureden zu längeren Tagesmärschen zu bewegen gewesen. Am Ende nur noch mit meinem sturen Vorauslaufen, das ihn zu folgen zwang, weil das Zelt in meinem Schlitten lag.
Unser Zuhause, unsere Sicherheit, schleppten wir im Schlitten hinter uns her. Jeden Abend bauten wir das Zelt auf, jeden Morgen brachen wir es wieder ab. 6000 Spalten und 2800 Kilometer waren zu überwinden. Oft bei Temperaturen bis zu –40 °C, den Wind im Gesicht. Dazu immer die Frage: Kommen wir durch?
Als wir zurückkehrten in die Zivilisation, konnten wir nicht mehr mit ihr umgehen. Unsere Energie war verbraucht. Das Bier, das wir tranken, brachte unseren Wasserhaushalt durcheinander. Auch vermisste ich die Stille, jene grenzenlose Ruhe und Weite, in der ich drei Monate lang aufgehoben gewesen war – trotz aller Hoffnungslosigkeit manchmal.
Weitere Schritte sind geplant – Vormachen macht süchtig.