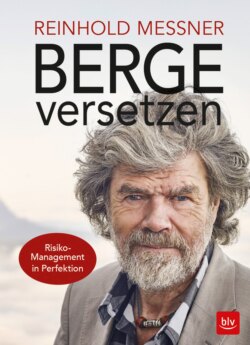Читать книгу Berge versetzen - Reinhold Messner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Fehler machen und korrigieren fördert die Innovationskraft.«
Stecken geblieben
15.1.1992 Reykjavik (Island)
10 Uhr, es ist noch Nacht. Wieder einmal – wie bei allen Expeditionen am Rande der zivilisierten Welt – hocken wir in einem teueren Hotel und hoffen auf den Flug am nächsten Tag, in der nächsten Stunde.
Alles ist gepackt. Wir sollten schon in Grönland sein. Aber die Wetterverhältnisse in Kulusuk erlauben den Flug nicht. Also warten wir. Einen Tag lang. Einen zweiten Tag. Dann kommen die Zweifel. Zuerst zum Warten, dann zum »Abenteuer«. Nur Fragen. Um 13 Uhr fliegen wir. Nebel auf der gesamten Strecke. Dann plötzlich das Eismeer unter uns. Mit unzähligen Schollen und Rissen.
Wir landen und fliegen eine Stunde später nach Ammassalik. Es ist Nacht, als wir ins Dorf kommen. Überall Kinder mit Rodeln auf den schmalen Wegen. Die Berge in ein fernes, bläuliches Licht getaucht. Wir gehen zur Polizei, kaufen ein, besorgen drei Tickets nach Isartok.
Die Leute nehmen kaum Notiz von uns. Es interessiert sie nicht, was wir hier machen.
16.1.1992 Ammassalik – Isartok
Nach einer unruhigen Nacht – jeder hat eine Doppelportion Steaks gegessen – stehen wir um 7 Uhr auf. Es ist Nacht. Frühstück, Packen, Fahrt zum Heliport. Von Nordosten droht Sturm, Schnee. Also nichts wie weg hier, ehe wir aufs Neue festsitzen. Wieder fliegen wir übers Eismeer. Da und dort Schlittenspuren. Die Berge sind verhangen. Weit im Westen schimmert das Inlandeis.
Isartok ist eine Eskimosiedlung mit zwei Dutzend Häusern. Überall eine Hundemeute vor der Hütte. Wir verhandeln mit Hundetreibern, kaufen ein, packen alles in die Schlitten.
17.1.1992 Zurück in Isartok
Am Morgen regnet es. In Grönland! Mitten im Winter!
Trotzdem sind wir um 8 Uhr marschbereit. Die Hunde kommen. Um 9 Uhr ist alles verladen. Mit zwei Schlitten beginnt die Fahrt. Unter dem Neuschnee sickert Meerwasser an die Eisoberfläche. Langsam nur kommen wir von der Stelle. Zuerst hinter dem Schlitten herlaufend, dann auf dem Schlitten sitzend. Das Wasser steht knöcheltief. Es regnet mehr und mehr. Dazu starker Wind aus Nordost. »Was wir machen, ist eine Dummheit!«, schreie ich Odd zu, der neben dem Schlitten läuft. Wir lassen anhalten, beraten kurz und machen kehrt.
Nass und niedergeschlagen kehren wir zurück in unsere Hütte. Zuerst wird Feuer gemacht, dann Kaffee gekocht. Bis alles wieder trocken ist, wird es Abend sein. Am Nachmittag hört der Regen auf. Am Abend Mond (mit Hof). Das Wetter ist nicht stabil. Es muss kälter werden. Wir kaufen ein, besuchen die Schule, lesen.
Die wenigen Stunden mit Zwielicht sind so schnell vergangen. Die Nacht taucht alles ins Ungewisse.
18.1.1992 Isartok
Nasser Schnee am Morgen. Wind von Nord. Es regnet. Die Entscheidung, abzuwarten, ist zwingend.
Wir hängen in unserer Hütte herum, dann im Dorf. Es ist Samstag, die Siedlung wie ausgestorben. Mit der Ausrede, die Hundeschlitten zu organisieren, bleiben wir hier eine Stunde, dort eine halbe. So vergeht die Zeit.
In den überheizten Wohnstuben laufen Videos. In den Eingängen riecht es nach Fisch. Die Häuser sind alle nach demselben Grundriss gebaut. Ich wundere mich, dass der starke Sturm vom Inlandeis (Nordwest = Peterak) sie nicht umreißt.
Am Nachmittag gelingt ein Telefonkontakt mit G. Jensen (Dänemark), der uns weitere fünf Tage Schlechtwetter voraussagt: Wind aus Nordost, Regen, Schnee. Die Frostgrenze liegt in 200 Meter Höhe! Was tun?
Wenn es am Morgen nicht regnet, wollen wir starten. Tauwetter – Regen und ± 0 °C – hätte ich am allerwenigsten erwartet. Wir sind für Sturm und Kälte ausgerüstet, nicht für dieses Sauwetter. Dabei ist es hier öfter so. Unser Fehler, dass wir uns nicht genügend informiert haben. Warten und hoffen.
19.1.1992
Um 5 Uhr Tagwache. Es schneit nicht mehr, aber dichte Wolken am Himmel. Kein Mondlicht.
Die Hundetreiber sind rechtzeitig da, und kurz nach 7 Uhr geht es los. Langsam – wegen des tiefen Neuschnees und der Wasserstellen – kommen wir voran. Stockdunkle Nacht. Wir verlassen das halb offene Wasser und fahren am Rand des Festlandes entlang. Dann geht es durch eine tiefe Schlucht aufwärts, drüben hinab auf einen zugefrorenen See.
Wieder Wasserstellen. Brav ziehen die Hunde bergauf. Odd läuft voraus, Stein und ich folgen zuerst hinter den Schlitten, dann treten wir vor den Hunden eine breitere Spur. Um 14 Uhr halten wir an und bleiben.
Die zwei Hundeschlitten (Preis jeweils 1100 DK pro Tag) kehren um. Es stürmt. Wind aus Nordost, –7 °C.
Es ist immer grau, immer White-out (bedeckter Himmel und Nebel). Seit wir in Grönland sind, haben wir keine Sonne gesehen. Nur den Mond. Langsam werden wir uns an alles gewöhnen. Auch aneinander.
Wir haben uns hinsichtlich der Verständigung auf Englisch geeinigt. Zwei Norweger und ein Südtiroler (italienischer Staatsbürger) müssen doch gut miteinander auskommen, wenn sie dasselbe wollen.
20.1.1992
Wenig Schlaf. Nach einer stürmischen Nacht starten wir im Morgengrauen. Um 9 Uhr sind wir marschbereit.
Es geht steil bergan, und die Schlitten sind höllisch schwer. Der Schnee ist konsolidiert, trotzdem sinken wir manchmal ein. Nach zwei Stunden versuche ich zu segeln. Es treibt mich jedoch zu sehr nach Westen ab. Also gehe ich zu Fuß weiter.
Wir spannen die Felle auf die Skier und kommen noch langsamer voran. DerWind dreht mehr und mehr auf Nord und bläst uns feuchten Schnee ins Gesicht.
Mit minimaler Geschwindigkeit halte ich genauen Kurs: Nord. Rechtzeitig bevor sich derWind zum Sturm auswächst, schlagen wir das Zelt auf. Es gelingt. Die Behausung – lebensrettend – steht. Bis wir drinnen sind, vergeht eine Stunde. Alles ist voller Nassschnee, sogar die Unterkleider sind nass.
Man geht hier stundenlang durch ein graues Nichts, alles ist feuchtkalt, und man freut sich auf einen trockenen Schlafsack. Im Zelt aber noch mehr Nässe. Ob das auszuhalten ist? Ich bin falsch ausgerüstet. Zu warme (schwitzen!) und zu langsam trocknende Kleidung.
21.1.1992
Nach einer zweiten stürmischen Nacht ein langer Marschtag. Um 8 Uhr – es ist noch dunkel – stolpern wir aus dem Zelt. Um 8.30 Uhr gehen wir los, hinein in eine konturlose Nacht.
Bald haben wir Zwielicht, und öfter können wir vage den Horizont sehen. Nie ein Abschluss am Ende des Blickfeldes. Das zermürbt auf Dauer. Ich fühle mich ausgewiesen. Im Zwielicht oderWhite-out ausgesetzt. Ohne Distanzen, ohne Anhaltspunkte ist auch der Nomade verloren.
Das Gelände vor uns steigt immer noch an. Die Schlitten sind schwer. Schnell sind wir nicht.
Viele Jets fliegen genau über uns hinweg. Einmal versuchen wir, eine Grönland-Fly-Maschine anzufunken. Vergeblich.
Wir haben zwei Probleme: Wir können im Zelt nichts trocknen, und wir sind langsam, vorläufig viel zu langsam.
Dieses Leben in Nässe, Feuchtigkeit und Dunkelheit kann sich niemand vorstellen, der es nicht erlebt hat. Dazu der Sturm und keine Konturen.
Essen und Benzin dürften ausreichen. Unsere Leidensfähigkeit auch. Ob wir mit der Nässe zurechtkommen, ist die Frage. Und mit dem Verlorensein.
Wir müssen lernen, einiges im Schlafsack zu trocknen. Hoffentlich bleibt seine Isolationsschicht erhalten. Sonst wird das Überleben schwierig.
22.1.1992
Der Blick versucht, Halt zu finden. Vergeblich. Es gibt nichts zu sehen. Nichts Erkenn- bares. Alles ist das eine, und im Zwielicht ist dieses eine fremd. Alles verliert sich ins Beiläufige. Auch die Geräusche.
Nichts kann ich hier zuordnen. Nicht die Stille, nicht die Gerüche und nicht die angehäuften Ausdehnungen, die wie Ballungen aus Dunkelheit das Nichts vortäuschen. Hier muss die Welt erst noch erschaffen werden.
Wir gehen über diese nicht geordnete Welt. Und nur weil wir so viele praktische Probleme haben, laufen wir, ohne uns der Hoffnungslosigkeit bewusst zu werden, die diese massive Gleichförmigkeit ausstrahlt.
Wir zweifeln, ob wir Zelt und Schlafsäcke jemals noch trocknen können. Wir sind viel zu langsam.
23.1.1992
Nach einer kalten und schlechten Nacht starten wir frühzeitig. Schönes Wetter, der Horizont violett. Temperatur –38 °C.
Bald erkennen wir die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit. Wir kommen im trockenen, frisch verfrachteten Schnee so langsam voran, dass wir keine Chance sehen, die Durchquerung in 35 Tagen zu schaffen. Dazu die eisigen Schlafsäcke, das vereiste Zelt alle Tage.
Einstimmig beschließen wir aufzugeben (65° 56’ N, 39° 50’ W). Wir wollen es nicht bis an die äußerste Grenze treiben und uns retten lassen.
Noch kommen wir problemlos zurück. Wir sind etwa 1800 Meter hoch. Allerdings ist der Schnee so schlecht, dass auch der Abstieg zur Schinderei wird.
Wind von Nord. Wir versuchen zu segeln. Mit geringem Erfolg. Also laufen wir. Herrliche Lichtstimmungen: violett, ultraviolett der Himmel über der Horizontlinie. Die vielen Bergspitzen weit im Osten sind blau.
Alles ist eingefroren – Kameras, Töpfe, Kocher, sogar der Cognac.
So schön dieser Trip im Sommer sein muss, im Winter ist er ein Leidensweg: Kälte, Dunkelheit, Feuchtigkeit, Schinderei.
Langsam nur kommen wir im Sturm, später im Peterak voran. Dann laufen wir falsch, geraten in einen Eisbruch, sind ein verlorener, verzweifelter Haufen. Allen sind die Wangen angefroren. Weiter!
Obwohl der Rückmarsch zum Überlebenskampf geworden ist, bleibt es faszinierend, den Schneewehen zuzusehen, die über die Gletscherbrüche schlagen. Wie die Wellen eines reißenden Gebirgsflusses. Das Schneetreiben im Gegenlicht ist wie ein Vorhang, und die Sastrugis – gestern erst gebildet – sind mit wenig Fantasie belebbar. Sie lachen nicht über unser Scheitern.
Wir gehen mit und ohne Skier. Odd fällt in eine Spalte. Bis wir uns entscheiden, ein Gletschertal abwärtszufahren, vergeht Lebensgefahr.
Auf einer Rippe am Fuße des Gletschers schlagen wir das Lager auf. Wir sind zu weit rechts und so weit von Isartok entfernt, dass wir mindestens noch zwei Tage bis dorthin brauchen.
Irgendwo im Eisbruch, im Schneesturm, habe ich meinen Kompass verloren (Kugelkompass, der mich durch die gesamte Antarktis geleitet hat).
25.1.1992
Trotz White-out gehen wir los. In vielen Bögen, im ständigen Auf und Ab durchqueren wir Eisbrüche und Täler. Wir erreichen die ersten Felsen am Rande des Inlandeises. Dichtes Schneetreiben.
Orientierung unmöglich. Bleiben ist die einzige Lösung. Nachdem wir in einer windgeschützten Mulde einen Lagerplatz eingeebnet haben, schneit es weniger. Also weiter! Es geht sehr steil bergan. Warum? Und wieder der Sturm im Gesicht. Wir geben auf, gehen zurück.
Stürze in Eisgräben. Mit Mühe finden wir den hergerichteten Lagerplatz. Zu viel Schinderei für ein paar Kilometer! Wenn sich das Wetter nicht bessert, wird dieser Rückmarsch gefährlich. Dramatisch ist er schon.
Wir lagern an einem kleinen See. Das Wasser wird in einem 50 Zentimeter tiefen Loch an die Oberfläche gedrückt. Wir können uns nicht einigen auf »Abwarten« oder »Stück für Stück vorwärtstasten – zurück«. Wir warten auf klaren Himmel.
Leben auf dem Lande, im Nirgendwo. Wir sind nicht weit von Isartok entfernt, trotzdem eine Unendlichkeit, wenn nichts zu sehen ist in den wenigen grauen Stunden des Tages.
26.1.1992
Es stürmt und schneit die ganze Nacht hindurch. Vor dem Zelt, im Windschatten, türmt sich ein Meter Neuschnee. Wir sind eingeschneit! Als wir trotzdem losgehen wollen, erkennen wir die ganze Tragweite des neuen Schlechtwettereinbruchs: Wir sind eingesperrt!
Es liegt so viel Schnee, dass wir nicht von der Stelle kommen. Dazu White-out. Schneetreiben. Es ist relativ warm.
Wir müssen uns neu orientieren. Ich meine das nicht geografisch. Wo wir sind, ist kein Ort. Es sieht zufällig und momentan so aus, wie wir die Gegend sehen. Sie ist nicht in Beziehung zu bringen zu anderen Orten, die wir kennen, oder zu Isartok, wo wir hinwollen. Über Land kommen wir nicht weiter. Wir müssen zurück aufs Eis. Das Inlandeis ist wie das offene Meer auf einem anderen Stern. Dort sind Orientierung und Gelände leichter, weil der Boden sich nur geringfügig ändert.
Am Rande entspricht die Landschaft nicht mehr der Landkarte. Sie ist einem Prozess unterworfen. Von ihm hängt unser Überleben ab. Nicht mehr Wille und Durchhaltevermögen entscheiden, ob wir durchkommen, sondern die Umwandlung dessen, was um uns ist: Schnee, Kälte, Wind, Wolken.
Wir sehen keine Formen mehr, weder vertraute noch unvertraute. Seit einer Woche keine gewohnten Bilder. Nichts, womit ich mich identifizieren könnte. Wenn nichts mehr bekannt ist, womit sollte meine gewohnte Bilderwelt übereinstimmen?
Wie sich unser Blick im Nebel verliert, verlieren sich Gewissheiten. Ich kann mir den Weg nach Isartok anschaulich machen, eine Marschskizze nach der Karte zeichnen. Das alles aber entspricht nicht der Realität. Wir wissen alles und nichts über unsere Lage.
Wir schaufeln Schnee, holen Wasser, fotografieren. In unserer winzigen Welt, etwa 30 Quadratmeter rund um das Zelt, ist alles wie sonst. Dahinter das Nichts. Warum spielen wir uns Zuversicht vor?
Wenn selbst die Hoffnung sich ins Ungewisse verliert, ist weder nach vorne noch nach hinten ein Puzzle projizierbar. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Vielleicht lässt sich unsere Miniwelt später stückchenweise weiterschieben. Von Lagerplatz zu Lagerplatz, von Eiskuppe zu Moränenhügel. Nicht einen gedachten Weg gehen wird unsere Rettung sein, wenn das Wetter so bleibt, sondern das Gehen selbst.
Nur Hindernisse erlauben im Nichts eine Orientierung. Wir können uns eine Nacht, eine Rastpause lang an ihnen festhalten, dann einen neuen unsichtbaren Punkt anpeilen. Dieses Weiterkommen ist wie der Anfang von Leben.
27.1.1992
Wir gehen los. Im tiefen Schnee. Wir kommen unendlich langsam voran. Der Schnee könnte schlimmer nicht sein (Pulver, Harsch bis zu den Knien). Es geht ständig auf und ab. Hin und wieder ist es bewölkt, und wir sehen absolut nichts – keine Gräben, keine Wandgangeln, keine Wechsel im Schatten.
Herrliche Lichtstimmungen am Nachmittag. Der Himmel ist vom Meer (Sonne) zum Inlandeis hin von Infrarot bis Ultraviolett gefärbt. Eindrucksvoll auch der Rand des Eises, das senkrecht in einen zugefrorenen See abbricht.
Wir lagern an einem langen See, kochen. Plötzlich Nordlicht. Wie blaue Schleier hängen Lichtzungen vom Himmel. Es ist gut, in Dorfnähe zu sein.
28.1.1992
Später Aufbruch. Der Himmel ist bewölkt. Kaum Licht. Die Schneekruste bricht unter den Skiern. Langsam nähern wir uns Isartok.
Plötzlich entdecken wir weit rechts von uns einen Hundeschlitten. Sieben Hunde, zwei junge dazu, und ein Jäger ziehen langsam heimwärts. Wir dürfen unsere Schlitten anhängen, gehen gemütlich hinter dem Gespann her.
Wind aus Ost, dichtes Schneetreiben. Isartok sehen wir erst 100 Meter vor den ersten Hütten.
In der Schule des Dorfes (150 Menschen) finden wir Unterschlupf, schwitzen eine Nacht lang in den überheizten Räumen.
29.1.1992
Nach einer unruhigen Nacht in der Schule (zu warm und draußen Sturm) packen wir unsere Sachen in eine Ecke, ziehen ins Lehrerhaus um. Langes Frühstück. Diskussion über Materialien und Ausrüstung. Ein neuer Winterversuch wird andiskutiert. Wie und wann soll vorerst offen bleiben.
Mein Bemühen um ein weiteres Permit, Grönland im Winter zu durchqueren, wird vom Polar Institute abgelehnt. Wegen der großen Gefahren während der arktischen Nacht. Auch nach der gelungenen Längsdiagonale (1993) zusammen mit meinem Bruder Dr. Hubert Messner wird mir und allen anderen Anwärtern eine Winterexpedition auf dem Inlandeis verboten. Der vorgebliche Winterversuch 1995 von R. Peroni darf als Werbegag verstanden werden.