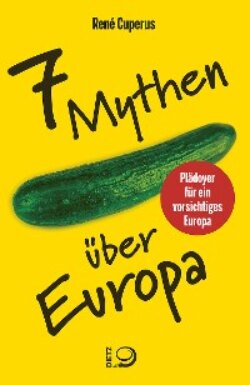Читать книгу 7 Mythen über Europa - René Cuperus - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die historische Notwendigkeit der europäischen Zusammenarbeit
ОглавлениеIch habe kein Problem damit, die Europäische Union als ein heiliges Projekt zu bezeichnen. Heilig im Lichte des barbarischen 20. Jahrhunderts, in dem Europa in zwei Weltkriegen beinahe Selbstmord begangen hätte. Jene, die sich gegen eine europäische Zusammenarbeit wehren und einfach für eine Rückkehr zu einem Europa der vollkommen unabhängigen, souveränen Nationalstaaten plädieren, machen sich einer ahistorischen Einfältigkeit schuldig. Insbesondere dann, wenn sie keine Antwort auf die Machtunterschiede zwischen großen und kleinen Ländern, die der Rohstoff für Konflikte und Krieg waren, und auf die Great Power Competition in einer globalisierenden Welt haben.
Die europäische Kooperation zwischen ehemaligen Feinden mag vielleicht heilig sein, doch das bedeutet ganz bestimmt nicht, dass alles in Brüssel heilig ist. Dass, zum Beispiel, die vielen Tausend Lobbyisten in Brüssel heilig sind. Oder dass der Stabilitätspakt heilig ist. Oder der Wanderzirkus nach Straßburg. Oder die Maseratis in den Tiefgaragen des Europäischen Parlaments. Oder der Euro.
Gerade weil das Prinzip der europäischen Zusammenarbeit so essenziell ist, muss das europäische Projekt mit großer Weisheit und Umsicht betrieben werden, und zwar so, dass es immer mit einer stabilen Akzeptanz bei der europäischen Bevölkerung rechnen kann. Aus Umfragen geht hervor, dass dies zurzeit der Fall ist. Große Mehrheiten in Europa stehen im Prinzip hinter der Europäischen Union. Und laut jüngsten Forschungen hat diese Unterstützung infolge des Brexit-Desasters sogar noch stark zugenommen. Man könnte sogar sagen: Die Europäische Union »was saved by the bell« durch den Brexit – das frühe Läuten zum Ende der britischen Mitgliedschaft an Brüssels Haustür hat sie gezwungen, die Augen zu öffnen.
Denn eine Zeitlang sah es weniger rosig aus. Die Unterstützung für die Europäische Union befand sich für längere Zeit auf dem absteigenden Ast. Eigentlich schon seit dem überzogenen Vertrag von Maastricht, als man sich für eine allmähliche Vertiefung entschied. Worauf dann die Bankenkrise, die Eurokrise und die Flüchtlingskrise folgten. Das alles hat damals der Legitimität und der Popularität der EU nicht gutgetan.
Die Europäische Union gerät in Schwierigkeiten, wenn sie mehr Nationalismus hervorruft, als sie bekämpft, und in den letzten Jahren verhielt es sich so. Man betrachte nur den massenhaften Aufstand des sogenannten Nationalpopulismus gegen die EU. Erst seit dem Chaos des Brexits und dem geopolitischen Erwachen Europas im »Jahrhundert von Trump und Xi« hat sich ein Umschwung ergeben, so stark selbst, dass die meisten Nationalpopulisten einen Rückzieher gemacht haben und nicht länger auf einem Exit-Kurs sind; stattdessen wollen sie Europa von innen her aushöhlen.
Die Unterstützung mag jetzt wieder da sein, aber aufgepasst: Aus Untersuchungen geht hervor, dass die Unterstützung für die EU oberflächlich und uninformiert ist. Der durchschnittliche Europäer ist weder fanatisch für noch fanatisch gegen Europa. Er ist gleichgültig-ambivalent.
Die Entscheidung für Europa ist für viele pragmatisch-rational und beruht vor allem auf wirtschaftlichen Interessen und Vorteilen beim Handel. Für andere ist »pro Europa« ein Lifestyle-Statement gegen vulgären Nationalismus und »Das-eigene-Volk-zuerst-Fremdenfeindlichkeit«. Wieder andere wünschen sich vor allem eine stärkere Führungsrolle der EU bei den großen Themen: Klima, Migration, Sicherheit. Doch die Distanz zwischen europäischer Multilevel-Governance-Politik und dem durchschnittlichen Europäer bleibt groß.
Das Gefährlichste, was daher passieren kann, ist, dass wir falsche Entscheidungen auf die Spitze treiben: für Europa oder für den Nationalstaat. Kampagnendynamik und Medienlogik neigen allerdings zu einem solchen Schwarz-Weiß, einer solchen Ausschließlichkeit. Das ist die Fallgrube, in die man die Menschen tappen lassen will, für die EU oder für den Nationalstaat. Keine Grautöne, keine Optionen, keine Alternativen.
Im nachlässigen EU-Diskurs wird regelmäßig der Eindruck erweckt, Nationalstaaten seien lebensgefährlich (Nationalismus = Krieg) oder zumindest überholt. Zu klein, um noch ernst genommen zu werden. Doch es ist äußerst riskant, sich auf diese Weise endgültig vom Nationalstaat verabschieden zu wollen, insbesondere dort, wo von einer gut organisierten, gut geölten EU als Alternative überhaupt nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil. Durch einen solchen Diskurs drohen wir im schlechtesten aller denkbaren Szenarien zu landen: schwache, reduzierte Nationalstaaten in einer schwachen, uneinigen und handlungsunfähigen EU. Dies alles impliziert, dass der zukünftige Kurs Europas von einem gut austarierten Gleichgewicht zwischen europäischer Zusammenarbeit und nationaler Demokratie bestimmt sein sollte.
Die größte Gefahr, die der EU daher droht, ist eine Entfremdung des europäischen Projekts von seiner Bevölkerung, wodurch Raum für Nationalisten und Antieuropäer entsteht, um diesen Unfrieden zu mobilisieren und auszunutzen. Man muss sich dafür nur ansehen, wie die Eurokrise und die darauffolgende Flüchtlingskrise, die zu den neuen Ungleichheiten und Unsicherheiten der neoliberalen Globalisierung hinzukamen, von der Anti-Establishment-Bewegung des Rechtspopulismus benutzt wurden und sie groß gemacht haben.
Diesem Buch liegen vier Sorgen zugrunde:
1. Die große Entfremdung zwischen der europäischen Politik und dem durchschnittlichen EU-Bürger. Dabei geht es um Entfremdung hinsichtlich von Wissen und Information sowie um gefühlte demokratische Entfremdung. Dahinter verbirgt sich ein echtes Demokratiedefizit. Das »nicht politische Europa« ist vielen Bürgern vertraut geworden und wird breit bejaht: die Vorteile des Binnenmarkts, Europa als Softpower-Weltmacht hinsichtlich von »Produktstandards« und »Sicherheitsgarantien«, das Erasmus-Programm, der freie Verkehr zwischen den Ländern über offene Grenzen. Aber das »politische Europa« in Brüssel, Straßburg und Frankfurt ist für Nichteingeweihte ein Wolkenkuckucksheim. Mehr noch: Das Klischeebild dieses politischen Europas ist das einer postdemokratischen Technokratie, eines »Elitenprojekts« für Banker, Lobbyisten, große Unternehmen und für Menschen mit viel »demokratischem Kapital«. Diese Tatsache allein ermahnt zu europäischer Vorsicht, Selbstbegrenzung und Mäßigung.
2. Meine zweite Sorge betrifft die Instabilität der nationalen Gesellschaften. Dort gibt es in zunehmendem Maße eine politische Fragmentierung, neue Trennlinien und Ungleichheiten, insbesondere zwischen Hochqualifizierten und Niedrigqualifizierten (»international Mobile« versus »national Immobile«). Die etablierte Politik, vor allem die Volksparteien der Nachkriegszeit, kann sich nicht länger auf eine stabile gesellschaftliche Basis stützen, sondern befindet sich in einem Spagat zwischen polarisierenden Kräften: Populismus, postindustrielle Ungleichheit, multikulturelle Spannungen, einem geschwächten Sozialvertrag und politischem Misstrauen. Der positive Beitrag der europäischen Politik besteht darin, die nationale Stabilität zu fördern, nicht sie zu untergraben. Wie kann man es bewerkstelligen, dass europäische Politik nicht im Konflikt zu den nationalen Demokratien steht, sondern mit diesen harmoniert?
3. Meine dritte Sorge steht in Verbindung damit: Gelingt es der Mainstreampolitik, den Angriff der Nationalpopulisten auf Europa abzuwehren? Diese befürworten mit ihren Exit-Plädoyers de facto eine Auflösung der EU. Mit ihrer illusionären Vorstellung von hundertprozentiger nationaler Souveränität und der Unterschätzung der geopolitischen Schwäche Europas scheren sie sich einen Dreck um die Lektionen des 20. Jahrhunderts. Wie können wir in Europa den aggressiven Nationalismus dauerhaft hinter uns lassen und ihm keine Chance zur Rückkehr geben?
4. Meine vierte Sorge betrifft die geopolitischen Machtverschiebungen auf unserem Globus. Der Aufstieg Chinas, ja sogar die dominante Entfaltung eines »asiatischen Jahrhunderts«, dem ein geschwächter und uneiniger Westen gegenübersteht. Die transatlantischen Beziehungen befinden sich seit dem ›Donald-Trump-Schock‹ in einer Krise. Antiamerikanismus hat sich breitgemacht in Europa, und der Gedanke einer europäischen strategischen Autonomie (gegenüber die USA) hat seitdem an Bedeutung gewonnen. Europa präsentiert sich zugleich als eine gespaltene, träge und nach innen gekehrte Union, die nicht bereit ist für die Great Power Competition des 21. Jahrhunderts. Wie kann man die außenpolitische Handlungsfähigkeit und die globale Konkurrenzfähigkeit der EU stärken? Wie macht Europa als ›postmoderne Venus‹ Weltpolitik?
Was ist angesichts dieser Herausforderungen und Probleme eine kluge europäische Politik? Wie kann man, gemäß dem Motto der deutschen EU-Ratspräsidentschaft »Gemeinsam. Europa wieder stark machen«? Welches Europa kann mit der dauerhaften Unterstützung der europäischen Bürger rechnen? Wie wird man, bei aller Gemeinsamkeit, den beträchtlichen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Unterschieden innerhalb der EU gerecht? Wie seiner Seele, der reichen kulturhistorischen Vielfalt?
Die kommenden Jahre werden zum Reality Check für die Reichweite und Glaubwürdigkeit der europäischen Ambitionen in stark gespaltenen Gesellschaften werden.
Darum geht es in diesem Buch. Es ist ein Versuch, aufs Neue laut nachzudenken, um in Form eines Essays die Stärke und Schwäche des europäischen Projekts deutlich zu machen. Um die komplizierte, lauwarme Haltung des »europäischen Bürgers« hinsichtlich der Europäischen Union erneut zu verstehen, und herauszufinden, welches »Projekt Europa« darauf eine richtige und nachhaltige Antwort sein kann. Kein »Das-eigene-Land-zuerst«, aber auch keine »Vereinigten Staaten von Europa«! Die beiden Extreme basieren auf Mythen, wie im Verlauf des Buchs deutlicher gemacht werden wird. Nationalpopulismus und Neoföderalismus sind beide riskante Irrwege, die nur mit unwahren Mythen verteidigt werden können. Der »Europäer« möchte irgendwas dazwischen, einen realistischen Mittelweg: intensive europäische Zusammenarbeit unter Beibehaltung der nationalen Identität. Ob es diesen Mittelweg wirklich gibt und er tatsächlich auch eingeschlagen wird, das ist die große Frage.
Dieses Buch konstatiert einen tragischen europäischen Kurzschluss: Die meisten Bürger wissen nicht, in welchem Europa sie leben. Sie meinen, in einem konföderierten Europa zu leben – dort, wo europäische Integration unter Beibehaltung der nationalen Souveränität vorliegt – , aber de facto leben sie in einem föderalen Europa. Vor allem die Währungsunion ist eine nahezu verwirklichte »Ever Closer Union«, in der die Mitgliedsstaaten europäische Teilstaaten geworden sind, deren Haushaltssouveränität aufgegeben wurde und nicht mehr existiert (Taxation without Representation).
Die große Frage ist: Was wird passieren, wenn den Bürgern mit der Zeit deutlich (gemacht) wird, in welcher EU sie eigentlich leben? Entscheidet sich die stille, konstruktiv-pragmatische Mehrheit dann für die etablierte Ordnung der EU oder für die nationalpopulistischen Gegenkräfte? Meine größte europäische Sorge ist, dass ich die Antwort auf diese Frage nicht sicher weiß. Ich wage dies nicht vorherzusagen.
Meine Befürchtung ist, und aus dieser Angst ist dieser Essay entstanden, dass Europa theoretisch einer größeren und stärkeren Einheit bedarf, um in einer sich globalisierenden Welt überleben zu können. Eine möglichst weitgehend gemeinschaftliche Außen- und Sicherheitspolitik sowie eine möglichst weitgehend gemeinschaftliche Klima-, Wissenschafts- und Technologiepolitik. Zudem braucht sie geschlosseneres Handeln, um der Währungsunion die Stabilität zu verleihen, die sie braucht. Meine große Sorge jedoch ist, dass Europa per Definition politisch, kulturell, wirtschaftlich und verwaltungstechnisch zu divers und uneins ist, um eine solche Einheit zustande zu bringen, ohne gleichzeitig dem demokratischen Geist und der kulturellen Vielfalt, aus denen Europa gerade seine einmalige Lebensqualität schöpft, enormen Schaden zuzufügen.
Meine Furcht läuft auf ein faustisches Dilemma hinaus: Um Europa zu retten, zu stärken und zu beschützen, laufen wir Gefahr, seine Seele vernichten zu müssen. Ich setze darum alles auf eine Zwischenposition, in der Hoffnung, dass diese möglich sein wird, denn wenn dem nicht so ist, laufen wir mit offenen Augen in die Schwarz-Weiß-Falle einer Einheitsföderation oder nationalistischer Nationalstaaten.