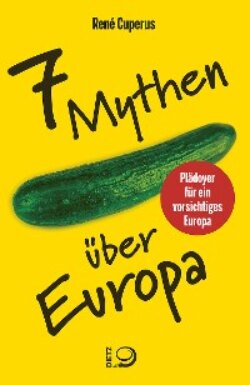Читать книгу 7 Mythen über Europa - René Cuperus - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine differenzierte Sicht von Europa
ОглавлениеIch will sofort mit der Tür ins Haus fallen und mit offenen Karten spielen: Ich ringe mit Europa. Ich bin weder Nationalist noch Föderalist, nicht antieuropäisch, aber auch nicht europhil. Würde es nicht so trendy wie »Transgender« klingen, würde ich mich selbst als »Transnationalist« oder »Transeuropäer« bezeichnen. Ich bin ein Anhänger eines bunten, pluralistischen Europas, nicht eines grauen, technokratischen, zentralistischen. Ich bin ein Anhänger intensiver, grenzüberschreitender europäischer Zusammenarbeit, aber ein Gegner einer forcierten, aufgezwungenen Vereinigung. Ich bin ein Bewunderer der Summe der europäischen Nationalstaaten, wobei das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.
Europa, das ist für mich vor allem Barcelona, Vilnius, Dublin, Berlin, Zagreb. Europa, das ist das reiche Mosaik europäischer Staaten, Kulturen, Traditionen, Gerüche und Farben. Darüber hinaus gibt es die Notwendigkeit und den Mehrwert der europäischen Zusammenarbeit. Notwendig geworden aufgrund der fatalen Kriegsgeschichte unseres Kontinents. Die Deutschen sagen es treffend: Die Geschichte Europas hat uns zu historischer Zusammengehörigkeit verpflichtet: »Nie wieder« und »Nie wieder allein«. Um dieses »Nie wieder« zu garantieren, haben wir uns tiefgreifende Formen der europäischen Zusammenarbeit und Verflechtung auferlegt.
Die Kernfrage ist und bleibt, wie weit diese europäische Verflechtung gehen muss und gehen kann. Kann man 75 Jahre nach der Befreiung dieselbe »Ever Closer Union« anstreben, wie sie die Pioniergeneration in der Nachkriegszeit vor Augen hatte? Ist das in Gesellschaften möglich, die unermesslich viel mündiger und demokratischer sind als Ende der 1940er-Jahre? Geht das in einer Europäischen Union, die durch nahezu permanente Erweiterung (von sechs auf 27 Mitgliedsstaaten und demnächst vielleicht noch mehr) immer diverser und heterogener geworden ist? Ist ein zentralistischer Top-down-Einheitsprozess etwas, das noch in die horizontalen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts, zu der improvisierenden Network-Generation der Millennials passt? Bei all dem sind starke Zweifel angebracht.
Dem gegenüber steht zugegebenermaßen die Frage, ob kleine Nationalstaaten in einer sich globalisierenden Welt überhaupt überleben können, ob ein uneinig und bürokratisch verhandelndes Europa der Great Power Competition des 21. Jahrhunderts gewachsen ist? Aber kann dies jemals Grund genug sein, um eine Vereinigung Europas zu erzwingen, ohne dafür den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung zu haben?
Zum Glück ist Europa mehr als Brüssel. Mehr als das Europaviertel in Brüssel. Mehr als die europäischen Institutionen. In Brüssel denkt man zu sehr, »sie« seien Europa, sie repräsentierten das »wahre Europa«. Im Gegensatz zu den halsstarrigen, quertreibenden Mitgliedsstaaten. Im Gegensatz zu den Nationalstaaten und den nationalen Nabelschauern. Im Gegensatz zu den nationalistischen Populisten. Im Gegensatz zu den in den Nationalstaaten zurückgebliebenen Menschen, die angeblich die Neue Welt noch nicht verstanden haben. Kleindenkende Menschen, die noch in der Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts leben.
Die »Feinde« Brüssels, die nationalistischen Populisten, sind in ihrem leichtsinnigen Leugnen einer europäischen Schicksalsverbundenheit ebenso fanatisch. Dort, wo die Nationalisten keine »Einheit und Homogenität« in Europa erkennen können, sehen sie davon wiederum zu viel im Nationalstaat und geraten dabei in Konflikt mit dem Pluralismus, der ein wesentliches Element jeder Demokratie ist. Als bestünden Nationalstaaten aus einem einzigen Volk, das mit einer Stimme spricht. Das ist gefährlicher Unsinn.
Das Schwarz-Weiß-Denken über Europa macht mehr kaputt, als uns lieb ist. Die Frage ist nicht: entweder die Europäische Union oder der Nationalstaat, entweder Brüssel oder die Hauptstädte. Wer glaubt, mit dieser Haltung Nationalismus (im Sinne von Patriotismus) dämonisieren zu können, erntet erst recht das, was er bekämpfen will: antieuropäischen Nationalismus. Und wer die Einheit des Nationalstaates im Gegensatz zu Europa besingt, der trällert schon bald eine antidemokratische, fremdenfeindliche Melodie.
Ebenso wenig darf die Europadebatte ausschließlich mit moralischen Begriffen geführt werden: Europa ist gut, der Nationalstaat ist schlecht. »Europa« wird vor allem von Hochqualifizierten gewollt und ungewollt als »Lifestyle-Markierung« verwendet. Um sich von ordinären Populisten und »Das-eigene-Volk-zuerst«-Nationalisten abzugrenzen. Europa als moralisches Projekt, bei dem es mehr um die richtige Einstellung geht als um echte Anteilnahme an der europäischen Politik und Wissen darüber geht.
Darum geht es diesen Menschen auch nicht. Es geht um ein Lifestyle-Statement, um ein identitätspolitisches Bekenntnis zu der Blase, der man angehören möchte. Kosmopoliten versus Nationalisten. International versus national. Gut versus schlecht. Wer für Europa ist, ist ein besserer Mensch. Wer Probleme mit Europa hat, ist ein böswilliger oder dummer Mensch.
Dieser Schwarz-Weiß-Moralismus ist eine Folge des Kulturkampfs zwischen Establishment und Antiestablishment, zwischen »Elitisten« und Populisten. Er beeinflusst auch die Debatte über Europa. Er verhindert, dass nüchtern und sachlich über das Wie der europäischen Zusammenarbeit kontrovers diskutiert werden kann, und dämonisiert sowohl die Fürsprecher als auch die Kritiker des europäischen Projekts. Das ist schlecht für die Auseinandersetzung und letztendlich schlecht für Europa, denn ihr ist mehr mit Kontroverse und reflexiver Kritik gedient.