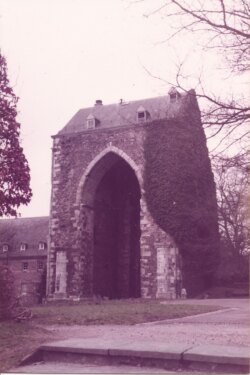Читать книгу UDDUPURTU - René Fries - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. "Geist"
Оглавление2.1. Ohne diese ausführlichere Besprechung wäre nicht nur die nachfolgende "Fundamentalistenschelte" unverständlich, sondern würden auch die in den letzten Kapiteln anvisierten "Lösungsvorschläge" jeglicher Begründung ermangeln. Also heiβt es wieder einmal weit ausholen:
Max Scheler, in einem exposé an G. v. Hertling: "(...) dass die Gesetze des Geistes, um dessen Begriff es sich hier handelt, von aller Sonderbeschaffenheit der menschlichen Gattung und ihrer Organisation unabhängig sind". Weiter: "(...) das Zugeständnis, das sogar Tertullian der von ihm keineswegs für unkörperlich gehaltenen Seele machen musste (usw)", in: Hans Blumenberg, Höhlenausgänge, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1300, FFM 1989, S. 328. Weiter: In dem schon 1978 bei Albin Michel in Paris erschienenen L'Esprit, cet inconnu (Der Geist, dieser Unbekannte) beschreibt Jean E. Charon (directeur de recherches nucléaires au Commissariat à l'Energie Atomique de Sarclay) auf S. 44 ff "die Struktur einer Materie die einen Raum des Geistes 'enthält' ", also Partikel die "einen Raum umschliessen der seinen informationellen Inhalt niemals verlieren kann" und die "nach unserem körperlichen Tod übrigbleiben, praktisch für die Ewigkeit". Eine unmissverständliche Bestätigung der Haupt-Intuition der meisten Religionen, die ihrerseits mehr als einmal bestätigt wurde: "... die Quantumwelt wird regiert durch eine Art Gesetz zum Erhalt der Information", so Natuurwetenschap en techniek (NWT) 10/2010 und nochmals "(...) das schafft aber ein stachliges Problem für den Quantumphysiker, den sogenannten Informationsparadox. Denn wo bleibt all die Information die in dem Schwarzen Loch aufbewahrt wurde? Verschwand sie mit der Hawking-Strahlung ins Weltall, etwa so wie ein Radiosender seine Musik in den Äther schickt? Es klingt einleuchtend, ist aber unmöglich. Denn die Hawking-Strahlung entsteht ja ein ganz klein wenig ausserhalb des Wahrnehmungshorizonts. Und Information darf nicht so mir-nichts-dir-nichts verloren gehen" (NWT 12/2010). In Le hasard et la nécessité (Edition du Seuil, Paris 1970, S. 135) hatte übrigens auch Jacques Monod schon geschrieben dass "man akzeptieren muss (im Sinn von zugeben, eingestehen) dass er (i.e. der Geist) zumindest im Quantum-Maβstab eine substantielle Wirklichkeit ausdrückt (darstellt)".
2.2. Also: Die schiere Mordlust mit der das patriarchalische System, das ja die von Aliti und le Fort angemahnte volle Mitverantwortung nicht zugestehen kann ohne sich selbst zu zerstören und eben deshalb jegliche wirkliche Frauen-Emanzipierung bekämpft hat und bekämpfen muss, diese Mordlust des Patriarchats kommt zweifellos am deutlichsten zum Ausdruck in dessen heutigen Hauptverfechtern, den islamistischen Fundamentalisten – die ja nun wirklich, wie alle Fundamentalisten zu allen Zeiten, die ärgsten Gegner jeglichen Geistes d.h. jeglicher Kultur sind. Bevor nun aber auf diese Leute näher eingegangen werden kann, muss zunächst Hans Blumenberg zu Wort kommen: "Kultur besteht darin, dass die Natur es sich leisten kann oder zuzulassen gezwungen wird, ihr selektives Verfahren zugunsten der physisch und reproduktiv Tüchtigsten zurückzunehmen, einzuschränken, auszusetzen und durch abschirmende Empfindungen neuer Art: Wertempfindungen, Vergnügen, Genuβ, überbieten zu lassen. Ohne den Schutz für die Mitesser, ohne den Schonraum der Höhle und die Macht der Mütter in der Höhle wäre die Entstehung der kulturell typischen Figuren in der Menschheitsgeschichte undenkbar. (...) Kultur ist und wird bleiben eine 'Verschwörung' gegen die exklusive Standardisierung des Menschlichen durch die Tüchtigsten, Nützlichsten, Stärksten (…). Wenn nun das, was zur Rechtfertigung des blanken Daseins und zur Kompensation von Leistungsausfällen erfunden worden war, aufsteigt zum Anlaβ der Bewunderung und sogar zur Qualifikation für den Reproduktionsprozeβ, so ist das nicht nur Ergebnis eines Kunstgriffs der Selbstbehauptung in hoffnungsloser Lage, sondern steht in Konvergenz zum anthropogenetischen Prozeβ selbst, bringt zur vorzeitigen Ausprägung, was in diesem ohnehin und aus immanenter Tendenz bevorsteht." (Höhlenausgänge, a.a.O., S. 32 ff).
Noch einmal scharf hinhören: "anthropogenetischer Prozeβ" und "immanente Tendenz". Was übrigens Teilhard's Entwicklung zur "noosphère" entspricht oder dem, was Jacques Monod "cette rage de l'hydrogène à créer l'esprit", etwa: "diese wütende Zielgerichtetheit des Wasserstoffs um den Geist hervorzubringen" nennt.
Weiter Blumenberg: "Was 'Geist' oder ein wenig anders heiβen mag und so oder ein wenig anders entstanden sein kann, steht von diesem Ursprung her und durch ihn zur Rationalität der Selbsterhaltung verquer – auβer zu der seiner eigenen."
Dies nun: "steht (...) verquer" ist der Dreh- und Angelpunkt der nachfolgenden historischen, den "Geist" betreffenden Analyse. Zuerst jedoch bedarf die soeben angesprochene "immanente Tendenz" wohl noch einer kurzen philosophischen Erläuterung.
In Husserls Geschichtsbild fängt die "immanente Teleologie des europäischen Menschentums" bei den Griechen an, und zwar als "ein neues Interesse am All." Eingeschlossen in besagtes neues Interesse waren "intentionale Unendlichkeiten" die nur in einem Menschentum wirksam werden konnten "das, in der Endlichkeit lebend, auf Pole der Unendlichkeit hinlebt". Es gibt bei ihm aber auch, sozusagen als "Rahmen", eine bruchlose und widerspruchsfreie Einstimmigkeit des Gegebenen, die er auch die "universale Normalstimmigkeit der Erfahrung" nennt und in der es begründet ist, dass wir das uns Gegebene als Wirklichkeit bewerten und gelten lassen. Die "solcherart beim Individuum entstehende 'Horizontstruktur' ist (...) so etwas wie eine morphologische Bestimmtheit." Wie auch Ortega schreibt, "dass die geschichtliche Wirklichkeit in einer früheren und tieferen Schicht eine biologische Potenz ist".
"Immanente Teleologie" auch bei J. Burckhardt: Nach dem deutsch-französischen Krieg 1870-71 und der nachfolgenden Kommune reiste er nach Rom und genoβ dort, wie er seinem Kollegen Nietzsche schrieb, die Fülle herrlicher Kunstwerke mit dem ausdrücklich vermerkten Hintergedanken, eine höhere Macht könnte ihn, Burckhardt, nach Rom verschlagen oder beordert haben um den Vatikan zu photographieren bevor etwa ein schauderhaftes Schicksal darüber hinweggehe. Denn seit dieser Pariser Kommune sei überall in Europa alles möglich. Weiter, schrieb er, überkomme ihn manchmal ein Grauen, die Zustände Europas könnten sozusagen über Nacht in eine Art "Schnellfäule" umschlagen. "Und wer weiβ, wie diese Zeiten erst noch werden wollen".
Dies verräterische – bei einem präzisen Stylisten wie Burckhardt auf jeden Fall verräterische weil sehr bewuβt geschriebene – wollen deutet hin auf etwas das der oben genannten "immanenten Teleologie des europäischen Menschentums" zumindest ähnelt, und kann auch mit Max Schelers "intentionalem Fühlen" in Verbindung gebracht werden sowie mit jenem "unterirdischen Wühler", der etwas später bei Kafka vorkommt. Es gibt denn auch tatsächlich, wie die Kenner jener Epoche wissen, ein entsprechendes "Generationsgefühl", worüber z.B. auch Ernst Wiechert ausführlich geschrieben hat v. Und wobei es demzufolge um nichts weniger als um einen Gedankenstrang geht, der eine wie immer geartete aber jedenfalls auch nicht allzu vage "menschheitlich-geistige Intentionalität" zur Voraussetzung hat, und dem also einige der gröβten damals lebenden Geister ungefähr gleichzeitig nachhingen.
Dass all diese, zwangsläufig unausgegorenen d.h. "unkritischen" Generationsgefühle alsbald auf die blutigste Art bestätigt werden sollten und zwar gleich doppelt, braucht hier nicht noch extra betont zu werden.
Die weiter oben herausgehobenen Termini 'anthropogenetischer Prozeβ' und 'immanente Tendenz' scheinen jedenfalls, rein philosophisch gesehen, unanfechtbar.
Die Weltgeschichte nun, also das laut Leibniz bestmögliche vi Umsetzen der o.g. immanenten Tendenz, ist "objektiv dialektisch"; wie Jakob Böhme ganz richtig erkannte, kann der jovialische Schein des Lichts ohne Dunkelheit noch nicht mal gedacht werden. Und über Böhme schreibt also Ernst Bloch (in: Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte, Suhrkamp, Ffm 1977, S. 228 ff): " ...im Volk lief dagegen mit völliger Ungleichzeitigkeit etwas weiter, was viel älter war, eben die alte manichäische Lehre, durch Traktätchen verbreitet in finsteren Kneipen, in Schmieden, in Spinnstuben, wo es sonderbare Hergereiste gab, die etwas erzählten, was ganz anders klang als das, was der Herr Pfarrer in der Kirche predigte. Das lebte in den versponnenen Menschen und den versponnenen Winkeln und Konventikeln weiter, ging von Mund zu Mund, war wohl auch gefährlich, gesagt zu werden. (...) Diese Welt war auch da, und sie ist den bürgerlichen Literaturhistorikern und Philosophiehistorikern völlig entgangen. Und plötzlich tauchte im 17. Jahrhundert aus dieser Welt ein Denker auf, ein bedeutender Philosoph, der nichts mit der scholastischen Bildung zu tun hatte, der ein Handwerker war (...) mit viel trüber Mystik, aber auch mit der tiefsinnigsten Form von Dialektik, die es seit Heraklit gab".
Wie tiefsinnig, das zeigt Leibnizens Pech – sogar Voltaire hat damals "nix kapiert".
Man weiβ, dass Leibnizens "Optimismus" das Pech hatte, dem Lissaboner Erdbeben von 1755 nicht gewachsen zu sein, weil die damalige Wissenschaft ja nicht so weit wie die heutige war und das alte augustinische "unde malum?" ["woher (kommt) das Böse?"] deshalb eine Virulenz hatte bezw. behielt wie sie jedoch im Lichte neuerer Forschung nicht mehr gegeben erscheint: der Zusammenhang zwischen Tektonik (Erdbeben), Gebirgsformierung, Klima (Wind, Regen), Erosion und Leben ist ja derart, dass das Leben ohne die genannten Phänomene nicht möglich bezw. nicht entstanden wäre. Noch grundlegender, nämlich von der Astrophysik her, wird dieser Sachverhalt in der nl. Zeitschrift Natuurwetenschap en techniek (NWT) 4/2003 beleuchtet: "Überdies entstehen Gammablitze während jener (Stern-)Explosionen, die Hoflieferanten sind von allen Elementen schwerer als Helium. Erst gegen Ende ihres Lebens, wenn der Wasserstoff verbraucht ist, formen Sterne schwerere Elemente. Die verbreiten sich durchs Weltall nachdem der Stern stirbt. Ohne kosmische Superexplosionen gäbe es keinen Sauerstoff, Kohlenstoff, Calcium und Eisen. Ohne kosmische Superexplosionen kein Leben."
Die Böhme'sche "objektive Dialektik" – ohne Dunkelheit ist Licht noch nicht einmal denkbar – scheint also konstitutiv für die gesamte Schöpfung zu sein.
Nun hat aber die dem alten augustinischen "unde malum?" eigene Virulenz ja nicht nur Leibniz zu seinen Essais de théodicée veranlaβt, sondern auch Bossuet nicht losgelassen.
"ESSAIS DE THEODICEE – Sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal", chronologie et introduction par J. Brunschwig, Garnier-Flammarion, Paris 1969. Hierzu Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1301, Ffm 1998, S. 129: "In der 'Théodicée' setzt sich Leibniz mit der Auffassung Bayles auseinander, dass es Vernunfteinwände gegen die Religion gebe, die nicht oder zumindest noch nicht entkräftet werden könnten; Leibniz meint (§ 27), dass die aristotelische Logik völlig ausreiche, um jede solche Argumentation jederzeit zu bewältigen, sofern sie wirklich rein deduktiv-rational sei. Anders sei es bei den Einwänden, die auf Wahrscheinlichkeit beruhen, car l'art de juger des raisons vraisemblables n'est pas encor bien établi, de sorte que nostre Logique à cet égard est encor très imparfaite, et que nous n'en avons presque jusqu'icy que l'art de juger des demonstrations (§ 28). Aber dieser mangelhafte Zustand der Logik falle bei der Verteidigung der Religion nicht ins Gewicht, da eine Auseinandersetzung mit Argumenten der Wahrscheinlichkeit insofern sinnlos sei, weil die Geheimnisse der Religion ohnehin den Schein der Wahrheit gegen sich haben, also ihrerseits nicht wahrscheinlich gemacht oder gegen Wahrscheinlichkeit in Schutz genommen werden können: quand il s'agit d'opposer la raison à un article de nostre foy, on ne se met point en peine des objections qui n'aboutissent qu'à la vraisemblance: puisque tout le monde convient que les mysteres sont contre les apparences, et n'ont rien de vraisemblable, quand on ne les regarde que du côté de la raison (§ 28). Die Wahrheit kann den Schein der Wahrheit gegen sich haben, und sie kann selbst des Scheins entraten" –
...weil ja oft genug vergessen wird dass das "was wir sehen und hören, nie die untersuchten Phänomene selbst sind, sondern nur ihre Auswirkungen" (Fritjof Capra, Das Tao der Physik, Knaur 77324, München 1997, S. 49). Und Blumenberg, in Höhlenausgänge, a.a.O., S. 158/-9: "Zwar gibt es inzwischen eine Astronomie, die nicht mehr auf die phoronomische Berechnung langfristiger Gesetzmäβigkeit eingeschränkt ist. Als Himmelsmechanik und erst recht als Astrophysik vermag sie die Erscheinungen weitgehend zu erklären, sofern man in den Ausdruck 'Erklärung' Voraussetzungen eingehen lässt, die ihrerseits dem strikten Anspruch auf Erklärung entzogen sind", denn "das Unerklärte umschlieβt das Erklärte in unvorstellbarem Ausmaβ " (Sigmund Ginsberg). Auch eine "distinction du genre de celle que la découverte de Gödel nous oblige à faire entre la vérité et la démontrabilité formelle / Unterscheidung jener Art wie sie die Entdeckung Gödels uns zu machen zwingt zwischen Wahrheit und formaler Beweisbarkeit" (Jacques Bouveresse, Conférence du 17 juin 1998 à l'Université de Genève, in: Athena //un2sg4.unige.ch/athena/ bouveresse/bou_pens.html#Note5) ist hier zu berücksichtigen. [Nicht fehl am Platz ist wohl auch ein bekannter Ausspruch Einsteins: "Soweit die Gesetze der Mathematik sich auf die Realität beziehen, sind sie nicht gesichert; und soweit sie gesichert sind, beziehen sie sich nicht auf die Realität."]
Sowieso ist "(...) das Eigentliche dort zu suchen, wo die wissenschaftliche Interpretation nichts mehr findet, die alles, was ihr Gehege übersteigt, als unwissenschaftlich brandmarkt" (Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1987, S. 124). Man braucht also nicht so weit zu gehen wie Richard Feynman ("Science is the belief in the ignorance of the experts", www.real-science.com/) um mit Leibowitz zweifelnd den Kopf zu wiegen.
Bossuet's – übrigens gleichzeitig mit Leibnizens "Théodicée" angestellten – Betrachtungen zur Geschichte als Heilsgeschichte, so wie sie in Discours sur l'Histoire universelle (Garnier-Flammarion, Paris 1966) niedergelegt sind, bieten wohl die biblisch beschlagenste, historisch (immer noch) überzeugendste und literarisch beste Darstellung dessen, was nun zu behandeln ist.
Auβer Bossuet aber sind hier Leute wie Corbin, Grousset, Kalisky oder auch Arnaldez heranzuziehen die, weil "islamspezifischer" als Bossuet, uns jetzt die Munition für die am Anfang des Kapitels angekündigte "Fundamentalistenschelte" liefern werden. Denn da besagte Fundamentalisten im Nahen/Mittleren Osten "wirken" oder jedenfalls dort ihre Wurzeln haben, so kann es überhaupt nicht schaden, ihnen das genau dort stattgehabte Wirken jenes "Geistes" der auch im Islam als "heiliger" bekannt ist ("rûh"), doch einmal näher vor Augen zu führen:
Im Petersdom zu Rom wird der Hl. Geist zwar als Taube dargestellt, aber die Manifestierungen seines Wirkens sind oft alles andere als sanft. Es gibt denn auch in der Bibel einen Satz der ungefähr lautet "wen Gott liebt, den züchtigt er". Das gilt, sagt Bossuet, auch für Völker. Nur, die "Liebe" Gottes wird meist erst im Nachhinein ersichtlich und auch nur, wenn man die Geschichte als das sieht, was sie auch ist, nämlich "Heilsgeschichte". Es geht dabei um viel mehr als nur um "des einen Uhl, des andern Nachtigall".
Ganze Reiche wurden ja zu Groβmächten weil blutrünstige Herrscher und Schriftgelehrte eines Nachbarlandes mit vereinten Kräften irgendeiner Bevölkerungsgruppe dort das Leben sauer machten, allein weil sie "anders dachte". Hier in Flandern denkt man dabei vor allem an die vom Herzog Alba vertriebene flämische Intelligentsia die dann in Holland die "gouden eeuw" (das "goldene Jahrhundert" der nl. Weltmacht) heraufführte. Bekannt ist aber auch die Geschichte der 4.000 Toten in der "nuit de la St. Barthélémy" und der dadurch vertriebenen französischen Hugenotten, die maβgeblich am Aufbau Preuβens, also des "Erbfeindes", beteiligt waren.
"Hierauf stellte der Herzog von Guise seine Hauptleute zu beiden Seiten des Louvre auf, mit dem Befehl, keinen, der im Dienste des Prinzen von Bourbon stand, herauszulassen. Was Cosseins betrifft, so vermehrte und erneuerte man seine Mannschaft und gab ihm denselben Befehl (...) Charron benachrichtigte alle Hauptleute der Stadt, sie hätten sich um Mitternacht vor dem Rathaus einzufinden. Dort empfingen sie aus dem Munde Marcels - weil dieser beim König viel galt - den ihnen willkommenen, wenn auch seltsamen Befehl und vor allem das Verbot irgendjemanden zu verschonen; in allen Städten Frankreichs geschehe, was hier (...) Am Tor des Louvre und drinnen wurden getötet: Pardillan, Saint Martin, Beauvais und Pilles; wie dieser letzte seine Gefährten tot sah, rief er: 'Ist das der Friede, den der König mit seinem Treuewort uns zugesichert? Räche, o Gott, diese Treulosigkeit!' Mit diesen Worten zog er seinen Mantel aus und starb unter den Streichen der Halbarten. Der Vizegraf von Léran stand nach den ersten Streichen wieder auf und stürzte sich auf das Bett der Königin von Navarra; die Kammerfrauen retteten ihn... " (nach Théodore Agrippa d'Aubigné). Die letzten Worte des Herrn von Pilles "Räche, o Gott, diese Treulosigkeit!" nun also, die haben sich später auf eine furchtbare Art verwirklicht: besagte Bartholomäusnacht und, noch massiver, die spätere "révocation de l'édit de Nantes / Widerrufung des Toleranzedikts von Nantes", haben bekanntlich zwei Hugenotten-Auswanderungswellen verursacht, die einerseits der frz. Wirtschaft erheblichen Schaden zufügten weil diese Leute überdurchschnittlich geschult waren, und die andererseits in allererster Linie dem damals kaum erst flügge gewordenen Mini-Staat Preuβen zugute kamen. Nicht nur Theodor Fontane (selbst ein Nachfahre jener Hugenotten) hat die kaum zu überschätzende Rolle seiner Vorfahren im plötzlichen Groβmachtsstreben Preuβens hervorgehoben. Welches zu unterstützen auch in späterer Zeit noch der "liberale Kaiser" Napoléon III unternahm, getreu dem alten Adagium quos Jovis vult perdere, prius dementat (wen Jupiter verderben will, dem raubt er zuvor den Verstand), denn "Napoleon III, der ehemalige Umstürzler, Geheimbündler und Hochverräter, verband den verschwommenen, sentimentalen Liberalismus seiner Zeit mit der alten französischen Passion für la gloire. Um seine persönliche Stellung zu stärken, betrieb er einen Kreuzzug gegen die Verträge von 1815 und 1818, die Frankreich Sicherheit gewährt hatten, und beschleunigte Preuβens Aufstieg und Frankreichs Niedergang durch seine antiösterreichische Politik in Italien, die einen Rückfall in die unzeitgemäβe, längst diskreditierte Politik darstellte, der die französische Monarchie schon einmal mit dem Allianzwechsel von 1756 ein Ende gesetzt hatte" (Sir David Kelly, Die hungernde Herde, Piper, München 1959, S. 94).
Diesem Groβmachtsstreben und seinen weltpolitischen Folgen haben wir Europäer die beiden Weltkriege sowie, in deren Folge, allerdings auch ("objektiv-dialektisch") die EU zu verdanken.
Vergleichbares nun gab's auch im oftmals umkämpften türkisch-persischen Grenzgebiet, wo eine durch irgendeinen sunnitischen Osmanen-Selim gleichfalls befohlene "nuit" die Verschmelzung der verschiedenen damaligen Invasoren mit den iranischen Bewohnern erst möglich gemacht hat. Der Shi'ismus im Iran, das heiβt: die zukunftsträchtigere Version des Islam, ist denn auch so recht eigentlich das Produkt eines der fürchterlichsten religiösen Gemetzel aller Zeiten. Dies ist das erste wirklich gelungene und, wie es sich gehört, "objektiv-dialektische" Beispiel einer nicht auf ethnischer, sondern religiöser Basis errichteten Nation. Besagte "nuit", das waren allerdings auch nicht läppische 3- oder 4000 Tote, das waren schon mal locker 40.000. Nun, Schah Ismail oder Schah Tahmasp und wie sie alle hieβen, die haben jedenfalls ganze Arbeit geleistet. Das persische Groβreich der Séféviden ist denn auch beinahe ausschlieβlich den Qizilbaschs zu verdanken gewesen.
Auch einen gewissen Al-Tustarî gab's mal in Nahost, sowie seinen Schüler, den späteren Märtyrer Al-Hallâj. Als Soufis sind sie zwar eher "verdächtig", weil mystisch, aber man sollte nicht vergessen dass es der "mystische" Nicolaus Cusanus war, der das aristotelische Genauigkeitsideal gebrochen vii und damit, in schönster "objektiver Dialektik", die Entwicklung zur wissenschaftlichen Neuzeit überhaupt erst möglich gemacht hatte. Wobei diese allerdings ohne jenen mittelalterlichen Zwang von dem Nietzsche schreibt (hinter allen Phänomenen immer den Einen Gott sehen zu müssen), mit Sicherheit niemals stattgefunden hätte.
Besagten Zwang gab's also nicht nur bei uns. Dass nun Leute wie al-Hallâj blutig unterdrückt wurden, läβt aber zumindest vermuten, dass damit eine durchaus ernstzunehmende, der cusanischen in etwa ähnliche Entwicklungslinie abgeschnitten wurde (wie ja auch die der Mu'taziliten: fünf Jahrhunderte vor St. Thomas und zehn Jahrhunderte vor Kant hatten schon Leute wie 'Amr b. 'Ubayd und vor allem Wâsil b. 'Atâ die Erklärung und Interpretation des Koran durch traditionelle Vermittlung verworfen). Im übrigen leistete sich die islamische Welt gerade damals auch noch den Luxus, eine andere vielversprechende Entwicklung zu unterdrücken: Im Gegensatz zu den alten Griechen, bei denen verschiedene Grammatiker auch schon epische Griffelschlachten ausgefochten hatten, war nämlich im Islam der Streit zwischen der Schule von Koufa und jener von Basra von ungeheurer Wichtigkeit, da ja die Interpretation des Korans davon abhing.
Es war, wie wir wissen, die Schule von Koufa mit ihrer Ablehnung der uniformen Motivierungen und ihrem Hang zur Diversität (Rechtfertigung des Individuellen, der Ausnahme, des Unikats, kurz: dessen was einmal "Renaissance-Mensch" genannt werden sollte), die sich nicht durchgesetzt hat.
Hier das – unübersetzte weil oben ja ausreichend zusammengefasste – Originalzitat aus "Histoire de la philosophie islamique I", Henri Corbin (idées nrf, Paris 1964) S. 203/4:
"Pour l'école de Koufa, la tradition, avec toute sa richesse et sa diversité foisonnante, vaut comme la première et la principale source de la grammaire. L'école admet aussi la loi d'analogie. C'est pourquoi l'on a pu dire que, comparé au système rigoureux de l'école de Basra, celui des grammairiens de Koufa n'en était pas un. C'est plutôt une somme de décisions particulières, prononcées devant chaque cas, parce que chaque cas devient un cas d'espèce. Il y a simultanément l'horreur des lois générales, des motivations uniformes, et le goût de la diversité justifiant l'individuel, l'exceptionnel, la forme unique.
Gotthold Weil (...) proposait de comparer l'opposition entre les écoles de Basra et de Koufa avec l'opposition entre l'école d'Alexandrie et celle de Pergame, la lutte entre les 'analogistes' et les 'anomalistes'. La mise en parallèle ne vise, il est vrai, que les attitudes d'esprit, car le matériel linguistique diffère foncièrement de part et d'autre. En outre, la lutte entre les grammairiens grecs était une affaire se passant entre savants.
En Islam, l'enjeu de la lutte était grave; non seulement elle affectait les décisions du droit, de la science canonique, mais en pouvait dépendre l'interprétation d'un passage du Qorân, d'une tradition religieuse. On vient de marquer le lien entre l'esprit de l'école de Koufa et un certain type de science shî'ite; soulignons encore, comme nous l'avons déjà fait, l'affinité avec un type de science stoïcienne comme 'herméneutique de l'individuel'.
Que l'esprit de l'école de Basra ait finalement prévalu, c'est le symptôme de quelque chose qui dépasse de beaucoup le simple domaine de la philosophie du langage."
Noch fataler aber war das seit jeher und auch heute noch absolut (auβer im soeben "zukunftsträchtiger" genannten Shi'ismus...) gültige islamische Bilderverbot viii.
Wenn man Ernst Peter Fischers in "Eurèka!" (Schuyt & Co Uitgevers b.v., Haarlem 2002; hier aus dem NL rückübersetzt ins Deutsche) gemachte Randbemerkung zu Einstein liest, dann hat man auch sofort begriffen warum: "In diesem Zusammenhang ist der Schlüsselbegriff das Wort 'Bild', und zwar nicht als 'picture' aufzufassen wie in der Photographie, sondern als 'image' wie in der Malerei. Unser Denken endet mit Bildern und beginnt mit dem Betrachten von Malereien, wie die Psychologie weiβ. Anhand des Beispiels ‚Einstein' kann man das verdeutlichen. Einstein hat einmal in einem Gespräch mit einem Psychologen erzählt, dass sein wissenschaftliches Denken beginnt mit Bildern, die in ihm andere Bilder hervorrufen und einen Strom entstehen lassen den er dann mühsam umsetzen müsse in Worte und Formeln, um sie überhaupt mitteilen zu können. (...) Der Beitrag von Bildern am Entstehen des Wissens ist schon bei Einsteins berühmtem Vorgänger Kepler zu finden (…). Was Kepler sagt, können wir auch anders formulieren, nämlich dass wir erst dann etwas über die Welt wissen wenn wir sie uns durch Bilder (also immer im Sinne von 'Malereien') zu eigen gemacht haben".
Dieser islamische allgemeine Bildermangel hat denn auch sehr weitreichende Folgen. Wie Blumenberg schreibt: "Nicht nur die Sprache denkt uns vor und steht uns bei unserer Weltsicht gleichsam im Rücken; noch zwingender sind wir durch Bildervorrat und Bilderwahl bestimmt, 'kanalisiert' in dem, was überhaupt sich uns zu zeigen vermag und was wir in Erfahrung bringen können."
Wie man sieht geht's hier um ganz andere Dinge als um die – vorsichtig ausgedrückt: blöde – Frage ob wir Katholiken "Maria und die Heiligen(bilder) anbeten" – tun wir nicht; oder ob wir sie nur bitten, für uns beim Allmächtigen Fürbitte einzulegen – tun wir.
Und zwar aus einem von Ernst Wiechert sehr schön formulierten Grund: "Sehen Sie, manchmal in diesen Jahren habe ich gezweifelt, an Gott, ja, das habe ich getan. Aber an den Heiligen nicht. Von Kind auf war ich bei ihnen, das ist in unserem Glauben so, näher bei ihnen mitunter als bei Gott. Er ist so weit, so schrecklich weit. Aber sie sind nahe, an unserer Seite, denn sie haben auch gelitten, ebenso wie wir, mehr noch." (Das einfache Leben, Ullstein Ffm/Berlin 1995, S. 51)
Noch schöner ist's – irgendwie selbstverständlich, ja gewiβ doch – mit Maria. Leider kann hier nur sehr kurz angedeutet werden welchen Dank sämtliche Machos, jedesmal wenn sie von "Liebe" faseln, der Gottesmutter schulden: Mit einem dezenten Hinweis auf Denis de Rougemont, der in "L'amour et l'Occident" (éditions Plon, Paris 1939) herausgearbeitet hat dass das, was wir heute "Liebe" nennen, so recht eigentlich erst eine mittelalterliche Schöpfung ist – und zwar in erster Instanz und unter arabischem bezw. andalusischem Einfluβ, eine Schöpfung der Troubadours. Deren "höfische" Minne wäre jedoch ohne die damals – in zweiter Instanz – gerade "epidemisch" werdende Maria-Verehrung nur episodisch geblieben. Besagte Madonna-Verehrung ist es also die, laut de Rougemont, erst unseren Kulturkreis für die "romantische" Liebe überhaupt aufnahmefähig gemacht hat.
Mit anderen Worten: als Tamerlan kam, konnte er auβer Hunderttausenden von Menschenleben schon nichts wirklich Wichtiges mehr zerstören. Denn auch eine vierte mögliche Entwicklungslinie war ja schon nicht so konsequent wie bei uns weiterverfolgt worden; es ging da hauptsächlich um logische Probleme betreffs "Gottes Allmacht", die aber in Ermangelung jeglicher "Erbsünde"- und "Inkarnations ix "-Problematik leider nicht so auf die Spitze getrieben wurden wie bei uns [ganz kurz: Tempier's Edikt von 1277 ("Quod prima causa posset producere effectum sibi aequalem nisi temperaret potentiam suam", Chartularium Universitatis Parisiensis, n. 26), der Occamismus, die "platonische Reaktion" ab Petrarca d.h. florentinische Renaissance undsoweiter]; all dies natürlich immer in der bekannten Böhmeschen "objektiven Dialektik" die auch vor Scheiterhaufen nicht zurückschreckte, wie wir alle wissen. Es soll denn auch keine wie immer geartete Verniedlichung der damaligen Gewissenszwänge mit all ihren Folgeerscheinungen versucht bezw. toleriert werden, sondern hier geht es um "Gesetzmäβigkeiten", soweit sie eben halbwegs erkennbar sind. [Diese Gesetzmäβigkeiten sind es denn auch die einzig und allein den Anspruch einer bestimmten Kultur x stützen könn(t)en, wo nicht "hochwertiger" zu sein dann doch "geschichtlich relevanter" als eine andere (oder: alle anderen) xi].
Man sieht, dass diese Probleme an denen unser Mittelalter schlieβlich zerbrochen, aber schöpferisch zerbrochen ist, zwar ansatzweise im Islam gleichfalls gestellt, jedoch aus "dogmatischen" internen Gründen so oder so nicht bis zum bitteren d.h. "objektiv-dialektisch äuβerst vorteilhaften" Ende ausgefochten werden konnten. Was die letztlich wohl einzig mögliche Erklärung dafür ist, dass trotz besserer Startposition der Islam schlieβlich nicht "der" Entwicklungsträger werden konnte. Die 40.000 Toten unter Selim oder die Millionen unter Tamerlan mögen da nur noch unter "grausige Zugabe" firmieren. Wir modernen Europäer haben jedoch nicht den geringsten Grund, angesichts dieser Zahlen "Barbarei!" zu schreien, mussten doch (immer "schön objektiv-dialektisch") erst einmal nicht 4- oder 40.000, sondern, in zwei Weltkriegen, weit über 70 Millionen Menschen geschlachtet werden bevor unsere heutige Europäische Union überhaupt "denkbar" werden konntexii.
Perfekte, wenn auch grausige Illustrationen des am Anfang dieses Kapitels stehenden Dreh-und-Angelpunkts: "der Geist (...) steht von diesem Ursprung her und durch ihn zur Rationalität der Selbsterhaltung verquer – auβer zu der seiner eigenen."
Summa summarum: das was in der katholischen Kirche als die schwerste – wenn nicht im Grunde genommen einzige – Sünde gilt, die "Sünde wider den Geist" (Matth. 12, 31-32: "31 Deshalb sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden; aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. 32 Und wer irgend ein Wort reden wird wider den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden; wer aber irgend wider den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen"), das wird immer, unvermeidlich und rigoros ausgebrannt und in Blutströmen ertränkt.
"Der reine Geist führt immer zur Mitleidlosigkeit, ja zur Erbarmungslosigkeit" (Wiechert, Jahre und Zeiten, Ullstein, Frankfurt/M 1989, S. 309).
"Nutznieβer aller Scheuβlichkeiten, die in der Geschichte vorgefallen sind, sind wir Lebenden allemal allein dadurch, dass wir die Nachkommen der Überlebenden sind, die wohl die Stärkeren, wohl die Rücksichtsloseren, wohl die 'Schuldigen' gewesen sind und ihre Nachkommen zu Nutznieβern ihrer Daseinskraft machten. In der Seinsgrundfrage ist Schuld impliziert, wenn man das jeweilige Endglied einer 'Evolution' ist. Die 'Weltordnung' gönnt uns nicht, uns als Abkömmlinge der Schuldlosen begünstigt zu wissen. Wer überhaupt da ist, verdankt das denen, die noch dageblieben waren, als es die anderen nicht schafften." (Blumenberg, "Wie wird Schuld zum Mythos?", in Ein mögliches Selbstverständnis, a.a.O., S. 76).
In der Seinsgrundfrage ist Schuld impliziert: et voilà "die Erbsünde".
"So wahr ist es, dass sowohl im Islam als auch in der Christenheit die geistigen Kräfte es sind, die das Spiel der Geschichte lenken", schreibt René Grousset. Und schlieβt sich damit – genau: mit dem Wort "mènent"/"lenken", das gerade bei einem Grousset genauso wenig zufällig ist wie bei Burckhardt das "wollen" – der "Husserlschen Intentionalität" an. Bei Sorokin oder Toynbee, auf den später noch zurückzukommen sein wird, liest es sich ungefähr genauso; alle Drei jedoch haben sie die allerdings erst durch die heutigen Massenmedien so richtig "explodierte" Rolle der modernen demokratischen Politik d.h. der Tagespolitik xiii übersehen oder jedenfalls nicht richtig eingeschätzt. Tatsächlich war ja aber auch zu ihrer Zeit, um nur ein Beispiel zu nennen, das beliebteste Instrument der "demokratischen" Meinungsmanipulation, vulgo "Meinungsumfrage", beileibe noch nicht das was es heute ist [cf. American Thinker December 24, 2011: "Wie Meinungsumfragen die Quelle der Citoyenneté vergiften"]. Nun ja, " 'implodierte' Rolle" xiv wäre eben vielleicht korrekter ausgedrückt gewesen.
Jetzt also sollen erst einmal, wie versprochen, die islamischen Fundamentalisten zur Behandlung gebeten werden. Nachdem sie den Sinn der weiter oben gemachten Bemerkung ["kann es überhaupt nicht schaden, ihnen das genau dort stattgehabte Wirken jenes 'Geistes' (...) einmal vor Augen zu führen"] in seiner ganzen Tragweite genieβen durften, werden sie das nun Folgende umso gebührender zu schätzen wissen. Ganz ohne Zweifel.
Wohin uns eine Notiz aus den Klarstellungen (Herder, Freiburg i.Br. 1971, S. 168) des Hans Urs von Balthasar führen wird:
"So kann Paulus von 'dem' Mysterium sprechen – dem Mysterium der Liebe Gottes zur Welt im Kreuz Jesu Christi – , das von Äonen her verborgen geblieben war und nunmehr durch die Kirche, durch Paulus den 'Menschenkindern' offenbar wird (Eph. 3, 1 f; Kol. 1, 26; Rö. 16, 25f).
"Nunmehr":
"Die Kontingenz der Daten und Fristen hat mit der 'Folgerichtigkeit' des Zueinander und Nacheinander wenig zu tun.
Es gibt ein 'Muster' für alle Datenkontingenz von menschlichen 'Hauptwerken', das man ohne Säkularisierungsverdacht heranziehen darf, um sich von der Gleichgültigkeit des 'Erscheinens' – hier im hinterhältigen Doppelsinn der Epiphanie – zu überzeugen: der 'Menschensohn' und die von ihm Nachricht gebenden kanonischen Texte. Gemessen an dem Anspruch, den das Doppelereignis von Leben und Schrift für sich ausgebildet hat, und auf die biblische Chronologie bezogen, an der die Jahrhunderte gefeilt haben, handelt es sich um einen Fall von ebenso unverzeihlicher wie unvermeidlicher Verspätung. Durfte der johanneische Logos viertausend Jahre nach Sündenfall und Paradiesesaustreibung verstreichen lassen, ehe er sich im Fleische erblicken und die zur Wiedererlangung des Heils notwendigen Worte vernehmen sowie Erleidungen geschehen liess? Im kleineren Metrum liess er nach der Stallgeburt zu Bethlehem nochmals dreissig Jahre hingehen, ehe er mit Worten und Taten begann, was doch um der Menschen willen nicht früh genug begonnen und beendigt werden konnte. Es war eilig, denn mit der Welt stand es auf der Kippe, mit dem Widersacher auf Biegen und Brechen.
Mit diesem Einwand der Verspätung des göttlichen Eingreifens in die unselige Geschichte der Menschheit hatten sich nach dem Erkalten der ersten hochgespannten Heilserwartungen die Apologeten des Christentums herumzuschlagen. Sie waren erkennbar überfordert. Auf das 'Warum so spät?' hätte es im Sinne des principium rationis insufficientis für Raum und Zeit nur die eine alles erledigende Antwort gegeben: 'Gleichgültig, wann!' Diese Antwort aber wäre theologisch unzulässig gewesen. Dennoch läuft der dogmatische Kunstgriff, mit dem das Problem zwar nicht gelöst, wohl aber entschärft wurde, auf die unausgesprochene Indifferenz jedes Zeitdatums gegenüber allen anderen hinaus: der Artikel vom 'Abstieg zur Hölle', ungenau übersetzt von 'descensus ad infernos'. Der Hadesabstieg des Gottesknechtes zwischen Kreuzestod und Auferstehung füllt nicht nur die trostlose Karenzzeit aus, sondern zieht die sonst vom Heilswerk der Passion Übergangenen, weil 'zu früh Geborenen', in den Triumph der Todesüberwindung." (Blumenberg, "Gleichgültig, wann? Über Zeitindifferenz", in: Lebensthemen, a.a.O. , S. 19-21)
Hier ist ein wahrhaftes 'An-sich', das in der Kirche und durch sie zu einem 'Für-alle' werden soll; die Kirche gehört, als Raum der Erleuchtung und des Jawortes, zu diesem 'An-sich' hinzu, wird aber gleichzeitig in Bewegung gesetzt auf dieses 'Für-alle' hin: sie ist, was sie ist, indem sie sich transzendiert."
So weit, so gut. Kann jeder von seiner Religion behaupten.
"Aber weil sie nicht selbst Prinzip ihrer Transzendenz ist, sondern vom Prinzip allererst gebildet und angefordert wird, um dann im Gehorsam ausgesandt zu werden, ist der Wirkungskreis ihrer Transzendenz (oder ihrer Mission) nicht identisch mit dem Kreis, worin das Prinzip selber sich auswirkt. Letztlich bestimmt, in seinem unergründlichen Gericht, das Haupt der Kirche, wer auf Erden, in und auβerhalb der sichtbaren Kirche, dem Anspruch der göttlichen Liebe geantwortet und entsprochen hat."