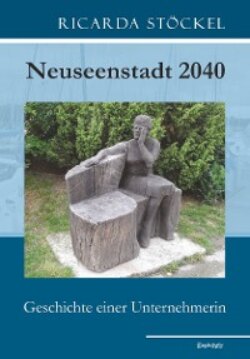Читать книгу Neuseenstadt 2040 - Ricarda Stöckel - Страница 10
3. KAPITEL – DONNERSTAG, 28. JUNI 2040
ОглавлениеPünktlich zehn Uhr hört Jutta die Wohnungsklingel, ein angenehmes Brummen. Sie sieht auf ihrem Bildschirm, dass Sandra vor der Tür steht, die Haarschleife und Bluse in leuchtenden Orangetönen. Bei dem plötzlichen Abschied gestern hatte sie vergessen ihr mitzuteilen, dass der Donnerstagvormittag ihrer Yogagruppe gehört. Diesen Ausgleich hat sie bitter nötig nach der Aufregung gestern. Die Ärztin hat ihr vor einer halben Stunde bei der kurzen Bildschirmkonsultation geraten, die Gespräche mit der Reporterin abzubrechen oder nur auf das Dienstliche zu beschränken. Der Blutdruck ist beängstigend gestiegen und auch in der vergangenen Nacht hat Jutta schlecht geschlafen. Ihre Bachblütenmischung ist aufgebraucht. Weil ihr Leben seit längerer Zeit meistens im Gleichgewicht war, hatte sie sich keine neue Mixtur bestellt.
Soll sie der jungen Frau wirklich wie versprochen die ganze Geschichte über ihren Job und Ina erzählen? Wenn sie das tut, kann sie Roland nicht verschweigen. Bisher hat sie für sich behalten, wie sehr sie an diesen Mann denkt, den sie nach so vielen Jahren noch vermisst. Manchmal malt sie sich aus, wie sie ein gemeinsames harmonisches Alter erleben könnten, wenn damals nicht alles schief gelaufen wäre. Aber wäre sie dann überhaupt hier, hätte sie Enrico kennengelernt und die Idee für ihre Firma verwirklichen können? Was wäre, wenn damals die Weichen in eine andere Richtung gestellt worden wären? Sie weiß, dieses endlose Grübeln bekommt ihr nicht, aber manchmal kann sie sich nicht gegen die intensiven Erinnerungen wehren.
Sie möchte sich auf ihren Geburtstag freuen, über ihre Freunde und Kollegen, ihre erfreuliche Gegenwart, in ihrem Alter ein nicht selbstverständliches und täglich kostbarer werdendes Geschenk. Doch gestern wurde sie unerwartet von der Vergangenheit eingeholt. Das hat sie so heftig getroffen, dass sie sogar den wöchentlichen Spielabend mit ihren Rommé-Freundinnen abgesagt hat.
Sie betätigt am Display den Türöffner und Augenblicke später steht Sandra in der Tür. Neugierig lässt sie ihre Blicke schweifen, vom Massagesessel über die Couch mit dem schlichten, alten Couchtisch bis zu einem großen alten Schrank, in dem sich hinter einer Glasscheibe in vier Fächern Bücher drängen.
»Schön haben Sie sich hier eingerichtet. Auf mich wirkt alles ein wenig altmodisch, aber anheimelnd. So ein Schrank voller Bücher ist toll. Ich habe nur wenige, die ich mal geschenkt bekam. Ich lese nur noch elektronische Bücher, wenn ich überhaupt dazu komme.«
»Vergessen Sie nicht, ich bin alt und darf altmodisch sein«, entgegnet Jutta und erklärt, als sich Sandra schon ihrer Couch nähert: »Nein, wir bleiben bei dem schönen Wetter nicht hier im Zimmer. Ich zeige Ihnen die Fotos nicht am Bildschirm, sondern auf dem Balkon.« Jetzt wirkt die ganze dünne Frau wie ein einziges gekrümmtes Fragezeichen, denkt Jutta und amüsiert sich über Sandras Verwunderung. »Waaas, Sie haben noch echte Fotoalben und Papierbilder? Dokumente auf richtigem Papier! Das sind ja unschätzbar wertvolle Antiquitäten, die kaum noch jemand besitzt. Mein Opa hatte alles weggeworfen, bevor er umzog. Wochenlang hatte er seine Fotos eingescannt, und dann war seine Festplatte kaputt, als er mir Bilder von früher zeigen wollte.« Unbekümmert plaudert Sandra weiter: »Stur, wie alte Leute so sind, hat er keine Sicherheitskopien auf einer Cloud angelegt. Nein, das Internet war ihm zu unsicher für seine privaten Dokumente. Da konnte ich reden wie ein Buch, er hat mir nicht geglaubt, dass wir das alle so machen und die Daten auf diesen Wolken sicher sind. Das hoffe ich wenigstens. Durch die Datenskandale der letzten Jahre bin ich auch manchmal ins Zweifeln gekommen, aber eine andere Lösung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.«
Jutta muss lachen und fühlt, wie sie sich entspannt. Das Zusammensein mit der Jüngeren tut ihr gut. Sie wird nicht auf die Ärztin hören, sondern weiter aus ihrem Leben erzählen. Vielleicht ist das die beste Therapie für mich und hilft, die vergangenen Schatten noch vor meinem Jubiläum zu begraben, fährt ihr durch den Kopf.
»Ich sehe das genauso wie Ihr Großvater. Auch ich speichere so wenig persönliche Daten wie möglich im Netz, aber ich vertraue auch nicht auf die ewige Haltbarkeit von elektronischen Datenträgern. Deshalb habe ich immer meine Papierfotos aufgehoben und gehütet wie einen Schatz. Auch Briefe auf altem Briefpapier und meine guten alten gedruckten Bücher habe ich bewahrt, jedenfalls die für mich wichtigen. Jahrhunderte alte Bücher blieben in den Bibliotheken der Welt erhalten und wurden in den letzten Jahrzehnten durch moderne Verfahren für die Zukunft konserviert. Kein Mensch kontrolliert, welches Buch ich wann lese, wenn ich es nicht auf elektronischem Weg kaufe. Bei den E-Books hatte das schon vor zwanzig Jahren erschreckende Ausmaße angenommen. Es reicht mir schon, in medizinischer Hinsicht und von meinen Einkaufs- und Essensgewohnheiten her inzwischen ein transparenter Mensch zu sein. Ich lebe damit, ohne ständig darüber nachzudenken, denn vieles nützt mir und meiner Gesundheit. Und natürlich, meine gesamte Service-Firma existiert nur dank solcher Computersysteme und Softwareentwicklungen auf der Grundlage einer Menge gespeicherter personenbezogener Daten. Also behalte ich wenigstens meine privaten Erinnerungen auf Papier.«
»Aber wenn es mal brennt, ist alles weg«, wirft Sandra ein. »Das stimmt. Aber erstens verlasse ich mich auf das moderne automatische Brandschutz- und Brandbekämpfungssystem, das wir in allen Wohnungen installiert haben. Und wer sagt denn, dass ich nicht zusätzlich die wichtigsten Dokumente digitalisiert habe? Ich habe eine Firma mit modernster Technik, da verlasse ich mich nicht allein auf die Nostalgie – aber auch nicht ausschließlich auf die Elektronik.
Wir sind in unserer Wohnanlage auf einem guten technischen Stand – auf dem neuesten kann man nie sagen bei der rasanten Entwicklung. In unserem Multimediasystem kann man selbstverständlich private Daten speichern. Hierher werden alle vom Nutzer ausgewählten Daten von sämtlichen mobilen Geräten gesendet.«
»Und was passiert, wenn jemand auszieht oder plötzlich krank wird und stirbt? Kommt noch jemand an die Daten heran?«
»Datenschutz ist ein Problem, seit es Computer und Internet gibt. Mit dem elektronischen Fingerabdruck und der Gesichtserkennung kann normalerweise nur der Besitzer seine Daten nutzen, während die öffentlichen und Netzwerkfunktionen für jeden zugänglich sind. Zusätzlich gibt es bei uns den im Finger implantierten Chip, auf dem alle in unserem System laufenden Arbeitsstunden- und Kontenbewegungen sowie die Gesundheitsdaten gespeichert sind. Dieser Chip wird nach der gesetzlichen Erbfolge vererbt, wenn jemand stirbt. Beim Auszug werden die Informationen auf dem Chip bereinigt, je nachdem, ob es eine andere Wohnung innerhalb unseres Systems ist oder ob sie woanders liegt. Die privaten Ordner werden bei der Wohnungsübergabe auf einem Speicherchip mitgegeben und dann im System gelöscht.«
»Das ist ja interessant. Doch meistens gibt es für Fachleute Möglichkeiten, an gelöschte Daten heran zu kommen.«
»Liebe Sandra, hundertprozentige Sicherheit hat es nie gegeben und gibt es nicht, so modern unsere Systeme sein mögen. Um auf die Fotos zurückzukommen: Nachdem in unserer Nachbarschaft vor vielen Jahren ein Laptop gestohlen wurde, auf dem sämtliche Geschäftsdaten und Privatfotos einer jungen Frau enthalten waren und sie keine Sicherheitskopie davon hatte, bin ich doppelt vorsichtig geworden.
Ein guter Freund bewahrt für mich einen Datenträger auf, für den Fall der Fälle und vielleicht auch für meine Erben. Der wird aller paar Jahre erneuert, damit alles mit der jeweils aktuellen Technik les- und sichtbar ist. Aber noch besitze ich die einfachen Fotoalben. Die können wir uns jetzt ansehen ohne auf ein elektronisches Medium zu starren.«
Mit einem »Pling« schaltet sich das Display von Juttas Telefon ein und schiebt eine Digitalfolie im A4-Format aus dem Gerät. Es erscheint eine Anzeige des Musikvereins der Wohnanlage: »Erinnerung. Heute Abend 19 Uhr im Festsaal des Restaurants »Notenschlüssel«: Nostalgie-Konzert mit echten Instrumenten und alter klassischer Musik. Orgel, Violine, Saxofon, Trompete, Flöte und Cello. Plätze für die Tische mit Abendessen und Getränken bitte bis 16 Uhr bestellen, ebenso für die Relax-Sessel ohne Abendessen, aber mit Getränk. Eintritt 30 Euro oder Service-Moneys. Wie immer steht die Videoübertragung in der Mediathek ab 22 Uhr kostenlos zur Verfügung.«
»Super, das gibt’s doch gar nicht. Konzerte mit richtigen Instrumenten, live. Und sogar Orgel dabei«, ruft Sandra aus. »Darf ich mitkommen?«
Irgendwie ist sie doch wie eine Klette, denkt Jutta, wenigstens abends möchte ich eigentlich abschalten. »Wieso interessiert Sie eigentlich die Orgel so?«, fragt sie.
»Ich habe angefangen, Orgelbauerin als Beruf zu lernen. So wie Sie damals Schriftsetzer als alten Handwerksberuf. Aber bei mir ist alles schief gegangen. Meine Eltern besitzen heute noch eine der wenigen traditionellen Orgelwerkstätten, meistens reparieren und reinigen sie alte Instrumente, denn eine richtig neue Orgel leistet sich heute kaum noch jemand. Es gibt ganz wenig Vereine, die solche Traditionen noch pflegen. Auch in den meisten Kirchen stehen heute digitale Orgeln, die alten Orgelpfeifen dienen manchmal noch als Attrappe, doch meistens sind sie herausgerissen und eingeschmolzen worden, wenn sich dahinter Schmutz und Schimmel breit gemacht hatten. Es wurde immer schwieriger, das Geld für die Sanierung der Instrumente aufzutreiben. Oft wurde die Kirche als Institution mit ihren zahlreichen geldfressenden Kirchenbauten totgesagt, aber sie existiert immer noch, und die Orgelmusik auch.«
Nun staunt Jutta über das Wissen der jungen Frau. »Es ist kein Wunder, dass Sie sich zu unserem Chef hingezogen fühlen, er hat sich sein Leben lang in Orgelvereinen betätigt. Sich um die Erhaltung der Orgelmusik und dieses besonderen Instruments zu kümmern, ist neben der Architektur sein zweites großes Hobby. Aber warum haben Sie den Beruf nicht zu Ende gelernt?«
»Das ist eine komplizierte Geschichte. Zeigen Sie mir doch erst einmal Fotos!«, wehrt Sandra ab.
Die Folie hat sich wieder zusammengerollt und ist im Telefon verschwunden.
Jutta schlägt ein Fotoalbum von 1971 auf. »Hier waren wir bei der Einweihung des »Nischls« am neunten Oktober 1971.«
»Waas?«
Jutta muss lachen: »Das sächsische Wort war unser Spitzname für den Bronze-Kopf von Karl-Marx. Er war ein Philosoph und Gesellschaftstheoretiker, der im neunzehnten Jahrhundert lebte. Die Theorien von ihm und seinem Weggefährten Friedrich Engels bildeten die Basis für den Aufbau des Sozialismus in der 1949 gegründeten DDR. 1953 waren die Stadt und der Bezirk Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umbenannt worden. Und dieser Karl-Marx-Kopf war noch viele Jahre das Wahrzeichen der Stadt und zog Touristen an. Vor einigen Jahren hat die Stadt ihren berühmten, aber wieder sanierungsbedürftigen Marx trotz Protest der Bürger an einen verrückten Kunstsammler verkauft – nun steht Marx in seiner Geburtsstadt Trier.
Doch ich wollte ja von mir erzählen. 1971 war ein besonderes Jahr. Hier, die junge Frau mit dem Kinderwagen, das bin ich. Daneben der Mann mit dem Vollbart ist mein Mann Olaf, drei Jahre älter als ich.«
Da signalisiert das Display die nächste Störung: Johannes Müller erscheint auf dem Bild und, da Juttas Telefonkamera nicht ausgeschaltet ist, entdeckt er die Besucherin. Sofort setzt er sein typisches Grinsen auf und streicht sich durch die verwuschelten Locken, als könnte er damit die Frisur bändigen. »Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du heute auch Besuch hast. Kannst du die Reporterin in unser Büro mitbringen? Wir brauchen dich. Wir müssen die Reisen mit Betreuung an die Ostsee und in die Alpen für den September vorbereiten und wir haben Anfragen für unsere Ferienwohnungen mit Betreuung im System. Wir haben auf die Schnelle drei Ferienwohnungen für die neuen Bewohner genutzt, die fehlen jetzt. Unser Team Koordination hat schon die Vorarbeiten geleistet, die Entscheidungen möchte ich aber mit dir zusammen treffen.«
»Ach Johannes. Wenn ich ganz aufhöre, musst du alles ohne mich lösen. Es gibt noch mehr fähige Leute in unserem Büro.«
»Ja gut, aber noch bist du die Chefin, und da möchte ich so etwas nicht ohne dich entscheiden.«
Jutta möchte nicht zeigen, wie sehr sie sich freut, in ihrem Büro von den überwiegend jungen Leuten geachtet und angenommen zu werden. »Nun gut, dann opfere ich meine Mittagsruhe und komme gegen vierzehn Uhr für eine Stunde. Eigentlich habe ich heute keinen Bürotag, ich muss gleich zum Medizinzentrum.«
Sie seufzt und hält sich für ein paar Augenblicke die Hände vor die Augen. »Ich glaube, so richtig zum Erzählen kommen wir heute nicht mehr. Kommen Sie mit zu unserem Medizinzentrum, machen Sie die Yogastunde mit oder schauen Sie sich inzwischen um.«
Sandra blättert in einem Fotoalbum aus Juttas Kindheit und entdeckt zwei kleine Mädchen auf einer Teppichstange sitzend, neben mehreren verbeulten Blechaschenkübeln im gepflasterten Hof. »Das war wohl ihre beste Freundin, die in den Westen gegangen ist?«
Doch Jutta ist im Bad verschwunden, sucht auf dem Display, das gleichzeitig ein Spiegel ist, nach ihrer letzten Bachblütenrezeptur, gibt ihr momentanes Befinden und das gestrige Schockerlebnis mit der neuen Bewohnerin ein und Augenblicke später erscheint die Rezeptur. Jutta klickt auf »bestellen« und hofft, dass sie die Mischung nach ihrer Yogastunde gleich mitnehmen kann.
Sie bedauert, heute keine ideale Gesprächspartnerin zu sein. Durch die angelehnte Badtür hat sie Sandras Frage gut verstanden. Soll ich ihr wirklich von Ina erzählen? überlegt sie wieder. Es muss wohl sein, sonst kann kein Mensch verstehen, warum ich damals so am Boden zerstört war. »Ihr Telefon!“, ruft Sandra vom Balkon.
»Jutta, heute kommst du nach dem Konzert mit zu uns – ohne Widerrede. Ich glaube, wir müssen reden!« verkündet Enrico Sommer vom Display. Er ist wirklich ein Freund, er merkt, wie verstört ich bin, denkt Jutta.
Sandra begleitet Jutta zu Fuß zum wenige hundert Meter entfernten Gesundheitszentrum. Am Eingang betreten sie nacheinander den Virenscanner, der beiden Frauen Sekunden später freien Eintritt in das Gebäude signalisiert. »Das ist für mich eine Errungenschaft, die ich sehr schätze«, bemerkt die Ältere.
»Ich weiß nicht, ist das nicht übertrieben, solche Dinger in allen öffentlichen Gebäuden zu betreiben, wo wir kaum noch Infektionskrankheiten kennen?«
»Wir glaubten vor vielen Jahren schon einmal, dass die schlimmsten Krankheiten ausgerottet seien. Doch in den Jahren nach der Jahrtausendwende sind die Infektionen vor allem mit neuen und resistenten Erregern stark angestiegen. Besonders in Krankenhäusern gab es zahlreiche Komplikationen und Todesfälle. Das ging einher mit unverantwortlichem Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung, der Vernachlässigung von Hygienevorschriften durch Personaleinsparungen und Überforderung sowie mit der Mobilität der Menschen über den ganzen Globus.
Dieser Zustand besserte sich erst ab 2025 durch den Aufbau eines starken Gesundheitsministeriums mit weitreichenden Befugnissen und Kontrollfunktionen. Seitdem haben wir endlich die einheitliche Bürgerversicherung, die manche Politiker schon zur Wahl 2013 einführen wollten. Ich kenne niemanden, der sich ein unüberschaubares Netz von Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen und die teilweise eigene Finanzierung von Medikamenten und Gesundheitsleistungen zurückwünscht. Damals wurden die Pharmaprodukte gründlich auf den Prüfstand gestellt und neue Impf- und Hygienekonzepte entwickelt. Seit zehn Jahren werden die Virenscanner flächendeckend eingesetzt. Die Herstellerfirma in der Lausitz gehört zu den führenden Unternehmen und exportiert die Geräte weltweit. Neue Erkenntnisse über Krankheiten, ihre Erreger und Ausbreitung werden bei der jährlichen Aktualisierung der Software berücksichtigt. Nein, Sandra, es ist nicht übertrieben, diese Sicherheitsmaßnahmen weiterhin konsequent durchzusetzen.«
»Wenn Sie das so sagen, ist das sicherlich doch nicht unnütz. Wir Studenten haben darüber gespottet, dass unsere Gedanken gescannt und irgendwo gespeichert werden, wir haben Faxen gemacht und die Zunge raus gesteckt, wenn wir vor der Uni durch die Geräte gehen mussten.«
Jutta lacht. »Das ist das Vorrecht der Jugend, manchmal respektlos und albern zu sein. Das wird sich in jeder Generation wiederholen.«
Sie bittet die junge Frau an der Rezeption, dass ein Mitarbeiter Sandra das Gesundheitszentrum zeigen möge, und verschwindet im Turnraum, wo bereits zehn Frauen und zwei Männer auf den Matten sitzen. Sie absolviert ihre Yogastunde, redet mit der Ärztin, holt sich ihre Medikamente ab – und dann will sie etwas Richtiges essen. Verwundert bemerkt sie, dass ihr Appetit verschwunden ist. Doch ausgerechnet jetzt sagt Sandra: »Ich bin beeindruckt von dem Gesundheitszentrum. Hier möchte ich bei Gelegenheit die Salzgrotte ausprobieren. Nun müssen Sie mir erklären, wie das Leben in Ihrem Wohngebiet funktioniert und was Ihre Firma leistet. Heute gehe ich mit Ihnen essen, ich habe Hunger. Sie haben ja erzählt, dass in dem Restaurant frisch gekocht wird.«
»Nicht nur das, die meisten Lebensmittel, selbst die exotisch erscheinenden, werden in unserer Region erzeugt.«
Im nebenliegenden Restaurant erscheinen die Speisen als ansprechende Fotos auf dem Bildschirm, der sich auf Knopfdruck vor jedem Platz auf dem Tisch öffnet. Sandra wählt nach kurzem Überlegen Leipziger Algenbratlinge mit Pilzragout aus. Jutta entscheidet sich für das Filet aus schadstofffreiem Zuchtfisch mit Püree aus einer Hülsenfruchtmischung und freut sich, als sie nach einem Wermut-Aperitif wieder Appetit verspürt.
Nach dem Essen bestellen die Frauen ein Elektromobil, in dem sie sich entspannt gegenüber sitzen, und lassen sich zum Büro fahren. Jutta erlebt diesen Vorgang ganz bewusst und sagt nachdenklich: »Wie sehr haben wir uns daran gewöhnt, dass wir diese Autos nicht mehr steuern müssen und nur die Adresse auf dem Display eingeben. Wie viele Unfälle sind uns seit Jahren erspart geblieben, weil die Maschinen emotionslos und umsichtig den Weg ohne Kollisionen zurücklegen und nicht frustrierte Menschen ihre Aggressivität im Straßenverkehr austoben!«
»Ja, das ist vernünftig. Aber ich fahre auch gern selbst mit einem Auto, das ich noch richtig lenken kann«, erwidert Sandra.
Zehn Minuten später hält das Mobil vor dem dreistöckigen Bürogebäude mit der zur Hälfte begrünten Fassade, in dessen Erdgeschoss ServiceAktiv mehrere Arbeitsräume hat.
Wieder registriert Jutta das Strahlen auf dem Gesicht ihres Vertreters, als Sandra den Raum betritt. Johannes hat Grafiken, Tabellen und Fotos auf dem Bildschirm aufgerufen und präsentiert Jutta die Lösungen, die das Team vorbereitet hat. Johannes bietet Sandra eine Relaxpause auf dem Massagesessel und ein erfrischendes Wasser mit Salzen an. Pause für Jutta, sie muss nichts erklären und erzählen.
Noch einmal fällt der Name Ina Maiwald – es gibt keinen Zweifel mehr. Jutta fällt der alte Spruch ein, der bei Abschieden dahingesagt wurde: »Man trifft sich immer zweimal im Leben.« Doch jetzt würde sie der dritten Begegnung mit ihrer früheren Freundin nicht mehr ausweichen können. In ihrem Magen rumort der Fisch, als würde er wieder hinausschwimmen wollen. Dann wird ihr schwarz vor den Augen.
Johannes springt hoch, stützt seine Chefin und führt sie hinaus. Leise sagt Jutta zu Sandra: »Wir sehen uns morgen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie sich in unserem Büro umsehen. Ich kann nicht mehr. Verzeihen Sie einer alten Frau.« Johannes ruft Felix, den derzeitigen Praktikanten: »Bitte bringen sie Frau Herbst bis in ihre Wohnung, ich bestelle ihre Ärztin dorthin.« Jutta setzt sich in den Vorraum und versucht tief zu atmen, während Felix einen Rollstuhl holt. Sandra hat das Büro betreten und Jutta hört mit ihrem guten Gehör die leise Stimme ihres Vertreters: »Wir machen uns Sorgen. Sie regt sich im Moment sehr auf. Dabei bereiten wir doch ihr Jubiläum vor. Wir haben uns eine tolle Überraschung ausgedacht. Sie war bis jetzt fit, sie soll nicht schlapp machen!«
»Wer ist eigentlich Ina Maiwald?« hört sie Sandra fragen. »Die Frau ist aus einem Pflegeheim hierhergekommen, krank und vor allem stur, abweisend, psychisch gestört. Unsere Chefin scheint sie von früher zu kennen. Keine Ahnung, woher.«
»Eigentlich wollte ich mit ihr heute zu dem Konzert gehen. Doch jetzt ist sie so durch den Wind, dass ich sie nicht noch einmal fragen möchte.«
»Kein Problem – gehen Sie einfach mit mir. Ich melde schnell die Plätze an.«
Jutta muss lächeln und merkt, wie sich Atmung und Puls wieder normalisieren. Was soll sie mit der Ärztin anfangen? Sie weiß selbst am besten, worüber sie sich aufregt. Ins Bett lässt sie sich nicht stecken, sie möchte zu dem Konzert gehen. Ein Konzert mit echten Musikern und Instrumenten ist eine besondere Rarität geworden. Sparmaßnahmen einerseits und technische Möglichkeiten andererseits hatten in den vergangenen zehn Jahren zu einem kulturellen Massensterben geführt. Gute Schauspiele, Opern und Orchesterkonzerte werden in wenigen Konzertsälen und Opernhäusern der Welt aufgezeichnet und dann mit riesigen Gewinnen einem zahlungskräftigen Publikum zugänglich gemacht. Um das Jahr 2010 begannen digitale Live-Übertragungen der Metropolitan-Oper aus New York in die großen und gut ausgestatteten Kinos vieler Länder. Die Entwicklung setzte sich fort mit immer raffinierterer Drei- und Vier-D-Technik. Kleinere Theater und Konzerthäuser wurden geschlossen, dafür kamen die digitalen Konzerte zunehmend in Mode, so dass die Preise dafür gewaltig anstiegen. Inzwischen gehört es zu ausgesprochenen Luxuserlebnissen, eine Oper oder ein Konzert direkt zu besuchen. Eines der wenigen in Deutschland erhaltenen Konzerthäuser ist das Leipziger Gewandhaus. Zur DDR-Zeit hatte Jutta dort ein preisgünstiges Anrecht, später noch einmal 2016, als ihre Firma recht gut zu laufen begann. Doch als sie 2017 als Ersatzoma für den zweijährigen Detlef einsprang und häufig auch kurzfristig abends gebraucht wurde, kündigte sie. Es war damals schon so teuer, dass der Verlust eines bereits bezahlten Konzertes Jutta weh tat.
Heute kostet ein Ticket für das Gewandhausorchester so viel, wie ein Arzt durchschnittlich in zwei Monaten verdient. Doch die Plätze sind weltweit gefragt und für lange Zeit im Voraus ausgebucht. Vor allem Chinesen und Amerikaner der begüterten Oberschicht leisten sich Reisen nach Europa und nutzen die attraktiven kulturellen Angebote. Jutta liebt und genießt die digitalen Klang- und Seh-Erlebnisse, doch sie wünscht sich noch einmal in ihrem Leben ein richtiges klassisches Konzert mit voller Orchesterbesetzung in der besonderen Atmosphäre des Gewandhauses erleben zu dürfen. Am liebsten von der Orchesterempore aus, von der die Zuschauer dem Dirigenten ins Gesicht und die Musiker ganz nah sehen. Sie lächelt in sich hinein über ihre hochfliegenden Fantasien und freut sich auf das kleine Konzert im Festsaal ihrer Wohnanlage.