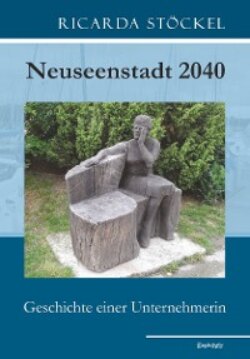Читать книгу Neuseenstadt 2040 - Ricarda Stöckel - Страница 11
4. KAPITEL – FREITAG, 29. JUNI 2040
ОглавлениеPünktlich um zehn steht Sandra vor Juttas Wohnungstür. Jutta war ungewöhnlich spät nach Mitternacht ins Bett gegangen, aber nach der bejubelten Veranstaltung und dem angenehmen Gespräch mit Enrico und Manuela, bei dem die drei alten Leute zwei Flaschen Rotwein genossen hatten, konnte sie tief und ungestört schlafen. Der Blutdruck ist fast ideal und sie fühlt sich ausgeruht. Sie begrüßt die Reporterin: »Haben Sie Lust, einen Einkaufsbummel mit mir zu machen? Sie kaufen bestimmt auch fast nur online ein? Heute fährt unser Einkaufsbus zu einem Supermarkt.« Sandra staunt: »Was denn, ein richtiger großer Lebensmittelmarkt, wie es sie früher an jeder Ecke gab? Wo man durch die Regale laufen, sich inspirieren lassen und die Waren selbst in den Einkaufswagen legen kann?«
»Ja, zumindest einer ist hier noch in der Nähe geblieben. Für die großen Shopping-Erlebniscenter fehlt mir die Geduld, das zu finden, was ich wirklich haben möchte. Das kostet zu viel Zeit und Energie. Ich kaufe alles Lebensnotwendige digital ein und lasse es mir liefern. Manches besorge ich auch hier in unserem kleinen Einkaufs- und Dienstleistungszentrum, aber da bekommt man nur das Nötigste. Eigentlich ist es überwiegend ein Bestell-Service für Leute, die das an ihrem eigenen Computersystem nicht können. Aber so ein richtiges Markterlebnis, bei dem ich die Sachen anfassen und auch wieder zurücklegen kann, gönne ich mir gern ab und zu – auch viele andere Leute schätzen das.«
»O ja, ich bin dabei!« Jutta freut sich über die Begeisterung in Sandras Stimme, deren wieder anders buntes Outfit sie nicht stört. Dieses Aussehen gehört zu Sandra und sie mag die junge Frau jeden Tag mehr.
Mit dem kleinen Elektroauto rollen die beiden Frauen zur Busabfahrtsstelle, während Jutta erzählt, wie noch vor dreißig Jahren das Einkaufen ablief: »Fast jeder hatte ein eigenes Auto, viele Familien sogar zwei und mehr. Außerdem fuhren öffentliche Busse zu den Einkaufszentren. Man schnappte sich gegen einen Pfand von einem Euro einen Einkaufswagen und lief an den Regalen entlang, suchte und wählte aus einem riesigen Überangebot Waren aus und packte sie in den Wagen. Dann stand man an der Kasse und legte jedes Stück auf ein Band. Dort saß eine Kassiererin, die die durch Strichcode gezeichneten Waren einscannte. Das waren rückenunfreundliche Arbeitsplätze, dazu meist schlecht bezahlt und mit ungünstigen Arbeitszeiten. Danach packte der Käufer alle Einzelteile wieder in den Wagen und bezahlte an der Kasse die Rechnung mit Bargeld oder durch eine Scheck-Karte. Schließlich hieß es alles im Auto zu verstauen, zu Hause wieder auszupacken und Treppen hochzutragen – nur die wenigsten hatten schon einen Aufzug im Haus.«
»Meine Güte, war früher Einkaufen umständlich!“, ruft Sandra aus.
»Ja, schon, aber das nahmen wir jahrelang gern hin, um endlich alles und in großer Auswahl kaufen zu können. Ich erinnere mich an die siebziger Jahre in der DDR. Da waren so viele Dinge Mangelware, dass sie mehr unter als über dem Ladentisch vergeben wurden. Man kaufte auf Vorrat, was es gerade gab. Mancher hatte in Form von Ersatzteilen fast schon einen zweiten »Trabant« im Keller! Sogar Wurst und Fleisch waren eine Zeitlang rar, weil sie als Exportgüter für erforderliche Zahlungen an den Westen und nach Russland notwendig waren. So hielten manche die Fleischerläden für Fliesenläden. Der Witz der Sache: Fliesen waren auch Mangelware und wurden gegen Westgeld gehandelt! Oft wurde von blauen Fliesen gesprochen, wenn man einen Hundert-DM-Schein meinte. Manche Handwerkerleistung kostete dann beispielsweise fünf blaue Fliesen!«
Sandra lacht und schüttelt den Kopf: »Sie haben wirklich in einer anderen Welt gelebt, wer soll sich das noch vorstellen können!«
Am Bus drängen sich mehr als zwanzig Frauen und vier Männer, die die Einkaufsfahrt als willkommene Abwechslung nutzen. Zwei Frauen kommen auf Jutta zu und mustern Sandra: »Na Jutta, jetzt hast du jüngere Gesellschaft und willst nicht mehr mit uns Rommé spielen?« sagt die kleinere von beiden.
»Quatsch«, entgegnet Jutta, »lasst erst meinen Geburtstag vorbei sein, mir ist alles ein bissel viel im Moment.«
»Man muss Prioritäten setzen«, fällt die große Dünne mit rosagefärbten Haaren ein: »Dass du für uns keine Zeit hast, werden wir verschmerzen. Aber dass hier eine alte Freundin von dir eingezogen ist, die du noch nicht einmal begrüßt hast, obwohl du dir das sonst nie nehmen lässt, ist schon seltsam. Wir haben ja Verständnis für dich, aber die Leute von Sommerlust fangen an darüber zu tuscheln.«
Jutta spürt ihr Herz mit mindestens doppelter Frequenz schlagen. Obwohl es heute kühler ist als an den vergangenen Tagen, fühlt sie Hitze durch ihren Körper bis in den Kopf steigen und ihre Achseln feucht werden. Die Freude, Sandra einen zünftigen Einkaufsbummel vorzuführen, ist verflogen. Warum gibt es nur überall, sogar in jeder scheinbar gut funktionierenden Gemeinschaft, Neider und böse Zungen? Was geht die beiden das an? Ihre Spielabende waren meistens recht lustig, aber das Lästern über andere hat Jutta oft gestört. Dass sie selbst so unverhohlen Zielscheibe der Gehässigkeit wird, hat sie nicht erwartet. Sie spürt Sandras besorgten Blick und versucht sich zusammenzureißen. Das schlechte Gewissen bohrt sich in ihre Seele. Sie hat noch nicht den Mut gefunden, Ina zu besuchen. Deshalb fühlt sie sich von dieser Bemerkung tief getroffen. Aber muss das gleich an die Öffentlichkeit gelangen? Was soll sie tun? Sie sollte sich endlich zu dem Besuch durchringen. Wovor fürchtet sie sich? Sie ist leidlich gesund, erfolgreich und jetzt im Alter auf der Sonnenseite des Lebens, während es der einstigen Freundin schlecht geht. Warum führt das Schicksal sie noch einmal zusammen? Welchen Sinn hat das, außer beiden Frauen Schmerz zuzufügen?
Fast lautlos rollt der Bus heran, so dass Jutta die Antwort erspart bleibt. Der Virenscanner in der Tür verwehrt einem älteren Mann das Einsteigen. Eine Leuchtschrift erscheint im Bus: »Achtung. Ein Fall von Noroviren ist aufgetreten. Bitte waschen Sie sofort Ihre Hände mit dem Desinfektionsmittel.« Drei Behälter sind im Bus verteilt und die Abfahrt verzögert sich um einige Minuten, bis alle Fahrgäste auf ihrem Platz sitzen. Sandra schaut mitleidig zu dem Mann, der verpflichtet ist, sich sofort bei der Infektionsstation zu melden. Der Befund des Scans ist auf seinem Fingerchip gespeichert.
Der Bus hält am Supermarkt und der Fahrer gibt eine Endzeit für das Shoppingvergnügen an, bevor die Fahrgäste den Einkaufswagenfuhrpark stürmen. Hier hat der Virenscanner nichts zu beanstanden. Die Wagen bestehen aus einem bequemen Sitz, neben dem man auch herlaufen kann, und davor einem geräumigen Korb. Mit einem Display können sich die Kunden die anvisierten Waren durch kleine Roboter zum Ansehen in die Hand und danach in den Wagen oder zurück ins Regal legen lassen. Eine Suchfunktion ermöglicht, Produkte zielgerichtet zu finden. Sandra packt sich den Wagen voll Lebensmittel und Kleinkram. Vor der Kasse halten beide Frauen mit ihren Wagen an großen Bildschirmen, die die gekauften Waren abbilden und die Kosten einzeln und in Summe anzeigen. Jutta hält ihren Fingerchip an das Gerät, das daraufhin ihr Guthaben vor und nach diesem Einkauf anzeigt und mit einer angenehm melodischen Computerstimme fragt: »Möchten Sie alles kaufen oder einzelne Waren zurückgeben beziehungsweise austauschen?«
Das funktioniert genauso mit Sandras Universalscheckkarte. »Oh Mist, ich habe mein letztes Honorar noch nicht, mit dem Einkauf komme ich ins Minus!“, ruft Sandra erschrocken aus.
Jutta ist schon durch den Kassenbereich gerollt und schaut zu, wie ein Roboter ihre Einkäufe in ein maßgerechtes Paket packt und mit ihrer Anschrift versieht. Pünktlich zu ihrer Heimkehr wird das Paket vor der Wohnungstür stehen und sich nach Kontakt mit ihrem Fingerchip öffnen lassen. Jutta bemerkt, dass der Inhalt von Sandras Einkaufswagen auf ein Minimum geschrumpft ist und ihr Gesicht deprimiert wirkt. Vielleicht sollte die junge Frau nicht so viel in Modeschnickschnack investieren und vernünftiger essen. Gleichzeitig empfindet sie Mitleid mit der Medialistin, die offensichtlich Probleme hinter der schreienden Fassade zu verbergen versucht. Ob sie einen Freund hat?
»Ich lade Sie zum Essen ein, vielleicht haben Sie Lust, mir beim Kochen zu helfen? Ich habe frisches Gemüse und Kartoffeln gekauft. Muss es Fleisch dazu sein?« Sie sieht ein Strahlen in Sandras Augen. »Oh stark, richtig kochen! Nein, Fleisch will ich nicht haben. Ich bin dabei, klasse!«
Es ist später Mittag, als die beiden Frauen Juttas Einkaufspaket in die Wohnung rollen. »Die Bohnen müssen gewaschen, geschnitten und zehn Minuten gekocht werden. Die Zwiebeln, Karotten, Pilze, Paprika, und den Lauch schneiden wir nach dem Waschen direkt in die Pfanne zum Braten. Die Kartoffeln braten wir in einer zweiten Pfanne allein, damit sie richtig knusprig werden.« Mit Freude verfolgt Jutta, wie eifrig Sandra ihren Anweisungen folgt. Die Arbeitsplatte, auf der sie alles schnippeln, enthält die integrierten Kochfelder, die sich dem Standort und der Größe von Töpfen und Pfannen anpassen. Der Kochvorgang beginnt nach einem elektronisches Signal der Kochgeräte. Die Felder erhitzen nur die zu garenden Lebensmittel, während die restliche Fläche kalt bleibt. Nach dem Kochen und anschließendem Warmhalten der Speisen schalten sich die Kochfelder automatisch ab. Die zusätzliche Kindersicherung hat Jutta deaktiviert.
Eine halbe Stunde später sitzen sie mit beladenen Tellern vor dem duftenden Gericht und essen voller Genuss, ohne etwas übrig zu lassen.
»Das war toll, so gut hat es mir ewig nicht geschmeckt«, verkündet Sandra strahlend. Sie scheint sich wohl zu fühlen, denkt Jutta, als Sandra anbietet, mit der Universalkaffeemaschine einen Espresso zuzubereiten.
»Für mich einen Milchkaffee«, sagt Jutta und lässt sich in ihrem Liegestuhl auf dem Balkon nieder. Sandra setzt sich an den kleinen Tisch. Der Duft der bunten Sommerblumen in den Balkonkästen schmeichelt den Nasen und lockt Bienen an, deren Summen die Stille erfüllt. Es ist angenehm warm, die Hitze und Schwüle sind vorerst gebannt.
»Herrlich ruhig haben Sie es hier.«
»Ja, um diese Zeit genieße ich das sehr. Aber nachmittags und abends, wenn die Kinder aus Kindergarten und Schule da sind und viele Eltern nach der Arbeit in Gruppen draußen sitzen, ist es oft ziemlich laut. Ich hätte mir früher nicht vorstellen können, wie ruhe- und harmoniebedürftig ich jetzt bin.«
»Stört Sie das sehr? Ist es vielleicht doch besser, wenn die Generationen nicht so aufeinanderprallen?«
»Ja und nein. Ich war viele Jahre sehr allein. Ich habe alle Menschen um Trubel, Familie, Freunde, Kinder, Enkelkinder, Verwandte und große Familienfeiern beneidet. Am meisten verhasst war mir meine Ruhe, von der ich mehr als genug hatte. Bekannte mit Familie wollten manchmal dem Lärm, dem Stress und auch Streitigkeiten in ihrer Gemeinschaft entgehen und haben mich um meine Ruhe und mein selbstbestimmtes Leben beneidet. Mir scheint, es liegt einfach in der Natur des Menschen, das haben zu wollen, was man gerade nicht hat. Was wir besitzen, schätzten wir häufig erst, wenn wir es verlieren.
Generationen haben über Jahrhunderte ganz selbstverständlich zusammengelebt, die Vorteile genutzt, aber auch unter zu viel Nähe und Konflikten gelitten. Mit der Globalisierung sind seit den neunziger Jahren zahlreiche Familien auseinander gebrochen. Die jungen Leute gehen dorthin, wo sie Arbeit bekommen und sich verwirklichen können, und gründen über Ländergrenzen hinweg neue Familien. Da der Mensch ein soziales Wesen ist, sind echte und virtuelle Netzwerke wichtig geworden. Es entstehen überall neue Gemeinschaften. Eine davon ist die in unserer Siedlung Sommerlust, in der ich mich zu Hause fühle.«
Sandra hat die leere Espressotasse abgestellt und knetet ihre Finger. Ihre Augen schweifen über die Blumenkästen mit den üppigen rot, rosa, lila und weiß blühenden Geranien und Petunien und zu den im leichten Wind schwankenden Ahornzweigen vor dem Balkon.
»Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ich muss meinem Großvater von diesem Wohngebiet erzählen. Er ist gesellig, war früher richtig lustig, und jetzt vereinsamt er allein in seiner Wohnung. Dort wohnen auch junge Leute, aber sie haben mit sich zu tun und um Opa kümmert sich niemand. Zum Glück ist er noch rüstig und kann sich selbst versorgen. Er ist geistig fit, ach, ich müsste ihn öfter besuchen.«
Nach einem stillen Moment richtet sich Sandra auf und lenkt das Gespräch in eine andere Richtung. »Und was ist mit Ihrer Freundin?«
Jutta seufzt und erzählt: »Das Treffen unserer Grundschulklasse fand am vierten September 1999 im Handwerkerkeller in Leipzig statt – fünfunddreißig Jahre nach dem Abschluss der achten Klasse und meinem Wechsel zur Erweiterten Oberschule. Das Datum hat sich mir eingeprägt. Es war nicht das erste Klassentreffen und ich hatte mit mir gekämpft, ob ich mich sehen lasse, denn ich war seit mehr als einem Jahr arbeitslos. Ich fühlte mich als Versagerin.«
»Das verstehe ich nicht. Ich denke, damals gab es die hohe Arbeitslosigkeit, weil viele Firmen Personal abbauten oder pleite gingen – da konnten Sie doch nichts dafür.«
»Das stimmt Sandra, aber das einzelne und vor allem das eigene Schicksal berührt den Menschen immer am meisten. Wenn anderen Unglücke geschehen, reagiert man mitleidig und freut sich insgeheim, dass einem das nicht selbst passiert ist. Aber wenn dich etwas persönlich trifft, was du bei anderen vielleicht nicht so dramatisch empfindest, dann kann dich das heftig schmerzen.«
»Sie haben sicher recht. Wenn ich daran denke, wie ich nach dem Streit wegen der dauernden Bevormundung die Brücken zu meinen Eltern abgebrochen hatte, dann war das auch ein ganz harter Brocken. Aber jetzt habe ich Sie unterbrochen, erzählen Sie von dem Klassentreffen.«
Jutta steht auf, streckt sich und füllt zwei Gläser mit Wasser aus der Leitung. Sie möchte Sandra nach dem Problem mit ihren Eltern fragen, doch vorerst muss sie sich auf ihren eigenen Erzählfaden konzentrieren. Sie schneidet eine frische Zitrone in Scheiben und fährt alles mit einem kleinen Servierwagen bis zum Balkontisch. Sie hat mit diesen kleinen Tätigkeiten ihre Aufregung ein wenig niedergekämpft. Vorsichtig lässt sie sich auf ihrem Stuhl mit dem dicken Kissen nieder und quetscht etwas Zitronensaft in ihr Wasserglas. Sie genießt die kühle, säuerliche Flüssigkeit in ihrem Mund, lehnt sich an und spricht weiter. Sandra beugt sich vor, um die leise Stimme zu verstehen.
»Das habe ich mir selbst gesagt, dass die kleine Sanitärfirma, in der ich gearbeitet habe, nicht durch meine Schuld Konkurs anmelden musste, sondern weil ihre Kunden die Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten und massenhaft Aufträge stornierten. In Leipzig hatte sich die Pleite eines bekannten Immobilienmanagers auf viele Bau- und Handwerksfirmen katastrophal ausgewirkt, wenn auch zum Teil mit Verzögerung. Er hat von den Banken riesige Kredite erhalten, mit denen er wichtige historische Gebäudekomplexe aufwändig saniert und etliche Wohnhäuser neu gebaut hat. Viele Leipziger waren ihm dafür dankbar, denn es ging sichtbar aufwärts mit der Rettung der verfallenen Stadt. Die Krux dabei war, dass sich alles als riesiges Lügengebäude entpuppte.
Ich hatte ab 1996 als Sekretärin, Buchhalterin und Mädchen für alles in der Sanitärfirma gearbeitet. 1995 hatte ich meine Marketing-Umschulung abgeschlossen und keine Stelle gefunden. Als ein Bekannter mir diesen Job anbot, griff ich zu, obwohl er unter meiner Qualifikation war und Schwierigkeiten programmiert waren, danach eine bessere Stelle zu bekommen.
Privat war alles schief gegangen, ich war ganz allein. Ich war geschieden und meine Tochter lebte bei ihrem Freund in Frankfurt am Main. Das Bild mit dem Kinderwagen in Karl-Marx-Stadt erzählt etwas anderes, das lag aber zu diesem Zeitpunkt weit zurück. Doch dazu später.«
Sandra seufzt und trinkt ihr Wasser aus. Gleich guckt sie auf die Uhr, ich sollte mich disziplinieren und zur Sache kommen, denkt Jutta.
»Ich will Sie nicht auf die Folter spannen. Zu diesem Klassentreffen sah ich meine frühere Freundin Ina wieder, das erste Mal seit der Flucht ihrer Familie in den Westen. Sie kam als Letzte, als wir alle in Gespräche vertieft waren. Ich unterhielt mich mit Klassenkameraden, denen es zum Teil nicht besser ging als mir, und fühlte mich wohl in der Runde. Dann trat Ina auf. Ihr Erscheinen verwandelte den Raum zur Showbühne und alle starrten hingerissen zu ihr: Eine elegante Frau mit fast Fünfzig, die sofort die Gespräche an sich riss. Ihre durchdringende Stimme ließ alle anderen verstummen. Hätte ich mich nicht gerade so gut mit meinem Klassenkameraden Bernd unterhalten und gehofft, das Gespräch bald fortsetzen zu können, wäre ich sicher schnell verschwunden. Doch um ehrlich zu sein, ich war auch fasziniert. Meine alte Freundin, wie hatte sie sich verändert, wie erfolgreich war sie geworden! Was hatte sie, was ich nicht einmal ansatzweise erreichen konnte? Obwohl sie fülliger war als ich, wirkte sie elegant in ihrem maßgeschneiderten dunkelblauen Kostüm. Ich brannte darauf, mehr aus ihrem Leben zu hören, doch sie präsentierte sich geschickt und mit vielen unterhaltsamen Details als erfolgreiche Marketingfrau. Von ihrem Privatleben erfuhren wir nichts. Plötzlich kam für mich die Überraschung: Sie sprach keineswegs von einer Firma in Stuttgart oder Hamburg, sondern sie lebte und arbeitete seit zwei Jahren in Leipzig. In einer mir unbekannten Firma GENIL hatte sie eine neue Marketingabteilung aufgebaut.«
»Wow, das ist ja super«, entfährt es Sandra und sie schlägt sich die Hand auf den Mund.
»Sandra, ich bin alt und inzwischen selbst erfolgreich. So fällt es mir nicht schwer zuzugeben, dass ich Ina an diesem Abend glühend beneidete. Obwohl ich beizeiten gehen wollte, saß ich am Ende noch mit dem harten Kern der Klasse dort und lauschte ihren Ausführungen. Bernd, mit dem ich mich eigentlich austauschen wollte, war längst nach Hause gegangen, als ich mir den Ruck zum Aufstehen gab. Ich hatte das Gefühl, als Einzige nüchtern zu sein, weil ich mir kein Getränk mehr leisten konnte. Ich dachte darüber nach, warum sich meine Freundin nie bei mir oder bei meiner Mutter, die noch im alten Haus wohnte, gemeldet hatte. Da sprach Ina die Sätze aus, die mein Schicksal veränderten: »Jutta, meine beste Freundin. Eine Ewigkeit haben wir uns nicht gesehen wegen dieser blöden Mauer. Erzähl doch mal von dir, ich lad dich zu einem Sekt ein. Nach so langer Zeit müssen wir unser Wiedersehen begießen.«
Sie bestellte eine ganze Flasche nur für uns beide, denn nun verschwanden die anderen auch. Offensichtlich war meine Freundin in der Klasse gar nicht so beliebt gewesen oder nach der Ausreise bei den meisten aus dem Gedächtnis verschwunden. Die Kellnerin zog ein griesgrämiges Gesicht, sie wollte Schluss machen, doch davon ließ sich Ina nicht beeindrucken. Und ich nach dem zweiten Glas auch nicht mehr. Plötzlich gab es wieder einen Gesprächsfaden, wir erinnerten uns an die Kindheit, lachten und mochten uns. Und dann bot sie mir in ihrer Marketingabteilung eine Stelle an. Ich zweifelte nicht an ihrer Redlichkeit. Sie war wieder meine Freundin, die mir half und der ich vertraute. Sie bestellte und bezahlte dann noch ein Taxi, das erst mich und dann sie nach Hause brachte.«
»Doch wo war der Haken? Das kann ja nicht ehrlich gewesen sein!“, ruft Sandra aus.
Jutta würde jetzt am liebsten Sandra einen Sekt spendieren. Aber nein, die junge Frau ist im Dienst, und der Alkohol mit Enrico und Manuela gestern war für Jutta und ihren hohen Blutdruck erst einmal genug.
»Es war ehrlich gemeint, das hat mich im nüchternen Zustand am nächsten Tag auch gewundert. Mit dem neuen Jahrtausend startete ich am ersten Januar 2000 in der Marketingabteilung der Firma GENIL im Zentrum von Leipzig. Mein Dienst fing in der Silvesternacht zur Schwelle des neuen Jahrtausends an, denn es waren wegen des Wechsels von 1999 zu 2000 Computerpannen, Stromausfälle und unerwartete Ereignisse befürchtet worden. Doch nichts Schlimmes passierte, alles funktionierte und in den Redaktionen langweilten sich die Journalisten, weil es keine Sensationen gab. Sie riefen ständig an und fragten nach, wobei sie nur beim Fernsehen störten.«
Sandra muss lachen und erzählt: »Ja von dieser verrückten Jahrtausendwende hat mein Opa auch berichtet. Er war Lehrer gewesen, fühlte sich zu Höherem berufen und schulte zum Betriebswirtschaftler um. In Frankfurt am Main machte er ein Praktikum und erlebte dort die Aufregung um die Jahrtausendwende so ähnlich. Er wollte noch einmal durchstarten und sich ablenken, denn er erlebte eine schlimme Zeit, wie ich es aus den Familienerzählungen weiß.«
»Sie erzählen mehr von Ihrem Großvater als von Ihren Eltern. Haben Sie eigentlich auch Geschwister?«
»Nein, ich bin ein verwöhntes Einzelkind«, Jutta vermisst die Fröhlichkeit in Sandras Lachen. »Ich hatte es sehr gut in meiner Kindheit. Aber am Ende war es auch das Problem, dass ich immerzu den Erwartungen meiner Eltern entsprechen sollte. Sie sind mit dieser Orgelbauwerkstatt verheiratet. Dass ich Orgelbauerin lernen und die Firma übernehmen sollte, stand von Anfang an fest, auch für mich. Ich stellte das nie in Frage und begann die Ausbildung. Aber bitte, fragen Sie jetzt nicht, warum ich sie abgebrochen habe und nur noch weg wollte. Ich erzähle es Ihnen ein anderes Mal. Bitte sprechen Sie von sich, das ist jetzt viel wichtiger.«
Jutta denkt über das eben Gehörte nach. Enrico möchte eine öffentliche Exkursion zur Besichtigung der Werkstatt von Sandras Eltern anbieten und zur Vorbereitung mit Jutta, Johannes und der Reporterin dorthin fahren. Ob das eine gute Idee ist? Sie möchte Klarheit schaffen, doch die junge Frau hat gerade ihr Telefon auf »Aufnahme« gestellt und schaut Jutta erwartungsvoll an.
»Ich bin jetzt ganz aus dem Konzept gekommen. Was machen Sie am Wochenende, wenn wir uns nicht sehen?«
»Keine Ahnung, am liebsten würde ich herkommen und mich weiter mit Ihnen unterhalten.«
»Gönnen Sie uns beiden eine Pause. Wartet kein junger Mann auf Sie?«
»Im Moment nicht. Aber ich kann mit der Reportage anfangen. Zu Ihrer Pressekonferenz möchte ich sie vorbereitet haben, damit ich einen Tempovorteil genieße.« Fast flehend setzt sie hinzu: »Schnelligkeit ist heute die einzige Waffe gegen Konkurrenten!«
»Ich verstehe dich – Sandra, von mir kannst du mich auch duzen. Jetzt kennen wir uns schon ein paar Tage. Ich heiße Jutta!«
»Danke, Frau Herbst – ach nein Jutta. Ich finde es toll, Ihr Angebot, nein dein Angebot, es ehrt mich. Aber ich muss mich erst daran gewöhnen.«
»Am Wochenende besuche ich Ina Maiwald, das habe ich mir fest vorgenommen. Es ist dir sicher nicht entgangen, dass sie aus dem Pflegeheim hierher gekommen ist und ich das anfangs am liebsten nicht wahrhaben wollte!«
»Jutta, wenn du das schaffst, bekommst du eine Tapferkeitsmedaille. Auch wenn ich eure ganze Geschichte noch nicht kenne, so weiß ich nun von deiner Freundin Ina und freue mich, dass du sie besuchen wirst! So ein Zufall, du erzählst mir von ihr, und sie lebt und kreuzt hier auf!«
»Hmm«, brummelt Jutta und denkt: Hätte ich doch bloß nicht so viel gesagt und versprochen. Eigentlich will ich sie nie mehr sehen, und in diesem Zustand schon gar nicht. Das wird mich nur weiter runter ziehen.
»Frau Herbst, ach nein, Jutta, ich habe das moderne Büro von ServiceAktiv gesehen. Doch ich kann mir nicht vorstellen, wie es mit deiner Firma begonnen hat. Erzählst du mir etwas aus der Anfangszeit?«
Jutta gibt sich einen Ruck und trinkt ihr Wasserglas leer.
»Das ist alles so lange her. Und trotzdem sehe ich mich noch in dem kleinen Büro sitzen, als sei es gestern gewesen. Zuerst enthusiastisch, weil ich nun endlich meine Ideen verwirklichen wollte, kurz darauf aber tief verzweifelt.
Ich habe bescheiden angefangen. Ich bekam ein kleines Büro in Enricos Verwaltungsgebäude, wo auch die Wohnungsverwaltung saß. Ich besaß Enricos abgelegten Computer und meinen fünf Jahre alten Laptop. Dazu einen Aktenschrank mit Ordnern. Darin hatte ich seit Beginn meiner Vorbereitungsarbeiten für die Gewerbeanmeldung Anzeigen für Dienstleistungen aus Zeitungen und dem Internet gesammelt. Zuerst musste ich unter den Anbietern Partner gewinnen, die bereit waren, an mich eine Provision zu zahlen und im Gegenzug Kunden zu bekommen. Dann begann ich, eine Datenbank der Dienstleister anzulegen. Es war eine Fleißarbeit, die ich vorher enorm unterschätzt hatte.
Wie gern hätte ich meinen damaligen Partner an meiner Seite gehabt, nicht nur seinen fachlichen Rat als Unternehmensberater. Manchmal saß ich vor dem Computer und träumte, wir beide würden zusammen die Firma aufbauen. Er würde scherzen und mit mir lachen, wir würden Ideen realisieren, gemeinsam arbeiten und abends jeden neuen Erfolg feiern. Manchmal überlegte ich, was er mir bei einzelnen Problemen raten würde. Ich hatte sechs Jahre lang versucht, diesen Mann zu vergessen. Doch plötzlich saß er in meinen Gedanken mit im Büro und ich konnte ihn nicht vertreiben. Ich hatte kein Glück mit ihm gehabt, ebenso wenig wie mit meinem Ehemann. Männer und ich – das passte in meinem Leben einfach nicht zusammen!
Und noch jemand drängte sich auf die gleiche Weise wieder in meinen Alltag: Ina Maiwald. Auch sie wollte ich vergessen, doch mit der Firmengründung richtete sie sich in meinen Gedanken häuslich ein. Ich hatte bei GENIL vor allem von ihr das Marketing-Einmaleins gelernt. Mit Service-Aktiv wollte ich mir selbst beweisen, dass ich dieses Fach genauso gut beherrschte. Doch bei jeder Aktion, die ich plante, um mein Konzept bekannt zu machen und Kunden zu gewinnen, fielen mir Sätze, Argumente, Vorbehalte ein, die ich von meiner damaligen Chefin gehört hatte. Selbst die Erinnerung an den derben Klang ihrer Stimme beleidigte mein Ohr.
Ich wollte selbstständig im wahrsten Sinne des Wortes sein und mich von Ina und von Roland lösen. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass die beiden so präsent sein würden. Ich fühlte mich mit meinem neuen, selbstgewählten Job einsamer als je zuvor. Manchmal liefen mir die Tränen übers Gesicht, wenn ich abends allein im Büro saß und Infos in meine Datenbank tippte. Dann glaubte ich, die Einsamkeit nicht mehr ertragen zu können. Ich war nah dran, alles wieder hinzuwerfen. Unseren heutigen Leitspruch »Tun« hatte ich damals noch nicht entdeckt, sondern versuchte mich mit einem Zitat des Schriftstellers Erwin Strittmatter zu motivieren: »Verfolge dein Ziel, Tag für Tag, beharrlich! Mögen die Worte, mit denen das gesagt wird, konventionell wirken, es gibt nur diesen Weg, zu dir selbst zu kommen!«
Wenn am nächsten Morgen Enrico und Manuela in mein Büro kamen und sich nach meinen Fortschritten erkundigten, sah ich alles wieder in rosigerem Licht und ich beschloss, nicht aufzugeben, meine Freunde nicht zu enttäuschen und die Firma zum Leben zu erwecken. Außerdem war mir klar, in welche Depression mich ein Misserfolg stürzen würde.«