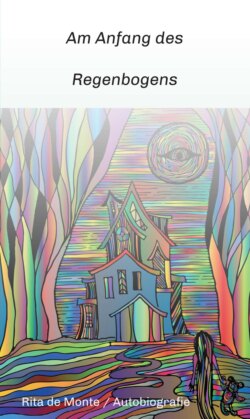Читать книгу Am Anfang des Regenbogens - Rita de Monte - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBaby Rita
Vier Jahre nach der Heirat meiner Eltern, kam ich in besagtem heißen Monat August 1961 – als Sternzeichen Löwe - auf die Welt. Leider blieb ich ein Einzelkind, was mich oft sehr traurig machte. Vor allem, da meine Mutter immer sehr mit sich selbst beschäftigt war und mein Vater oft erst spät abends von der Arbeit heimkam. Er schien gar nicht wirklich zu wissen, dass ein Kind mehr als Essen und ein Bett braucht. Eigentlich logisch, wenn man sich seine eigene Kindheit anschaut. Aber für mich selbst nicht so toll.
Wobei er sich anfangs wirklich bemühte und mit uns an den Wochenenden oft zum „Froschweiher“ fuhr. Dort zeigte er mir Kaulquappen. Er hatte sich eine Isetta gekauft. Ein kleines Auto bei dem die Tür nach vorne aufging und wir drei gerade so Platz hatten. Die Isetta wurde meines Wissens damals von den Bayerischen Motorenwerken gebaut, war also ein BMW und der ganze Stolz meines Vaters.
Der Wald in dem der Froschweiher lag war für mich ein richtiger Erlebnisspielplatz. Einmal fingen wir einen Aal und ich durfte ihn in einem Eimer mit nach Hause nehmen. Der Aal stieg aber tatsächlich nachts aus seinem Eimer aus und ich fand ihn – zum Glück noch lebend – unter meinem Bett. Wir brachten ihn natürlich wieder zurück in die Freiheit.
Ich bin mir inzwischen sicher, dass er mich sehr geliebt hat. Nur konnte er mir das nie wirklich zeigen. Er hat ja nie selbst lernen können, dass man ein Kind in den Arm nehmen oder ihm liebevoll über den Kopf streicheln könnte. Er sagte immer zu mir „Was einen nicht umbringt, macht einen hart“. Das war sein altbewährtes Motto.
Ja, ohne Zweifel sorgte mein Vater vorbildlich und pflichtbewusst für uns. Er ging oft zwölf Stunden arbeiten, wir hatten genug zu essen, ein Bett und konnten sogar einmal im Jahr in den Urlaub fahren. Meistens zum Zelten. Trotzdem hatte ich ihn immer als harten Hund in Erinnerung. Ehrlich, konsequent und hart. Gefühle zu zeigen oder zu heulen war verpöhnt. Durch sein Verhalten nahm ich ihn als Menschen wahr, der mich nicht liebte, denn er nahm mich niemals in den Arm. Ich hatte das Gefühl, dass ich seine Liebe nur durch Taten und Leistung bekommen konnte, denn wenn ich etwas gut gemacht hatte, dann lobte er mich manchmal und das war schön. Trotzdem war es irgendwie nie genug für mich. Ich glaubte deshalb auch meiner Mutter nicht, die immer wieder beteuerte, wie sehr er mich lieben würde.
Einmal zog er mir ein Hühnerauge mit der Beißzange. Dies sage ich nur, damit ihr nachvollziehen könnt, dass er mich zu einem Menschen erziehen wollte, der einiges aushalten kann.
Jedenfalls lernte ich Dinge zu erdulden, obwohl ich mich längst hätte wehren sollen. Manche Kinder reagieren mit Rebellion, ich stellte mich eher tot. Ja nicht auffallen, keine Ansprüche stellen, mich überall anpassen und einfügen. Dadurch entwickelte ich auch eine sehr starke Empathie.
Sich anpassen zu können, ist natürlich sehr hilfreich für's Leben. Allerdings war es so extrem, dass ich meine eigenen Wünsche mit der Zeit immer mehr vergaß. Ich spürte einen Mangel in dieser Familie, den ich mir nicht erklären konnte. Wie sollte ein Kind auch wissen was es vermisst. Schon in meiner frühen Kindheit, so mit sieben Jahren, spürte ich, dass meine Mutter mehr in ihren eigenen inneren Problemen gefangen war und ich eigentlich nur störte. Ich ging deshalb entweder auf die Gasse, so nannte man das spielen und herumstreunen draußen, oder ich zog mich mit einem Buch in mein Zimmer zurück, um mich in eine Fantasiewelt zu beamen. Denn damit konnte ich mich identifizieren, meinen Bewegungsdrang mental auszuleben, war in dieser Zeit das Höchste für mich.
Als quirliges, ungestümes und sehr wissbegieriges Kind geboren, wurde ich somit immer stiller und in mich gekehrter. Meine Empathie entwickelte sich zwar extrem, weil ich immer fühlen musste, ob ich mein emotionales Befinden äußern durfte oder lieber gerade nicht. Meistens kam ich zu dem Entschluß, dass ich es gerade nicht durfte und zog mich zurück.
Dadurch dass ich - außer im Kindergarten und später in der Schule – nicht wirklich soziale Kontakte mit anderen Kindern pflegen konnte, lernte ich auch nie wirklich mich konstruktiv zu streiten. Mir fehlten auch oft die Worte, um das was ich innerlich fühlte, verbal zu äußern. Irgendwann hab ich innerlich wohl resigniert, mich gar nicht mehr getraut mich zu äussern und letztendlich alles mit mir selbst ausgemacht. Somit habe ich schon recht früh gelernt, sehr angepasst zu sein und nichts zu fordern. Was sich später sehr negativ auf meine Beziehungen auswirken sollte.
Meine Mutter hatte immer ein schlechtes Gewissen mir gegenüber, und irgendwann kaufte sie mir einen Goldhamster als Spielgefährten. Goldi, wie ich sie nannte, bekam irgendwann sogar viele kleine Hamsterkinder. Ich hab noch ein Foto, wie sie alle zusammen in der Obstschale sitzen neben ein paar Äpfeln. Irgendwann büchsten die Kleinen allerdings aus und lebten bei uns in den Zwischenwänden. Mama Goldi hatte leider eines Tages Glaswolle gefressen und wurde von meiner Mutter vorsorglich mit dem Hausschuh erschlagen. Schon wieder ein Mord vor meinen Augen. Die Erwachsenen verstehen anscheinend nicht, dass ein Tier für ein Kind ein Geschwisterersatz sein kann und dass da durchaus eine innige, unschuldige Verbindung entsteht. Und schon wieder verlor ich ein Haustier, das ich kindlich geliebt hatte.
Meine Kindheit wäre noch sehr viel einsamer verlaufen, wenn ich nicht Marianne kennengelernt hätte. Sie war ebenfalls Einzelkind und hatte niemanden zum Spielen.
Eines Tages saß sie auf dem Mäuerchen an unserer Nebenstraße vor ihrem Wohnhaus. Sie war gerade von der Schule heimgekommen und wartete auf ihre Mutter, da sie den Schlüssel vergessen hatte. Ihr Wohnhaus stand direkt schräg gegenüber von meinem zuhause. Von unserem Hof aus sah ich das Mädchen dort sitzen und wurde neugierig.
Ich ging hinüber zu ihr und wir unterhielten uns. Dabei stellte sich heraus, dass wir den gleichen Schulweg hatten. So freundeten wir uns immer mehr an. Wenn ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, trafen wir uns meistens bei ihr. Sie hatte ein riesiges Zimmer und ganz viele Spielsachen. Ihre Eltern arbeiteten auch beide, aber die Oma war fast immer da und verwöhnte uns mit Kuchen und Süßigkeiten. Trotzdem war Marianne extrem dünn und schlaksig und erweckte immer den Eindruck, dass sie sich nicht alleine helfen konnte. Schon früh mutierte ich zu ihrer Beschützerin.
Meine Mutter musste in der Grundschule öfters antanzen, weil ich kratzte und biß. Natürlich verteidigte ich auch meine Freundin, wenn ihr jemand zu nahe kam. So baute ich wohl meine aufgestauten Agressionen ab.
Es gab da den Sohn des Schornsteinfegers. Der wohnte in der gleichen Straße wie ich und oft begegnete ich ihm wenn ich herum streunerte. Er wechselte oft schon die Straßenseite, wenn er mich aus der Ferne sah. Dies hielt mich jedoch nicht davon ab auf ihn zuzurennen und ihm eine zu klatschen. Meistens mitten ins Gesicht. Der arme Junge war einen ganzen Kopf grösser als ich, aber irgendetwas an ihm reizte mich zuzuschlagen. Irgendwann mied er mich dann so gut er konnte. Verständlich.
Da ich inzwischen eine sehr gute Intuition entwickelt hatte, merkte ich genau, wenn meine Mutter gestresst war. Da sie nur halbtags arbeitete, war sie ja Nachmittags immer zu Hause und eigentlich hätte ich mir mehr Zuwendung von ihr gewünscht. Doch ich hatte immer das Gefühl, dass sie ihre Ruhe brauchte und ich sie mit meinen kleinen Anliegen nicht belasten durfte. Dann ging ich zu meiner Freundin Marianne oder auf meinen heiß geliebten Schrottplatz.
Das Betriebsgelände auf dem mein Vater arbeitete, empfand ich als sehr spannend. Dort wurde Eisen gebogen, es lagen verrostete Eisenmatten und Stahlträger herum und eben auch diverser Schrott. Wenn sich in einem der Eisenträger Wasser gesammelt hatte, entstanden mit der Zeit kleine rote Würmchen, die dort herumschwammen. Solche Dinge faszinierten mich. Ich wäre die geborene Forscherin geworden. Vieles lernte ich einfach nur, indem ich alles sorgfältig beobachtete.
Wenn es regnete, verkroch ich mich in meinem Kinderzimmer und las. Ich fraß Bücher regelrecht. Das Lesen gab mir eine kleine heile Welt mit vielen Abenteuern. Ich konnte dadurch in meiner eigenen Fantasie versinken und vergaß alles um mich herum. Damals gab es noch kein Internet, keine Handys oder Spielekonsolen. Man musste sich selbst beschäftigen.
Eines Tages erzählte mir Marianne, dass sie in den Ferien drei Wochen zu ihrer Tante aufs Land fahren würde. Mich grauste schon vor dem Alleinsein. Also bettelte ich zu Hause so lange, bis ich mitfahren durfte. Und Juhu, ich durfte. Vermutlich war meine Mutter froh, eine Weile ihre Ruhe zu haben. Obwohl ich immer versuchte ihr nicht zu viel ihrer Aufmerksamkeit abzuverlangen, so hatte ich einfach den Eindruck, dass sie gerne eine Auszeit von mir hätte.
Die Tante von meiner Freundin besaß einen Bauernhof und hatte zwei Söhne, etwas älter als wir beide. Dort bestand das Leben zwar aus Arbeiten, Essen und Schlafen, aber es gab dort so viele unterschiedliche Tiere. Ich war in meinem Element und habe wunderschöne Erinnerungen daran. Einmal bin ich auf einer Kuh geritten und musste feststellen, dass die einen ziemlich harten Rücken hatte. Ganz anders als Pferde. Außerdem mussten wir beim Heu machen helfen, füttern und Beeren zupfen. Wir waren abends total k.o. aber glücklich.
Allerdings war es nicht immer so ganz sauber bei Tante Hilde. Einmal sah ich ihren eingeweichten Schlüpfer in einem Eimer unter dem Waschbecken vor sich hingammeln, beschmiert mit Blut. Damals wussten wir noch nichts von Monatsblutungen.
Trotzdem war dieser Urlaub ein tolles Erlebnis, und das Beste war, dass Tante Hilde uns zwei Hasen schenken wollte. Seltsamerweise erlaubte mir mein Vater mein Hasenkind. Er baute sogar einen Hasenstall in einem Wellblechschuppen, der auf dem Betriebsgelände seines Chefs stand.
Ich war selig. Endlich war ich nicht mehr allein. Immer mehr wurde Frau Schwarzohr zu meiner besten Freundin. Eigentlich war die Häsin weiss und hatte zwei schwarze Ohren, einen schwarzen Aalstrich auf dem Rücken und die Augen waren ebenfalls schwarz umrandet. Sie war wohl schon trächtig gewesen, als ich sie bekommen hatte, denn eines Tages fand ich in ihrem Stall ein weich ausgepolstertes Nestchen mit kleinen Hasenkindern. Ich freute mich natürlich sehr. Mein Vater eher weniger. Ich musste ihre Kinder dann später leider hergeben. Nur ihren Sohn Klopfer durfte ich behalten. Er klopfte immer mit den Hinterläufen, wenn er wütend war.
Schwarzohr konnte ich meine tiefsten Sorgen anvertrauen. Sie war Freundin, Schwester und Vertraute für mich. Damals war ich etwa acht Jahre alt. Jeden Nachmittag besuchte ich sie nach den Hausaufgaben und sie durfte dann, zusammen mit ihrem Sohn, im Schuppen herumrennen. Sie kam sogar angehoppelt, wenn ich ihr pfiff. Es waren die drei schönsten Jahre meines Kinderdaseins, denn ich war nicht mehr allein. Es war so schön sich in das Fell meiner Häschen zu kuscheln, so warm. Noch heute überkommt mich eine tiefe Ruhe, wenn ich meine Katzen und Hunde kraule und meine Nase in ihr kuscheliges Fell stecke.
Kurz vor meinem elften Geburtstag kam mein Vater mit einer schlechten Nachricht von der Arbeit nach Hause. Die Firma seines Chefs war pleite und deshalb wollte dieser das Betriebsgelände an eine große Firma verkaufen. Der Wellblechschuppen sollte abgerissen werden, denn dort sollten neue Gebäude und eine Umgehungsstraße entstehen.
Mein Vater sagte, die Hasen müssen weg. Ich heulte, flehte, bettelte, er ließ sich nicht umstimmen. Obwohl wir bereits in eine Eigentumswohnung mit Balkon umgezogen waren und es dort sicher ein Plätzchen gegeben hätte, blieb er hart wie Stahl.
An einem Samstag Vormittag sagte er: „Komm wir gehen zum Schrottplatz.“ Ich dachte, er hätte eine Lösung gefunden. Hatte er auch, allerdings eine sehr grausame. Ich musste meine Hasenfreunde herholen und festhalten. Dann nahm mein Vater sein Kleinkalibergewehr, das er sich für seine Mitgliedschaft im Schießverein zugelegt hatte, legte an und erschoss Schwarzohr und Klopfer. Dann zog er ihnen das Fell ab und hängte es zum Trocknen an einer Leine auf. Die Kadaver nahm er mit nach Hause.
Vielleicht kann man sich vorstellen was das für ein Kind bedeutet. Der Vater bringt die besten Freunde um. Und die Mutter stellt sich nicht dazwischen, um dem Kind zu helfen oder eine Lösung zu suchen. Auch sie war in meinen Augen eine Verräterin.
Ich hatte Angst vor meinen Eltern, besonders vor meinem Vater und kapselte mich noch mehr in mir selbst ab. Viele sagen jetzt sicher, das waren doch nur Hasen. Stimmt, es waren keine Menschen. Zum Glück. Aber für mich waren sie eben meine engsten und verlässlichsten Freunde, und auch Tiere haben eine Seele und fühlen Emotionen und Schmerzen, genau wie wir.
Ich schluckte alle meine Tränen und Gefühle hinunter, denn ich hatte bereits gelernt niemandem zu zeigen wie ich mich fühlte. Auch das Verhältnis zu Marianne kühlte deutlich ab. Sie hatte ihren eigenen Hasen natürlich noch und liebte ihn bei weitem nicht so wie ich meine Hasen geliebt hatte. Aber sie hatte auch einen Rückhalt in ihrer Familie. Sie durfte immer sagen, was sie fühlte und dachte und ihre Bedürfnisse wurden ernst genommen.
Ich jedoch hatte lange daran zu knabbern und sah meinen Vater ab da auch als Bedrohung für Leib und Leben. Er war vorher schon sehr hart und geradlinig gewesen, aber jetzt ging es um eine Bedrohung. Und ich fühlte mich als Verräterin an meinen geliebten Freunden, weil ich ihnen nicht hatte helfen können. Massivste Schuldgefühle quälten mich, weil ich nicht aufbegehrt und rebelliert hatte.
Damals begriff ich noch nicht, dass mein Vater mir die „Härte“ des Lebens beibringen wollte, allerdings aus seiner Sichtweise. Keines meiner Elternteile begriff, wie einsam ich mich fühlte und wie sehr dies schmerzte. Kein in den Arm nehmen, nur dumme Sprüche wie: „Es waren doch nur Tiere.“
Etwa zwei Wochen später servierte meine Mutter „Hähnchen“ zum Abendessen. Auch wenn ich noch nicht viel über Tieranatomie wusste, so war mir doch klar, dass das ein zerlegter Hasenbraten war. Das erste Mal in meinem Leben wehrte ich mich und weigerte mich meine Hasen zu essen. Natürlich musste ich ohne Essen ins Bett. Aber das war mir egal. Ich fühlte mich so schon schlecht genug. Vielleicht war das dann letztendlich auch der Auslöser, dass ich einen Jungen wieder einmal scheinbar grundlos ohrfeigte. Ich musste diesen inneren Druck loswerden. Damals war ich bereits in der 5. Klasse der Realschule.
Auch dort hatte ich es nicht leicht. Mathe war ein rotes Tuch für mich. Ich war eher mit einer Sprachbegabung gesegnet statt mit logischem Denken. Deshalb hatte der Mathelehrer mich auf dem Kieker. Den hatten wir leider auch noch in Gemeinschaftskunde und Erdkunde. Ich musste ständig vor der ganzen Klasse Referate halten, was für einen introvertierten Menschen wie mich wirklich ein Albtraum war.
Ja, natürlich meisterte ich das. Aber da ich generell wenig redete, konnte man das schon als schwer für mich bezeichnen. Die Nacht davor konnte ich vor lauter Angst nicht schlafen. Im Nachhinein bin ich aber froh, dass mich mein Lehrer dazu „gezwungen“ hat, denn es gab mir dann doch auch einige Erfolgsmomente.
Mariannes und meine Wege hatten sich bereits getrennt. Ich war in die Realschule gewechselt während Marianne aufs Gymnasium durfte, obwohl sie viel schlechtere Noten hatte als ich. Mein Weg war laut meinem Vater schon vorprogrammiert. Er sah mich im Büro, wo es warm und angenehm sei und er meinte, Realschule sei eben vollkommen ausreichend dafür. Meinen Wunsch Tierpflegerin oder Tierärztin zu werden, lehnte er kategorisch ab und da ich vor ihm Angst hatte, schaffte ich es auch nicht, mich wirklich gegen ihn aufzulehnen. Meine Mutter war ebenfalls keinerlei Hilfe. Sie unterwarf sich weiterhin. Aber sie konnte eben nicht anders.
Durch den Konkurs der Firma meines Vaters mussten sich meine Eltern neue Jobs suchen. Durch die dadurch entstehende knappe finanzielle Lage, war die Situation eine zeitlang sehr angespannt und die Stimmung zu Hause dementsprechend.
Doch dann fand mein Vater eine Anstellung im Arbeitsamt als Hausmeister und Mädchen für alles. Damit verbunden eine schöne Vier-Zimmer Dienstwohnung in einem charmanten alten Gebäude und so zogen wir wieder einmal um.
Meine Mutter fand eine halbstags Anstellung im Wasserwirtschaftsamt in Ravensburg, und somit war die finanzielle Lage gerettet und die Laune zu Hause wieder etwas entspannter. Trotzdem war die Ehe meiner Eltern noch schwieriger geworden, und ich litt nach wie vor unter der „kühlen“ Atmosphäre in meiner Familie.
Dass auch meine Mutter litt, wusste ich. Aber so richtig bewusst, dass etwas ganz und gar nicht stimmte, wurde mir erst, als ich mich eines morgens zur Schule fertig machen wollte. Ich ging ins Bad und fand meine Mutter dort vor. Sie hielt den Arm über's Waschbecken, und es war alles voller Blut. Ich war so erschrocken, dass ich in Ohnmacht fiel, und als ich aufwachte war alles wieder blitzesauber. Erst viele Jahre später brachte ich das mit späteren Ereignissen in Verbindung. Es war wohl ihr erster Selbstmordversuch gewesen. Als ich in Ohnmacht fiel, ließ sie wohl von ihrem Vorhaben ab. Vielleicht habe ich ihr damals sogar das Leben gerettet, und es wurde ihr bewusst, dass sie ein Kind zu versorgen hatte. Natürlich wurde auch dieses Ereignis totgeschwiegen, und man tat als ob nie etwas gewesen wäre. Mein Vater bekam das damals vermutlich auch gar nicht mit. Ich denke meine Mutter hätte es aus Scham niemals erzählt. Bereits damals verschlechterte sich ihre Gesundheit. Sie hatte starke Darmbeschwerden und war ständig gereizt und launisch.
So plätscherte die Zeit dahin. Ich kam immer mehr in die Pubertät, und da meine Mutter in Hinsicht auf sexuelle Aufklärung sehr prüde war, kaufte ich mir die Zeitschrift BRAVO in der Dr. Sommer genau erklärte, wie das zwischen Mädels und Jungs ablief. Man wollte ja nicht unvorbereitet sein.
Meine Mutter hatte mir nie erzählt, dass ein Mädchen „seine Tage“ bekam. Bis ich eines Tages mit zwölf Jahren bemerkte, dass mir Blut die Schenkel hinunter floß. Erst als ich erschrocken zu ihr rannte, klärte sie mich diesbezüglich auf. Aber es war ihr sichtlich peinlich darüber zu sprechen.
Da ich auch im Umgang mit Jungs sehr schüchtern war, kompensierte ich dieses Thema, indem ich mir ein riesiges Poster von meiner Lieblings Popgruppe The SWEET und Brian Conolly übers Bett hängte. Ihn himmelte ich an und saugte jeden Artikel über die Popgruppe auf. Ich hatte natürlich auch alle Schallplatten von ihnen, und immer wenn ich alleine war, hörte ich diese in voller Lautstärke und hopste herum. Tragischerweise starb Brian früh an seiner Alkoholsucht. Da hätte ich mir doch damals schon das falsche Bandmitglied ausgesucht bzw. den falschen Mann.
Zwei Klassen über mir gab es einen Jungen, der genau so aussah wie Brian. Er war auch groß und schlaksig und hatte lange blonde Haare. Sein Name war Ronny. Wenn ich ihn im Pausenhof sah, klopfte mein Herz. Natürlich würdigte er mich keines Blickes. Aber träumen durfte man ja. Die Typen in meiner Klasse würdigten mich ebenfalls keines Blickes. Jedenfalls die nicht, die ich interessant fand. Die standen auf die schlanken Mädels, die sich in Szene zu setzen wussten. Das hatte ich leider nie gelernt und war wohl somit uninteressant.
Dennoch machte natürlich auch ich meine ersten Erfahrungen. Witzigerweise vollkommen unbeabsichtigt.
Ich war gerade dreizehn Jahre alt geworden, und es war ein wunderschöner heißer Julitag. Noch heute muss ich über diese Begegnung schmunzeln. Meine Mutter hatte mich zum Einkaufen geschickt, und ich schlenderte mit meinem geflochtenen Einkaufskorb durch mein Heimatstädtchen auf dem Weg zum Supermarkt.
Ich muss zugeben, eigentlich war ich auch ganz hübsch, obwohl mir das nicht bewusst war. Ich war zwar nicht gertenschlank, hatte aber ein hübsches Gesicht mit grünen Augen und lange blonde Haare. Wie immer war ich in Jeans und T-Shirt unterwegs. Was anderes kannte ich nicht und ich wusste auch nicht wie ich meine weiteren Vorzüge hätte unterstreichen können. Meine Mutter ist nie mit mir Kleidchen shoppen gegangen oder tolle Schuhe, oder hat mir gezeigt wie man sich schminkt. Es gab halt das Nötigste was unbedingt sein musste.
Bei uns wurde an allen Ecken und Enden gespart. Einmal im Jahr ging mein Vater alleine – ohne uns als Ballast – in den Club Mediteraneé Urlaub zum Tauchen. Er hatte sich eine teure Tauchausrüstung gekauft.
Später als er so um die vierzig Jahre alt war machte er sogar noch den Pilotenschein und kaufte sich eine gebrauchte Cessna, um seinem Hobby zu frönen. Die Cessna stand damals auf dem Flugplatz in Friedrichshafen in einem Hangar und jedes Wochenende mussten wir mit meinem Vater dorthin. Er finanzierte seine Leidenschaft mit Rundflügen. Oft musste ich aber mit ihm fliegen. Da mir früher auch schon beim Autofahren schlecht geworden war, wurde mir beim Fliegen erst recht übel. Man konnte fast die Uhr danach stellen, wann ich anfing mein Essen von mir zu geben.Meistens schaffte ich gerade mal sechzehn Minuten. Ich hatte immer eine Tüte dabei. Auch hier wollte er mich abhärten, denn oft begann er, die Maschine mit der Propellernase gen Boden zu richten und ließ sie trudeln, um sie im letzten Moment vor dem Aufprall wieder abzufangen. Man kann sich vorstellen, dass ich tausend Tode starb. Er lachte immer nur, denn es schien ihm Spaß zu machen mich zu quälen.
Doch zurück, zu diesem heißen Julitag, als ich dreizehn Jahre alt war. Jedenfalls war ich damals bei meinem Gang zum Supermarkt in Gedanken vertieft und bemerkte gar nicht, wie ein hübscher dunkelhaariger Junge mich anvisiert hatte. Ich bemerkte ihn erst, als er schon neben mir stand und mich fragte, ob er meinen Korb tragen dürfte. Bevor ich antworten konnte, drückte er mir einen feuchten Kuss auf den Mund und rannte davon. Man kann sich sicher vorstellen wie verwirrt ich war, schließlich war es mein allererster Kuss gewesen.
Vielleicht hatte er eine Wette abgeschlossen mit einem seiner Kumpels, aber geklärt wurde das nie, weil er einfach weg war. Fakt ist, es hatte sich gar nicht so übel angefühlt. Im Gegenteil, ich fand es toll und träumte noch eine ganze Weile davon. Jedesmal, wenn meine Mutter mich wieder zum Einkaufen schickte, ging ich den gleichen Weg und hoffte immer darauf, ihm wieder zu begegnen. Aber leider war dies nie der Fall. Aber das Leben ging ja weiter. Meinen Eltern erzählte ich natürlich nichts davon. Das war ganz allein mein Geheimnis.
Gegenüber unseres Wohnhauses gab es eine Schule für kaufmännische Berufe. Eines der Fenster ging genau auf meinen Schulweg hinaus. Ich musste also jeden Tag an diesem Fenster vorbei gehen.
Die Jungs saßen oft am Fenster auf der Fensterbank und lehnten sich hinaus um zu rauchen. Sie waren schon wesentlich älter, vielleicht so achtzehn Jahre. Oft gab es auch ein paar anzügliche Bemerkungen oder Pfiffe, wenn ich vorbei ging. Es fühlte sich immer an wie ein Spießrutenlauf und doch gefiel es mir irgendwie.
Eines Tages wurde ich von einem der Jungs angesprochen. Er sah süß aus und stellte sich als Walter vor. Walter war mir schon öfters aufgefallen, weil er immer eine blaue Stoffhose trug und keine Jeans, wie die anderen Jungs. Er meinte, dass er mich gerne einmal treffen würde. Nach einigem hin und her stimmte ich zu und wir verabredeten uns vor seiner Schule.
Nachmittags um fünfzehn Uhr stand ich vor seinem Schulgebäude. Mein Herz klopfte so laut, dass ich dachte, dass er das doch bestimmt hören müsse. Doch er blieb ganz cool und wir gingen zusammen den Leibingerbuckel hinauf – diese Anhöhe heißt so, weil dort die Brauerei Leibinger steht. Direkt oberhalb der Brauerei liegt am Hang ein kleiner Wald, den man Schwarzwäldle nennt. Vor vielen hundert Jahren haben sich die Schwarzen Veri – eine Verbrechergruppe – dort versteckt gehalten.
In diesem Wäldchen gibt es einen etwas gruseligen, mystisch wirkenden Ort. Eigentlich sollte das ein heiliger Ort sein, nämlich eine Andachtsstätte der Heiligen Jungfrau Maria. Es gibt dort große Findlingssteine, die man teilweise ausgehöhlt hat um Dauerlichter hineinzustellen. Deshalb findet man dort immer brennende Kerzen. Auch Heiligenbilder und vom Bildhauer gefertigte Heiligenschreine findet man dort. Liebevoll angelegte Spazierwege durchkreuzen das ganze Wäldchen und grün angestrichene Holzbänke laden zum Verweilen ein. Von dort hat man einen gigantischen Blick den Hang hinunter auf die vielen Türme des oberschwäbischen Städtchens Ravensburg und die Stadtmauer.
Wir ließen uns auf einem dieser Bänkchen nieder, und plötzlich fing Walter an mich zu küssen und an mir herumzufummeln. Inzwischen weiß ich auch, wie naiv gestrickt ich damals war, aber es hatte mir niemand irgendwelche Warnungen oder Verhaltensregeln im Umgang mit dem männlichen Geschlecht mit auf den Weg gegeben.
Doch welch Unterschied war diese Küsserei zu dem leidenschaftlichen Kuss des dunkelhaarigen Jungen von der Straße, der mir meinen ersten Kuss gestohlen hatte. Walter säuberte sich nach jedem Kuss den Mund mit einem Papiertaschentuch. Es war richtig eklig und deshalb entzog ich mich schon bald mit der Entschuldigung, dringend nach Hause zu müssen.
Welch eine Enttäuschung war die Erkenntnis, dass es wohl gute und schlechte Küsser geben musste und dass dies keinem auf der Stirn geschrieben stand. Man musste es leider erst ausprobieren. Ich hatte erst einmal genug von Jungs und widmete mich wieder vermehrt der Schule.
Auf dem Heimweg von der Schule sah ich eines Tages eine junge Krähe auf dem Schild der Bushaltestelle sitzen. Vögel sind ja auch in der Stadt nichts Ungewöhnliches. Doch dieser schien mir nicht wirklich fit zu sein, denn er flog nicht weg.
Langsam ging ich auf ihn zu, und er ließ sich von dem Schild herunternehmen. Auf meiner Hand sitzend nahm ich ihn mit nach Hause. Ich taufte ihn Jockel. Mama und ich setzten ihn unter eine Obstkiste auf unsere Dachterasse und während sie Eier hart kochte, ging ich zum Metzger und kaufte Rinderhackfleisch.
An diesem Tag war mein Vater schon etwas früher heimgekommen und zeigte mir wie man dem Vogel kleine Bällchen Hackfleisch, gemischt mit gekochtem Ei, in den Schnabel schob. Rabe Jockel war sichtlich begeistert, endlich etwas zu essen zu bekommen.
Mein Vater wusste eigentlich sehr viel über Tiere und manchmal dachte ich, er liebt sie. Doch er lebte diese Liebe nie. Vielleicht hatte er auch nur Schuldgefühle wegen meiner Hasen. Jedenfalls durfte Jockel bei mir bleiben bis er wieder richtig fit war. Damals faszinierte es mich bereits, wie klug diese Vögel sind. Dann kam leider der Tag des Abschieds.
Ich bemerkte wie er immer unruhiger wurde und es in seiner Kiste kaum mehr aushielt. Inzwischen frass er auch wieder selbständig und wirkte topfit. Also nahm ich ihn heraus, setzte ihn auf meinen Arm und entließ ihn in die Freiheit. Zunächst flog er nur auf einen Baum gegenüber unseres Balkons. Er blieb noch ein paar Stunden in der Nähe, doch schon am Abend war nichts mehr von ihm zu sehen. Es blieb mir nur, ihm alles Gute zu wünschen. Natürlich war ich auch etwas traurig, aber ein Wildvogel gehört eben in die Freiheit, auch wenn es dort gefährlich ist und die Tiere oft nicht so lange leben. Man konnte eben nicht alles beschützen, denn alles folgt einer höheren Ordnung.
Und so widmete ich mich weiterhin der Schule, denn der Realschulabschluß stand bevor. Ich schaffte die Prüfung zur mittleren Reife mit einer Belobigung. Beste Voraussetzungen eine Ausbildungsplatz zu finden.