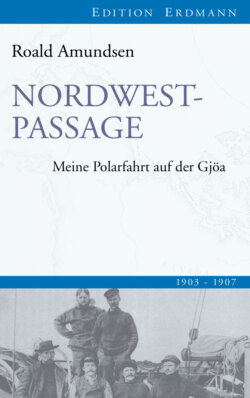Читать книгу Nordwestpassage - Roald Amundsen - Страница 15
ERSTES KAPITEL DEM EISMEER ENTGEGEN
ОглавлениеDer Einzige, der bei unserer Abreise Zeichen von Rührung kundgab, war der Himmel, aber der tat es auch mit allem Nachdruck. Als wir in der Nacht vom sechzehnten auf den siebzehnten Juni den Anker lichteten, regnete es in Strömen. Sonst war die Nacht still und dunkel, und nur unsere Nächsten waren auf das Schiff gekommenen, uns Lebewohl zu sagen.
Aber trotz Regens und Dunkelheit und trotz des letzten Abschieds war die Stimmung auf der Gjöa heiter und froh. Die Interimszeit der letzten Wochen, ohne eigentliche Arbeit, hatte uns alle ermüdet. Für meine persönlichen Gefühle kann ich keinen Ausdruck finden, und möchte es auch nicht. Die Anstrengungen der letzten Zeit, um alles vollends in Ordnung zu bringen, die Unruhe, dass wir immer und immer noch nicht abfahren konnten, und meine verzweifelten Anstrengungen, die fehlenden Gelder zusammenzubringen – dies alles hatte mich stark mitgenommen und mir Leib und Seele angegriffen.
Aber nun war es überstanden, und niemand könnte die unsägliche Erleichterung beschreiben, die uns überkam, als die Jacht vom Ufer wegglitt.
Außer den sieben Teilnehmern an der Expedition waren nur noch meine drei Brüder an Bord, die uns zum Kristiania-Fjord hinaus das Geleit gaben. Es war still und ruhig auf der Gjöa, die ganze Navigation wurde vorläufig von einem Schleppdampfer besorgt, den wir vor dem Bug hatten. Die Wache war dem Steuermann überlassen sowie unseren sechs Hunden. Diese Hunde hatten schon bei der zweiten Expedition der »Fram«, die sie mit nach Hause gebracht hatte, gute Dienste geleistet. Arme Tiere! Es wäre besser gewesen, man hätte sie in Eis und Schnee zurückgelassen, anstatt sie dahin zu schleppen, wo sie sich, besonders in diesem Frühling, der so ungewöhnlich warm war, sehr übel befanden. Da standen sie nebeneinander angebunden und sahen in dem Regen jammerwürdig aus – denn Regen ist das Schlimmste, was man einem Polarhund bieten kann. Schon auf der Herreise hatten sie eine Seefahrt in Regen- und Nebelwetter durchmachen müssen, und jetzt war ihnen auf der Rückkehr eine zweite beschieden. Aber nun ging es ja auch wieder dahin, wo die armen Schelme daheim waren!
Um sechs Uhr morgens erreichten wir den Hafen von Horten, wo wir zweihundert Kilogramm Schießbaumwolle einnahmen. Sprengstoff kann bei einer Polarexpedition von großem Nutzen sein, und ich würde es als einen entschiedenen Fehler betrachten, wollte man ohne solchen ausziehen, selbst wenn es geschieht – wie das bei uns der Fall war –, dass man keine Verwendung dafür bekommt.
Um elf Uhr vormittags waren wir bei Färder. Das Wetter hatte sich gebessert und der Regen aufgehört. Als wir eben die Bugsiertrosse losmachen wollten, riss diese von selbst ab und ersparte uns dadurch die Arbeit. Mit vollen Segeln fuhr die Gjöa nun bei dem Wind südwärts und senkte ihre Flagge zu einem letzten Gruß an die Lieben daheim. Lange verfolgten wir das Bugsierboot mit dem Fernrohr, lange schwangen wir unsere Mützen und beantworteten die erst mit dem Boot in weiter Ferne verschwindenden Grüße.
Nun waren wir also allein und jetzt begann die Expedition im Ernst.
Schwer beladen, wie die Gjöa war, ging es nicht sehr schnell vorwärts. Da alles zum Voraus seeklar gemacht worden war, konnten wir sogleich unseren festen Dienst antreten. Die Wache wurde bestimmt und die Freiwache zog sich zurück. Wie herrlich war es! Kein Umtrieb, keine widerwärtigen Gläubiger, keine langweiligen Menschen mit schlechten Prophezeiungen oder zum Mindesten mit spöttischen Gesichtern … Nur wir sieben vergnügten, zufriedenen Menschen, die da waren, wo sie sein wollten, und nun in froher Hoffnung und festem Glauben der Zukunft entgegensteuerten. Der Welt, die so lange düster und traurig vor mir gelegen hatte, sah ich jetzt wieder mit Mut und Lust entgegen.
Der Leuchtturm von Lister war das Letzte, was wir vom Festland sahen. In der Nordsee jagten ein paar Windstöße daher, die für die nicht Seefesten unter uns weniger behaglich waren. Die Hunde waren jetzt losgebunden und liefen frei umher. An den Tagen, wo die See hochgeht und die Gjöa schlingert – denn das kommt vor –, laufen sie von einem zum anderen und studieren unsere Mienen. Die ihnen zugemessene tägliche Kost – ein getrockneter Fisch und ein Liter Wasser – befriedigt ihren Appetit durchaus nicht, und sie versuchen es daher auf alle mögliche Weise, sich eine Extramahlzeit zu ergattern. Alle miteinander sind alte Bekannte, und sie kommen ziemlich gut miteinander aus, wenigstens was den männlichen Bestand anbetrifft. Bei den beiden Damen – Karli und Silla – hält dies schwerer. Karli ist die Ältere von den beiden, und sie verlangt unbedingten Gehorsam, worein sich Silla, die ja auch schon eine erwachsene Dame ist, sehr schwer findet. Die beiden liegen sich daher gar nicht selten in den Haaren. Ola, der als Oberhaupt anerkannt wird, sucht diese Art Kämpfe so viel wie möglich zu verhindern. Es ist ein unbezahlbarer Anblick, wenn der alte Ola – klug, wie ich nur wenige Hunde gesehen habe – mit diesen zwei Hündinnen, einer auf jeder Seite, umherspringt und einen Kampf zwischen ihnen zu verhindern sucht.
Das tägliche Leben geht bald seinen gewiesenen Weg, und jeder von den Teilnehmern macht den Eindruck, als passe er gerade für den ihm zuerteilten Posten ausgezeichnet. Wir haben eine kleine Republik auf der Gjöa eingerichtet. Es gibt da keine strengen Gesetze, denn ich weiß selbst, wie unangenehm einen eine solche strenge Disziplin anmutet in dem Augenblick, wo man sich auf offener See befindet. Man kann sehr gut seine Arbeit leisten, auch wenn die Rute der Disziplin nicht immer drohend geschwungen ist.
Meinen eigenen Erfahrungen gemäß hatte ich beschlossen, so weit wie möglich an Bord Freiheit walten zu lassen – jeder sollte das Gefühl bekommen, dass er in seinem eignen Bereich unabhängig sei. Dadurch entsteht – bei vernünftigen Leuten – von selbst eine freiwillige Disziplin, die einen viel größeren Wert hat als die erzwungene. Dabei bekommt jeder Einzelne das Bewusstsein, ein Mensch zu sein, mit dem man als mit einem denkenden Wesen rechnet, und nicht nur wie mit einer Maschine, die aufgezogen wird. Die Arbeitslust wird vervielfacht, und damit die Arbeit selbst. Ich möchte das auf der Gjöa angewendete System jedermann empfehlen.
Meine Gefährten schienen dieses Vorgehen auch sehr zu schätzen, und die Überfahrt auf der Gjöa glich viel eher einer Ferienreise von Kameraden als der Einleitung zu einem ernsten, jahrelangen Kampf.
Am fünfundzwanzigsten Juni fuhren wir zwischen Fair Isle und den Orkney-Inseln hinaus in den Atlantischen Ozean.
Und nun hätten sie uns sehen sollen – die vielen, die uns hier schon den Untergang prophezeit hatten! Mit vollen Segeln und einer frischen Brise aus Südost ging es mit Windeseile westwärts. Sie tanzte auf den Wogenkämmen – die Gjöa –, sie wetteiferte an Schnelle mit den Möwen!
Übrigens zeigte sich merkwürdig wenig Leben in unserem Fahrwasser. Wir sahen weder Vogel noch Fisch, von Schiffen überhaupt nicht zu reden. Seitdem wir bei Lister gepeilt hatten, war nur einmal ein Vollschiff in der Ferne aufgetaucht.
Der Motor war uns mehrere Mal sehr nützlich. Ich hatte bestimmt, dass er in Gang gesetzt werden solle, sobald der Wind so abflaute, dass wir weniger als zwei Knoten in der Stunde zurücklegten.
Übrigens mussten wir sehr auf einen sparsamen Verbrauch des Petroleums bedacht sein, da wir ja nicht wissen konnten, wie lange die Reise dauern würde.
Es war jetzt alles in Ordnung gekommen und ging seinen ruhigen Gang. Der ganze Tag war in vier sechsstündige Wachen eingeteilt, immer drei Mann auf jeder Wache. Der Dienst war unter allen gleichmäßig verteilt. Wenn der Motor im Gang war, blieben die Maschinisten meistens im Maschinenraum. Doch waren sie jederzeit bereit, uns Deckleuten, wenn es nottat, hilfreiche Hand zu leisten. Den alten Streit zwischen Deck- und Maschinenleuten gab es auf der Gjöa nicht. Wir arbeiteten alle für ein gemeinsames Ziel und nahmen willig und gerne an allem teil. Gewöhnlich waren zwei Mann auf Deck und wir teilten uns gleichmäßig in die Führung des Steuers.
Ende Juli stellte sich unter den Hunden eine Krankheit ein. Augenscheinlich wurde ihr Verstand zuerst angegriffen; sie wanderten teilnahmslos auf dem Verdeck umher und sahen und hörten nicht. Das Futter schmeckte ihnen nicht oder sie fraßen auch gar nichts. Nachdem dies ein paar Tage gedauert hatte, wurden sie im Hinterteil gelähmt und konnten sich nur noch mit großer Mühe weiterschleppen. Schließlich stellten sich Krämpfe ein und dann erlösten wir sie vollends mit einer Kugel. Auf diese Weise verloren wir zwei prächtige Tiere – Karli und Josef –, übrigens zur großen Freude von Silla, die nun die einzige Henne im Korb war.
Unsere Fahrt wurde die ganze Zeit so viel wie möglich nach dem Großkreis geführt. Das Wetter war bisher günstig und unsere Fahrt tadellos gewesen. Am fünften Juli hatten wir einen kleinen Sturm aus Südsüdost. Wir hatten gereffte Segel und durchschnitten das Wasser mit einer Geschwindigkeit von zehn Meilen. Der große Luvbaum war gut abgefiert und Stopper aufgesetzt. Es regnete sacht, als ich mich am Abend in meine Koje legte. Nachts um ein Uhr sprang der Wind nach Osten um, dadurch stürzte das Großsegel herab. Der Baumstopper zerbrach und der Luvbaum flog mit furchtbarer Kraft daher. Dies hätte ernsthafte Folgen haben können, aber in dem Augenblick, wo der Stopper brach, zerbrach bei allem Unglück zum guten Glück auch der Karveelnagel, wodurch der Piekfall festgemacht wurde, und zwar mit dem Erfolg, dass der Piek sich von selbst bog und den Stoß dämpfte, der uns sonst unseren Baum hätte kosten können. Dies war ein verhältnismäßig billiges Lehrgeld. Von da an waren wir bei Nacht vorsichtiger.
Unsere vier überlebenden Hunde begannen indes, sich sichtbar zu langweilen. Im Anfang konnten sie Wind und Wetter studieren und damit die Zeit totschlagen; aber jetzt wirkten die meteorologischen Zerstreuungen nicht mehr zerstreuend, und deshalb suchten ihre Gedanken sich ein neues Feld. Müßiggang ist aller Laster Anfang, sagt das Sprichwort, und dieser Ausspruch passt ebenso gut für Tiere wie für Menschen. »Lurven« und »Bismarck«, die bis dahin »Ola« ganz ergeben und untertänig gewesen waren, fingen jetzt an, sich zu widersetzen und den Gehorsam zu verweigern. Das heißt, Lurven – der in Wirklichkeit von Geburt an böse war – stachelte Bismarck auf. Dieser war ein großer prächtiger Hund von ungefähr zwei Jahren mit dem herrlichsten Kauwerkzeug, das man je gesehen hat. An Olas Zähnen hatte das Alter seine Spuren hinterlassen, sie waren ziemlich schlecht.
Als früherer Anführer umgab ihn allerdings eine gewisse Würde, und die anderen bedachten sich zweimal, ehe sie ihn angriffen. Lurven indes spielte seine Rolle ausgezeichnet. In sausendem Galopp fuhr er in gerader Richtung auf Ola los. Bismarck, der glaubte, es handle sich um einen Sturmlauf, schloss sich seinem Kameraden sogleich an, um ihm beizustehen. Ganz dicht vor Ola angekommen, hält Lurven plötzlich inne, worauf Bismarck, der nicht auf diese List vorbereitet ist, in des Feindes Rachen läuft. Er bekam dann auch regelmäßig ordentlich Schläge von dem erfahreneren Ola.
Lurven war der boshafteste von allen Hunden, die mir je begegnet sind. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er mit seinem etwas schiefen Kopf und den kleinen schielenden Augen, den Schwanz nach der einen Seite hinausgestreckt, über das Deck hinjagt, als sei er auf einen neuen Streich aus. Er wurde wegen seiner schlechten Streiche sehr oft von uns durchgewalkt und verlegte seine Taten deshalb gern auf eine Zeit, wo er weniger unter Aufsicht war. Wenn wir zum Beispiel an den Segeln beschäftigt waren, konnten wir eines Kampfes sicher gewärtig sein. In der Dunkelheit und Stille der Nacht, wenn Lurven die beiden aufeinandergehetzt hatte, benutzte er oft die Gelegenheit, Ola in den Rücken zu fallen, und dann konnte der Alte nicht allein fertig werden. Armer Ola! Bei diesen nächtlichen Kämpfen wurde er oft böse zugerichtet. Silla sprang bei solchen Gelegenheiten rings um die Kämpfenden herum; sie vollführte allein einen Spektakel, der den der beiden anderen ganz übertäubte, und biss diese auch von Zeit zu Zeit in die Beine.
Es regnete unentwegt weiter, und wir sammelten das Regenwasser in alle unsere Gefäße, als Waschwasser für uns und als Trinkwasser für die Hunde. Aber für gewöhnlich wuschen wir uns mit Seewasser und konnten es da nicht so genau mit der absoluten Reinlichkeit nehmen.
Von jetzt an hielten wir scharfen Ausguck nach Eis, und am neunten Juli entdeckten wir zwei schmale Streifen, die in der See auf und ab wogten; da wussten wir, dass wir nun bald die Hauptmasse des Eises erwarten konnten. Und ganz richtig, nicht lange danach hatten wir das Packeis mächtig und fest vor uns! In dessen Gefolge kam der Nebel, der treue Begleiter des Eises, der uns während eines großen Teils unserer Reise in den arktischen Gewässern Gesellschaft leistete.
Am elften Juli um halb drei Uhr nachmittags bekamen wir Land in Sicht, etwas westlich vom Kap Farewell. Die hohe zerrissene Felsenküste war ein prächtiger Anblick. Es sah aus, als reiche das Eis bis dicht an das Land heran. Dem Rat der schottischen Walfischfänger Milne und Adams gemäß hielt ich mich weit von der Küste entfernt, um nicht in das Eis hineinzugeraten. Am Dreizehnten begegneten wir den ersten Eisbergen, zwei einsamen Majestäten. Die unter uns, welche noch keine solchen Kolosse gesehen hatten, waren natürlich sehr erregt, und die Fernrohre wurden fleißig benützt.
Beim Anblick des Eises begann sich in den meisten von uns das Jägerblut zu regen. Durch die Ferngläser wurde nach möglicher Beute gespäht, und allerlei Bärenjagdgeschichten waren sehr häufig der Gegenstand der Unterhaltung … Selbstverständlich stand Freund Petz in aller Erwartung obenan, aber nichtsdestoweniger hätte man auch eine »Klappmütze« – die großen prachtvollen Seehunde, die man an den grönländischen Küsten im Eis antrifft – freundlich empfangen. Zwei unserer gewaltigsten Nimrode ließen sogar etwas von der Möglichkeit, einen Walfisch zu morden, verlauten.
Am fünfzehnten Juli endlich konnten die Herren Jäger ihr Mütchen kühlen. Wir fuhren an diesem Tag eine kleine Strecke zwischen das Eis hinein und schossen vier große Klappmützen. Das frische Fleisch mundete uns allen herrlich! Und Lindströms Beredsamkeit floss über von Roulade, Sülze und Würsten, dass allen Bewohnern der Gjöa das Wasser im Mund zusammenlief. Er erzählte von seinen kulinarischen Taten als Küchenchef auf der »Fram«. Leider bewegten sich seine Reden nur in der Vergangenheit, während wir auf seine Taten in der Gegenwart warteten und hofften. Vorläufig freilich vergebens! Nun – Ehre sei dem Gjöa-Koch! Er hat uns trotzdem manches gute Beefsteak vorgesetzt!
Doch nicht allein den Menschen mundet das frische Fleisch gar köstlich, die Hunde liefern alle erdenklichen Beweise, dass auch sie keine Kostverächter sind. Sie fressen sich toll und voll, ihre Leiber stehen hervor wie ausgestopfte Ballons, und namentlich Lurven zeichnet sich dabei aus. Er zeigt sich jetzt als ein besonderes Ferkel, und sein ganzer Körper ist mit Fett und Blut eingeschmiert. Das auf der Wache hart arbeitende Reinigungsamt ist nach solchen Festmahlzeiten vollauf beschäftigt. Jeder Seemann kennt diese Seite der Sache, dass man Hunde an Bord hat. Man denke sich dann vier auf einmal, die aller Stubendressur bar sind!
Am nächsten Tag waren wir wieder im Eis drin und schossen noch sieben Seehunde.
Während dieser Zeit der Seehundjagd sind die Harpunen und Messer in voller Tätigkeit. Unser erfinderischer Maschinist ist indes so schlau gewesenen, der mit der Transmission in Verbindung stehenden Lotmaschine einen Schleifstein anzubringen, der nun das Schleifen ganz allein besorgt.
Lindström findet, Seehundleber sei der delikateste Leckerbissen, den es gebe, und er bewirtet uns früh und spät damit. Sie schmeckt übrigens auch gar nicht schlecht. Als wir uns der »Kleinen Hellefiskbank« näherten, setzte der Maschinist, der ein ebenso eifriger Fischer wie Jäger ist, seine Fischgeräte instand und richtete sich droben im Heckboot ein, von wo aus er das Fischen im großen Stil betrieb. Er war selbst sehr hoffnungsvoll und wurde darin von dem Koch unterstützt, während wir anderen uns etwas skeptisch verhielten. Groß war daher sein Triumph, als er eines Morgens wirklich einen kleinen Heilbutt fing, der uns übrigens herrlich schmeckte.
Am zwanzigsten Juli bekamen wir den »Sukkertoppen« (Zuckerhut) in Sicht. Übrigens behält die Küste ihren Charakter mit hohen zerrissenen Gipfeln bei. Sonst war es hier lebendiger – mit ganzen Schwärmen von Walfischen dicht vor uns. Das Wetter war in der Nähe des Landes auch besser als weiter draußen; bei einer leichten Brise aus Süden blieb es hell und klar. Die Temperatur des Wassers stieg bis zu vier Grad Celsius. Eis sahen wir merkwürdigerweise gar keines, obgleich man hätte denken sollen, der beständige Nordwind, den wir die ganze Zeit entgegen gehabt hatten, hätte eine Menge Eis südwärts getrieben. Es war vielleicht gar kein Eis mehr da –?
Jetzt machten wir zum ersten Mal die Entdeckung, dass wir uns nicht mehr auf den Kompass verlassen konnten. Dies ist überhaupt an der Westküste von Grönland eine recht wohlbekannte Erscheinung. Noch weiter draußen im Meer ist er dagegen ganz zuverlässig. Die Ursache davon sind wahrscheinlich die stark eisenhaltigen Gebirge.
Der vierundzwanzigste Juli war ein wundervoller Tag, ganz still und leuchtend hell. Es war seit unserer Abreise der erste wirkliche Sommertag. Wir benutzten diese Gelegenheit, um alles Brot, das wir in neubackenem Zustand von zu Hause mitgenommen und drunten im Schiffsraum ausgebreitet hatten, an die Luft zu bringen. Ein großer Teil davon war verdorben, aber wir schnitten das Verschimmelte weg und lüfteten das andere, sooft es angezeigt schien.
»Segel voraus!«, ertönte es plötzlich. Und da wird es lebendig an Bord! Alle Ferngläser – und wir haben viele auf der Gjöa – werden herausgeholt.
»Ein Vollschiff!«, heißt es.
»Oh nein, wir begnügen uns mit einem Schoner!«, denke ich.
»Ich sehe ganz deutlich, dass es eine Brigg ist!«
»Wahrscheinlich ist es eines der königlich-dänischen Grönlandhandelsschiffe, das auf dem Heimweg ist!«
»Da ist noch eins!«, rief einer von uns, mit dem Fernrohr vor dem Auge.
Na, es begann ja ordentlich bevölkert zu werden hier draußen in der Eiswüste! Wir wandern auf Deck hin und her und plaudern seelenvergnügt darüber, welch eine Überraschung wir für die Entgegenkommenden sein würden. Ich kann auch nicht leugnen, dass wir das Deck ein klein wenig festlich herrichteten … Es könnte ja Besuch kommen!
Dann wird ein Fernrohr auf endgültig bestimmte Weise zusammengeklappt und dazu erhebt sich ein schallendes Gelächter.
»Nanu –?«
»Meine Herren«, sagt Leutnant Hansen, »es sind Eisberge.«
Empörter Widerspruch unsererseits; man späht aus und disputiert, und indessen nähern wir uns dem streitigen Gegenstand immer mehr. Die Aufregung verschwindet, das Vollschiff wird aufgegeben, die Brigg desgleichen. Der Schoner hat noch einen Anhänger, bis wir so weit herangekommen sind, dass wir vor uns eine große Ansammlung von Eisklippen haben, die auf dem Grund von der »Großen Hellefiskbank« zu stehen scheinen.
Etwas später am Vormittag bekamen wir die Insel Disko in Sicht, hoch und oben abgedacht und aus weiter Ferne leicht erkennbar. Aber es ist ein weiter Weg bis zu ihr hin. Um acht Uhr abends waren wir noch dreißig Seemeilen entfernt und erst um halb elf Uhr am nächsten Vormittag erreichten wir das Land. Eine Reihe fest stehender Eisklippen sah aus, als wollte sie die Einfahrt zu dem dahinter liegenden Godhavn absperren. Aber bald kam der Kolonievorstand Nielsen mit einem Boot zu uns heraus, uns willkommen zu heißen und hereinzulotsen.
Schwere Windstöße fuhren uns entgegen, und wir mussten hineinkreuzen, da der Motor uns nicht allein weiterbrachte. Nachts um ein Uhr warfen wir den Anker aus.
Godhavn liegt auf einer kleinen, niedrigen Insel, die von der Insel Disko durch einen ganz schmalen Sund getrennt ist. Die Ortschaft zählte im Jahre 1903 hundertundacht Seelen und sie ist der Wohnsitz des grönländischen Inspektors. Sie liegt außerordentlich schön da mit dem mächtigen hohen Disko im Norden sowie im Süden wie im Westen das Meer, das von Zeit zu Zeit mit gewaltigen Eisbergen angefüllt ist.
Wir machen sofort Besuch bei den Spitzen des Ortes, dem Inspektor und dem Kolonievorstand. Schon im vergangenen Jahr hatte ich mit Herrn Inspektor Daugaard-Jensen in Briefwechsel gestanden, und er hatte versprochen, mir zehn Schlittenhunde mit allem Zubehör zu verschaffen. Er empfing uns mit großer Liebenswürdigkeit und konnte uns mitteilen, dass alles wohlbehalten angekommen sei – Schlitten, Kajaks, Ski, zwanzig Fass Petroleum und so weiter … Der königlich-dänische Grönlandhandel war so entgegenkommend gewesen, diese ganze Ausstattung auf einem seiner Schiffe hierher zu befördern. Ich schulde Herrn Direktor Rydberg und dem Herrn Bureau-Vorsteher Krenchel warmen Dank für die ausgezeichnete Behandlung, die der Gjöa-Expedition vonseiten des Grönlandhandels zuteilwurde.
Godhavn mit der Insel Disko im Hintergrund
Kolonievorstand Nielsen war in jeder Beziehung unermüdlich dienstfertig. Wir Expeditionsleute teilten uns sogleich in zwei Parteien, von denen die eine die notwendigen Beobachtungen vornehmen sollte, während die andere alle Arbeit an Bord besorgte. Leutnant Hansen stand den astronomischen, Wiik den magnetischen Beobachtungen vor. Lund und Hansen sollten alles an Bord befördern und außerdem das Schiff zur Fortsetzung der Reise klarmachen. Ristvedt eilte hin und her und hatte alle Hände voll zu tun. Bald musste er dem Astronomen, bald dem Magnetiker den Chronometer ablesen, bald war er im Schiffsraum und untersuchte die Wasserbehälter, bald bei den Maschinen und zapfte Petroleum ab.
Es war eine arbeitsreiche Zeit! Aber wie auch alles vorwärtsging! Alle schienen von demselben Drang beseelt zu sein, die Arbeit gut auszuführen, damit wir sobald wie möglich klar wären und dann keine Zeit oder Gelegenheit zur Weiterfahrt versäumen müssten.
Lindström verstand die ganze Maschinerie zu schmieren, und zwar auf seine Weise. Er war überall unterwegs, kaufte und handelte mit den Eskimos, bald um einen gesalzenen, bald um einen frischen Lachs, bald um einen Eidervogel, bald um eine Lumme. Und in dieser Zeit war demgemäß der Speisezettel sehr abwechslungsreich.
Lindströms Münze dafür waren Bäcker Hansens schimmlige Honigkuchen aus Kristiania. Und wenn sie auch nicht klingend, ja nicht einmal ganz gut waren – so waren sie doch sowohl rund als auch gangbar.
Wenn ein Eskimo zum Handeln auf dem Schiff erschien, wurde Lindström auf Deck geholt. Die Verhandlungen wurden in der Eskimosprache und auf gut Nordländisch-Norwegisch geführt. Die Entgegnungen fielen von beiden Seiten umständlich aus, vonseiten der Eskimos aber fast immer demütiger und ängstlicher, angesichts des väterlich herablassenden, nichts auf der Welt vermissenden oder sich wünschenden Lindström.
Wir, die wissen, dass unser lieber Koch keine Ahnung von einem einzigen Wort der Eskimosprache hat, versammeln uns um das Paar und können uns kaum das Lachen verbeißen. Wenn dann die Verhandlungen eine Weile gedauert haben, macht Lindström das Zeichen plötzlich aufdämmernden Verstehens und verschwindet im Schiffsraum. Selbstbewusst und vergnügt kehrt er zurück – unter jedem Arm einen schimmligen Honigkuchen. Der Eskimo betrachtet ihn mit den Zeichen lebhaftesten Erstaunens. Für seinen Lachs hat er nämlich Tabak verlangt. Aber bei dem Versuch, Lindström seinen Irrtum begreiflich zu machen, stößt er auf eine freigebige, herablassende, schulterklopfende Unempfänglichkeit. Lindström nimmt den Lachs, der Mann bekommt die Kuchen – und die Sache ist erledigt. Das Nachspiel ist aber vielleicht doch noch das Netteste vom Ganzen, nämlich Lindström erzählen zu hören, dass er selbstverständlich jedes Wort des Eskimos verstanden habe; »aber als dieser drei Kuchen verlangte, da habe ich getan, als ob ich ihn nicht verstände, und ihm nur zwei gegeben«. Ich hatte einen lästerlichen Verdacht, dass der Eskimo mehr als einmal mit seinen Kuchen zu den Seinigen zurückkehrte und – unzweifelhaft mit größerem Recht – vor diesen behauptete, dass er »getan habe, als habe er nicht verstanden«!
Der Aufenthalt auf Godhavn war von Anfang bis Ende äußerst angenehm. Die Hauptplage dort waren die Mücken, die uns in dem Grade bei der Arbeit quälten, dass wir uns oft mittendrin in die Kajüte flüchten mussten, nur um etwas Ruhe vor ihnen zu bekommen.
Am einunddreißigsten Juli waren wir fertig. Die verschiedenen Beobachtungen waren aufgenommen und die ganze Ausstattung war an Bord gebracht. Da wir uns sowieso schon verspätet hatten, mussten wir uns jetzt beeilen. So verabschiedeten wir uns denn von den liebenswürdigen Menschen in Godhavn und lichteten den Anker. Der Inspektor, der Kolonievorstand und der Assistent begleiteten uns zum Sund hinaus. Die öffentlichen Gebäude hatten beflaggt und die »Batterie« auf dem Hügel schickte uns einen »Salutschuss« nach. In den Schären verabschiedeten wir uns endgültig von unseren Freunden, winkten der gastfreien dänischen Flagge noch einmal zu – und dann waren wir uns wieder selbst überlassen. Gleich vor dem Sund draußen trafen wir unseren alten Bekannten, den Nordwestwind, und mussten sogleich kreuzenderweise weiterfahren.
Das Parry-Riff war auf unserer Karte unrichtig angegeben und wir wären beinahe darauf losgefahren. Glücklicherweise sahen wir aber das Aufschlagen der Wogen und konnten noch beizeiten wenden. Dieses Riff ist ganz niedrig und gleicht zum Verwechseln dem Rücken eines Walfischs.
Während des Aufenthalts in Godhavn hatte ich jedem von den Teilnehmern an der Expedition von unseren dicken wollenen Unterkleidern, Islandjacken und Nansenkleidern ausgeteilt; wir waren also wohlvorbereitet auf das Eis. Die meisten von uns hatten sich überdies auch Anzüge aus Seehundfellen eingetauscht.
Am sechsten August waren wir dwars vor Upernivik, in zwölf Seemeilen Entfernung. Hier hatten sich Hunderte von Eisbergen gesammelt, die größer und gewaltiger aussahen, als die wir südlich davon getroffen hatten. Treibeis sahen wir noch keines, und wir begannen schon zu hoffen, wir könnten am Ende ungehindert in die Melville-Bucht hineingelangen.
Am nächsten Tag fuhren wir an Itivdliharsuk vorüber auf 73° 30’ nördl. Breite – dem nördlichsten von zivilisierten Menschen bewohnten Ort. Am achten August waren wir bei der Insel Holms und sollten da die Fahrt über die Melville-Bucht antreten. Dies ist die gefürchtetste Strecke in diesem Teil des Arktischen Ozeans. Gar viele Schiffe haben hier ihre letzte Reise gemacht. Doch sind diese Verhältnisse meistens nur früher im Jahr so besonders gefährlich. Im Juni und Juli, wenn das Eis aufgeht und die Walfischfänger nordwärts ziehen – es handelt sich ja darum, der Erste auf dem Platz zu sein –, müssen sie oft schwere Kämpfe mit dem Eis bestehen. Der äußere Teil des Eises in der Bucht geht zuerst auf, der innere Teil bleibt ganz liegen, und dieses Eis führt den Namen Land- oder Festeis. Dem Rand dieses Eises entlang suchen die Walfischfänger vorwärtszukommen, und die Vernünftigen unter ihnen lassen es auch nicht los, bis sie auf der Nordseite der Bucht im offenen Wasser angelangt sind. Am Rand des Festeises bilden sich häufig natürliche Docks, wo hinein sich die Schiffe, wenn das Treibeis daherkommt, flüchten und retten können. Wenn kein natürliches Dock da ist, haben die meisten Walfischfänger Mannschaft genug, sich in verhältnismäßig kurzer Zeit selbst ins Eis hineinzuarbeiten. Die Schottländer sind es, die diese Gewässer beherrschen, und die schottischen Walfischfänger haben sich – darüber kann kein Zweifel bestehen – unter den gefährlichen und schwierigen Verhältnissen zu den tüchtigsten Eismeerfahrern unserer Zeit ausgebildet.
Bei der Insel Holms richteten wir den Kurs auf Kap York. Die Verhältnisse sahen sehr günstig aus. Kein Festeis war zu erblicken, und so weit das Auge reichte, war die Melville-Bucht von Eisbergen und Blockeis, das heißt Stücken von Eisbergen, angefüllt.
Um drei Uhr nachmittags passierten wir den bekannten Wegweiser »des Teufels Daumen«, einen Felsengipfel, der einem alten knochigen, aufgehobenen Daumen so treffend ähnlich sieht, dass wir bei seinem Anblick alle in helles Lachen ausbrachen.
Jetzt hissten wir alle Segel und ließen den Motor mit voller Kraft arbeiten. Es galt, so schnell wie möglich über die Bucht hinüberzukommen; da durfte nichts gespart werden. Aber leider sollte unser direkter Kurs auf Kap York nicht von langer Dauer sein. Schon am nächsten Morgen wurden wir vom festen Packeis aufgehalten.
Im Lauf der Nacht hatte sich einen Viertelzoll dickes Neueis gebildet – und wir mussten nun, wie so viele andere vor uns – in den sauren Apfel beißen und südwärts fahren. Vorher fuhren wir aber doch zuerst eine Strecke zwischen das Eis hinein, um es ein wenig näher zu betrachten. Glatte Flächen und scharfe Kanten deuteten darauf hin, dass es erst kürzlich aufgebrochenes Landeis war; wir hatten uns also wahrscheinlich zu nahe an Land gehalten. Jetzt fuhren wir südwärts daran vorbei. Vor uns gegen Südwesten ragte eine Eiszunge ins Meer herein. Die Luft darüber war dunkel und ließ auf offenes Wasser schließen. Indessen legte sich hinter dieser Zunge jenseits einer großen, mit Schlackeis gefüllten Bucht eine zweite solche Eiszunge vor. Wir versuchten in diese Bucht einzudringen, aber bald verdichtete sich das Eis und zwang uns zur Umkehr. Weiter draußen war das Eis bedeutend schwerer, und es sah aus, als befänden wir uns gerade auf der Grenze zwischen dem neu aufgebrochenen Landeis und dem Treibeis. Ich entschloss mich daher, hier fortgesetzt hin- und herzufahren, hier, wo sich jetzt wahrscheinlich jede Veränderung im Eis gleich zeigen würde.
Und ganz richtig! Um Mitternacht wurde das Eis weicher und wir konnten ohne besondere Mühe hindurchfahren. Zugleich setzte ein dichter, undurchdringlicher Nebel ein. Wer den Eisnebel des Polarmeers nicht gesehen hat, weiß nicht, was Nebel ist. Selbst der Londoner Nebel ist nichts dagegen. Wir konnten nicht so weit wie die Länge des Schiffes sehen. Aber wir richteten uns in unserem Kurs nach dem Kompass und das Eis machte uns höflich Platz. So gelangten wir durch den feuchten Brei hindurch; aber wenn mich jemand über die Eisverhältnisse dieses Teils der Melville-Bucht befragen wollte, dann könnte ich ihm keinerlei Auskunft darüber geben. Die Einförmigkeit wurde ab und zu durch einen Seehund unterbrochen, der sofort sein Leben lassen musste. Wir schwelgten in frischem Seehundfleisch. Die ganze Zeit hatten wir noch keinen Vogel gesehen, aber gerade jetzt kamen große Scharen von Krabbentauchern daher – zu Tausenden flogen sie an uns vorüber. Einen großen Vorteil hat man im Treibeis, nämlich Überfluss an Wasser. Beinahe auf jeder Scholle sind Tümpel voll des herrlichsten Trinkwassers, ja wir erlaubten uns sogar den Luxus, uns in Süßwasser zu waschen und zu baden.
Am dreizehnten August morgens halb drei Uhr stand ich schaudernd und frierend am Steuer – nachdem ich um zwei Uhr abgelöst hatte. Als Polarfahrer sollte ich das vielleicht nicht gestehen, aber ich fror nun eben doch. Meine beiden Wachkameraden gingen auf dem Deck umher und versuchten sich warmzuhalten, so gut es ging. Der Nebel senkte sich herab und machte alles, womit er in Berührung kam, tropfnass. Im Ganzen war es zu so früher Morgenstunde ein recht miserables Dasein. Die abgelöste Wache saß jetzt drunten bei einem dampfend heißen Kaffee – den sie nach einer sechsstündigen Anstrengung wohlverdient hatte.
Plötzlich drang ein Lichtschein durch den Nebel. Und wie mit einem Zauberschlag öffnete sich vor mir eine weite Aussicht in strahlende Tageshelle hinein; gerade vor uns – und anscheinend ganz nahe – lag die wild zerrissene Landschaft von Kap York, die bei ihrem plötzlichen Auftauchen wie ein verlockendes Märchenland erschien.
Wir schrien alle laut auf vor Entzücken und Verwunderung. Die Freiwache ließ ihren Kaffee stehen und bald standen wir alle miteinander in stiller, hingerissener Beschauung da. Der Morgen war so glänzend, so übernatürlich klar, dass wir meinten, wir müssten Kap York in ein paar Stunden erreichen können. Und es war doch vierzig Seemeilen entfernt. Im Osten lag das ganze Innere der Melville-Bucht vor uns. Ganz drinnen in der Tiefe konnten wir einzelne hohe Felsengipfel sehen. Eine undurchdringliche Eismasse füllte die Bucht, mächtige Eisgebirge ragten da und dort aus der Masse heraus.
Als wir uns endlich umwendeten, lag der Nebel, aus dem wir plötzlich entschlüpft waren, dicht wie eine Mauer hinter uns.
Das war eines der Wunder, die man nur im Reich des Eises erlebt; sie bleiben einem unvergesslich und üben einen solchen Zauber, dass man sich danach sehnt und sich dahin zurückwünscht – trotz aller Entbehrungen und aller Mühe.
Die Eisverhältnisse unserer Kursrichtung sahen vielversprechend aus. Allerdings lag noch etwas Eis luvwärts, aber wir achteten weiter nicht darauf. An demselben Tag, gerade um Mittag, schloss sich das Eis zusammen, sodass nur eine ganz kleine Rinne gegen Norden blieb. Wir waren da noch fünfundzwanzig Seemeilen vom Kap York entfernt. Doch das Eis vor uns wurde wieder weicher – wie wenn sich der Weg vor uns ebnete – und um fünf Uhr nachmittags erreichten wir die feste Eiskante von Kap York. Wir fuhren diese eine Strecke entlang mit Kurs auf Kap Dudley Digges. Da der Nebel sich nun wieder einstellte, legten wir am Eis an, um zu warten, bis er sich lichte. Zwei von unseren Jägern benützten die Gelegenheit; sie nahmen ein Boot und machten Jagd auf Krabbentaucher. Nach ein paar Stunden kehrten sie mit so viel Vögeln zurück, dass es für eine Mahlzeit reichte. Sie schmeckten wie die delikatesten Krammetsvögel – und es ist merkwürdig, wie esslüstern man auf so einer Eismeerfahrt wird!
Beim Quartierwechsel am nächsten Morgen klärte sich das Wetter auf. Die nächsten Umgebungen waren dicht mit Eis bepackt. Dagegen erstreckte sich eine Seemeile südwärts eine große, breite Wake, und so ungern ich zurückfuhr, fand ich das hier doch am ratsamsten. Nach vieler Mühe gelangten wir in die Wake. Diese öffnete sich nach Westen weiter und weiter: Es war nicht daran zu zweifeln, dass sie in offenes Wasser hinausführte. Um halb vier Uhr waren wir dann auch in eisfreiem Meer.
Die Melville-Bucht war besiegt. Wir hatten allen Grund, vergnügt zu sein. Diese Meeresstrecke hatte immer als der schwierigste Teil der ganzen Nordwestpassage vor mir gestanden – das heißt, mit so einem kleinen Schiff wie dem unseren. Und jetzt waren wir ohne Missgeschick hindurchgekommen.
Am fünfzehnten August nachmittags vier Uhr erreichten wir Dalrymple Rock, wo die Kapitäne der schottischen Walfischfänger, die Herren Milne und Adams, ein bedeutendes Depot für uns errichtet hatten. Dalrymple Rock ist nach den Beschreibungen leicht zu erkennen; er steigt in Kegelform jäh aus dem Meer auf. Wenn man wie wir von der Ostseite von Wolstenholme kommt, erblickt man zuerst eine andere im Norden vorgelagerte Insel. Dies ist die Eidervogelinsel. Auf dieser Insel und auf Dalrymple Rock sammeln die Eskimos jedes Jahr eine Menge Eier.
»Zwei Kajaks voraus!«, brüllte plötzlich der Mann im Mastkorb.
In einem Nu waren alle Mann auf Deck. Ich ließ die Maschinen halten und die Kajaks wurden an Bord genommen. Wir waren sehr begierig, diese nordgrönländischen Eskimos, von denen man sich wunderliche Dinge erzählt, kennenzulernen. Es waren recht gut aussehende Männer. Ihre Kleidung erschien uns freilich im Anfang etwas auffallend; einen ungeheuren Jubel erregte es besonders, als einer von ihnen sich bückte, um ein Messer aufzuheben, das ihm entfallen war, und dabei einen großen Teil seiner Sitzgelegenheit entblößte. Eine feine Art, sich zu verbeugen! Sie waren überaus lebhaft, schrien durcheinander, fochten und gestikulierten mit den Armen. Sie hatten uns offenbar etwas ganz Besonderes zu berichten. Aber wir verstanden ja natürlich keinen Deut davon. Da verzog endlich der eine plötzlich seinen Mund zu einem breiten Grinsen und sagte: »Mylius!«
Und damit ging uns ein Licht auf. Nun errieten wir, was er meinte. Die so genannte dänische literarische Grönlandexpedition unter Mylius Erichsen musste in der Nähe sein. Nach dem, was wir über sie wussten, hatten wir sie unter den Eskimos bei Kap York vermutet.
Kaum war der Name ausgesprochen, da ertönte hinter einem hohen Eiskoloss hervor lautes Schießen und Knallen wie bei einer wirklichen Schlacht, und von dorther kamen blitzschnell sechs Kajaks gefahren. Einer war mit einer kleinen norwegischen Flagge geschmückt und ein anderer mit einer dänischen. Das war in Wahrheit eine frohe Überraschung!
Bald hatten wir den Führer der Expedition, Herrn Mylius Erichsen, und einen der Teilnehmer, Herrn Knut Rasmussen, sowie vier Eskimos an Bord. Sie wurden aufs Freundlichste begrüßt und ausgefragt. Fragen und Antworten klangen in froher Verwirrung durcheinander, und es dauerte eine gute Weile, bis wir uns beiderseitig so weit beruhigten, dass wir einander ordentlich Rede stehen konnten. Unsere größte Sorge galt dem Depot, und zu unserer ungeheuren Erleichterung erfuhren wir, dass es in schönster Ordnung sei.
Abends um sieben Uhr erreichten wir Dalrymple Rock. Es ist kein Hafen auf der kleinen Insel; wir lagen also ohne jeglichen Schutz da. Ich fuhr indes sogleich mit Lund ans Land, um das Depot in Augenschein zu nehmen und zu entscheiden, wie die Überführung an Bord bewerkstelligt werden sollte. Herr Mylius Erichsen übergab mir einen Brief von den Herren Milne und Adams, worin sie uns alles Glück auf die Reise wünschten. Ich kann diesen beiden Herren nicht genug danken für die Bereitwilligkeit, mit der sie die langweilige Arbeit auf sich genommen hatten, und für die Sorgfalt, womit alles ausgeführt worden war.
Das Depot lag zwischen großen Steinen auf einer Halde und war von allen Seiten mit Stacheldraht umgeben. Am Fuß des Hügels erstreckte sich eine alte Eisrampe ins Meer hinaus, die einen ausgezeichneten natürlichen Kai bildete. Wir beschlossen daher, unseren Ausladebaum als Kran auf dem Kai aufzurichten und mithilfe von diesem die Kisten, nachdem wir sie auf Schlitten dorthin gefahren hätten, direkt ins Boot hineinzubefördern. Um keinen zu weiten Boottransport zu haben, brachte ich die Gjöa so nahe wie möglich ans Land und verankerte sie da. Ich gebe zu, dass dies an einer offenen Küste unvorsichtig war, aber für uns war es sehr wichtig, bald fertig zu werden, um weiterreisen zu können. Wir schickten also einen Prahm an Land, um den dritten Teilnehmer der Expedition, Graf Moltke, der krank war, zu holen.
Ein eiliges Abendessen war bald eingenommen und um zehn Uhr machten wir uns an die Arbeit. Leutnant Hansen blieb an Bord, um da die Aufsicht zu führen. Ich selbst übernahm unter dem liebenswürdigen Beistand unserer dänischen Gäste und einiger Eskimos die Arbeit am Land. Hansen sollte die Kisten herbeischaffen und Lund sie an Bord heben. Das ganze Depot – hundertfünf Kisten – musste als Decklast verstaut werden. Währenddessen wurde von Ristvedt und Wiik der Motor gereinigt und geputzt.
Morgens um zwei Uhr gönnten wir uns Rast bei einer Tasse Kaffee, die wir wohlverdient hatten. Die Kisten wogen durchschnittlich ihre hundertdreißig Kilogramm und waren also kein Kinderspielzeug. Um halb drei Uhr gesellte sich zu meiner großen Freude Graf Moltke zu uns. Nach dem Kaffee begannen wir mit neuem Eifer. Ich wurde nun von vier Eskimos unterstützt. Es ist so viel darüber geschrieben worden, dass die Eskimos faul und unwillig und überhaupt im Besitz aller schlechten Eigenschaften der Welt seien; aber all dieses passte jedenfalls auf meine vier Gehilfen nicht. Sie handhabten unsere Kisten, von denen viele ein Gewicht bis zu zweihundert Kilogramm hatten, mit einer Leichtigkeit und Gewandtheit, die ihresgleichen suchten. Und anstatt Flüchen und Verwünschungen, die bei den »zivilisierten« Arbeitern die stehende Begleitung in solchen Fällen sind, begleiteten diese Naturkinder ihre Mühe mit Gesang und allgemeiner Munterkeit.
Morgens um acht Uhr waren die letzten Kisten sowie sechs Fässer Petroleum nach dem Kai geschafft worden, und ich berechnete, dass wir um neun Uhr ganz fertig sein könnten. Aber ach, es ging anders als nach meiner klugen Berechnung! Plötzlich erhob sich ein Seewind, der uns zwang, Hals über Kopf an Bord zu gehen. Der Anker wurde gelichtet und die Vorsegel wurden gehisst – zu dem Aufziehen des großen Segels war keine Zeit. Die Regenbö jagte scharf daher, aber der Wind sprang glücklicherweise so um, dass er unsere Segelfetzen füllte. Nun ging es rasch vorwärts, und es war die höchste Zeit, denn wir konnten den Abstand vom Land nach Zoll messen. Wir fuhren um die Insel herum und ankerten in Lee auf der anderen Seite. Aber jetzt hatten wir noch die anstrengende Arbeit vor uns, die noch auf dem Kai stehenden elf Kisten und sechs Petroleumfässer auf die entgegengesetzte Seite der Insel zu verbringen. Ich fürchtete mich davor, den Eskimos mit diesem Ansinnen zu kommen; aber sie lachten und scherzten nur und griffen mit frischen Kräften zu. Fertig wurden wir aber doch nicht vor sieben Uhr abends.
Bei unserer Ankunft an der Insel hatten wir die Hunde losgelassen, damit sie uns bei der Arbeit nicht im Wege wären. Sie benützten ihre Zeit sehr gut. Die alten Hunde von der »Fram« und die neuen von Godhavn bekamen Gelegenheit, in einer regelrechten Schlägerei alles, was sie von Streitigkeiten bis dato an Bord aufgespeichert hatten, auszufechten. Viele von den Hunden trugen böse Merkmale der Schlacht an ihrem Leib, als sie jetzt wieder an Bord gebracht wurden. Einer von unseren neuen Hunden war um keinen Preis herbeizulocken, und wir mussten ihn dahinten lassen. Die Eskimos werden ihn später, als er hungrig war, schon eingefangen haben. Mylius Erichsen schenkte mir vier prächtige Hunde, zwei ausgewachsene und zwei erst zwei Monate alte. Diese beiden Hündchen wuchsen zu außerordentlich tüchtigen Hunden heran. Wir nannten sie »Mylius« und »Gjöa«, und der Letztere wurde später unbestritten unser bester Hund.
Um elf Uhr abends erreichten wir die Insel Saunder, wo die literarische Expedition ihren Aufenthaltsort hatte. Und so hart es für uns war, uns nach so kurzem Beisammensein schon wieder zu trennen, so mussten wir ihnen doch hier Lebewohl sagen.
Wir waren nun schwer beladen. Unsere Petroleumbehälter hielten beim Abgang von Dalrymple 19.291 Liter. Das Deck lag auf der Wasserlinie und die Kisten reichten beinahe bis unter den Großbaum. Oben auf den Kisten liefen die Hunde umher und lauerten aufeinander. Es kostete uns große Mühe, die beiden feindlichen Parteien auseinanderzuhalten.
Am siebzehnten August, um halb drei Uhr morgens, setzten wir unsere Reise fort. Es war ein herrlicher Morgen. Ein Gletscher um den anderen dehnte sich im Norden in glänzender Breite aus, bis das Land bei Kap Parry abschloss. Beim Anblick eines Gletschers, den unser kühner Landsmann Eivind Astrup erstiegen hatte, um mit Peary zusammen seine Wanderung über das Inlandeis zu beginnen, wurde es mir sehr schwer, Augen und Gedanken davon abzuwenden. Aber ich musste mich losreißen und meine Aufmerksamkeit auf meine eigenen Angelegenheiten richten. Vor uns erstreckte sich eine Mauer von schweren, neu gebildeten Eisbergen, die wir uns mit Macht vom Leibe halten mussten.
Grönland wurde jetzt kleiner und kleiner, und wir hielten guten Kurs auf Kap Horsburg, den nördlichen Eingang zum Lancaster-Sund. Im Laufe des Tages passierten wir die Carey-Inseln in einer Entfernung von fünfzehn Seemeilen. Glücklicherweise blieb das Wetter still und klar. Wie die Gjöa jetzt belastet war, wäre sie nicht geeignet gewesen, einen Sturm auszuhalten. Es kostete uns ungeheure Mühe, um das Kap Horsburg herumzukommen. Der Wind war ganz abgeflaut; eine hohe Dünung aus Süden, die mit der Strömung aus dem Sund heraus zusammentraf, wühlte höchst unheimliche Wogen auf, und die Gjöa war mit ihrem Motor kein Schnellläufer.
Am zwanzigsten August morgens um halb fünf Uhr waren wir endlich um die Landzunge herum und in dem Lancaster-Sund. Da ich mich entschlossen hatte, nach der Insel Beechey zu fahren, um dort eine Reihe magnetischer Beobachtungen vorzunehmen, hielten wir auf das nördliche Ufer zu.
Mit Ausnahme von wenigen Eisbergen und ganz wenig Schlackeis, das sich vom Land her erstreckte, war das Fahrwasser so gut wie eisfrei. Der Nebel begleitete uns ganz bis Kap Warrender. Hier hob er sich und in dem schönen sichtigen Wetter konnten wir das Land betrachten. Dieses ist sehr verschieden von Grönlands wildem Gebirgscharakter. Am vorherrschendsten ist die Plateauformation, aber sie wird oft plötzlich von Kuppeln unterbrochen; es ist unfruchtbar hier, aber doch nicht ganz ohne Reiz.
Das sichtige Wetter hielt sich nicht lange. Schon am folgenden Morgen waren wir mitten im Nebel. Der Kompass war jetzt etwas unzuverlässig; dies in Verbindung mit dem Nebel muss uns zur Entschuldigung dienen, wenn wir hier irrefuhren. Und wir fuhren wirklich ein paar Mal irre. Aber ich tröstete mich damit, dass es denen, die nach uns kommen, wohl ebenso gehen wird.
Nach ziemlich starkem Kreuzen erreichten wir am zweiundzwanzigsten August abends um neun Uhr die Insel Beechey und gingen an der Erebus Bay vor Anker.
Der Anker war gefallen und das Schiff hatte beigedreht. Die meisten von uns waren zur Ruhe gegangen, um sich einer ununterbrochenen Nachtruhe zu erfreuen.
Es war gegen zehn Uhr und die Dämmerung brach herein.
Ich hatte mich auf eine Kiste gesetzt und schaute mit dem tiefen, feierlichen Gefühl, auf geheiligtem Boden zu sein, nach dem Land hinüber! Dies war John Franklins letzter sicherer Winterhafen gewesen.
Meine Gedanken glitten rückwärts – in längst vergangene Zeiten.
Ich sehe sie vor mir, die stattlich ausgerüstete Franklinflotte, wie sie in den Hafen hineinfuhr und die Anker auswarf.
»Erebus« und »Terror« sind noch in ihrem vollen Glanz! Die englischen Farben flattern auf ihren Mastspitzen und die beiden schönen englischen Schiffe sind voller Leben – Offiziere in glänzenden Uniformen, Bootsleute mit ihren Pfeifen, blau gekleidete Matrosen! Zwei stolze Repräsentanten für die erste seefahrende Nation hier oben in der unbekannten Eiswüste.
Vom Führerschiff wird ein Boot klargemacht. Sir John will an Land gesetzt werden. Die Blaujacken legen sich gut in die Riemen, sie sind stolz, ihren Führer im Boot zu haben. Aus seinem klugen, charaktervollen Gesicht leuchtet Güte; er hat für alle ein freundliches Wort, deshalb lieben ihn die Matrosen. Deshalb haben sie auch unbegrenztes Vertrauen zu dem alten erfahrenen Führer durch die Polargegenden. Jetzt lauschen sie gespannt auf jedes Wort, das zwischen ihm und den beiden Offizieren, in deren Mitte Franklin sitzt, gewechselt wird. Die Unterhaltung dreht sich um die ungünstigen Eisverhältnisse und um die Möglichkeit einer Überwinterung bei Beechey. Es fällt Sir John schwer, sich mit einem solchen Gedanken vertraut zu machen. Aber aus alter Erfahrung weiß er, dass man in diesen Regionen oft gezwungen ist, gerade das zu tun, was man am wenigsten möchte.
Es war diesen kühnen Leuten allerdings gelungen, etliches Neuland zu erforschen, aber nur, um alle ihre Hoffnungen auf die Vollbringung der Nordwestpassage von undurchdringlichen Eismassen vernichtet zu sehen.
Der Winter 1845–46 wurde hier an dieser Stelle zugebracht.
Die dunklen Umrisse einiger Grabkreuze drinnen im Land, die ich von hier aus unterscheiden kann, legen Zeugnis davon ab.
Das Gespenst des Skorbuts zeigte sich hier zum ersten Mal und forderte, wenn auch nicht viele, so doch einige Opfer an Menschenleben.
Als das Eis im Jahr 1846 aufbricht, werden »Erebus« und »Terror« wieder frei. Noch einmal ertönt der frohe Gesang der Matrosen, und die Schiffe fahren zwischen Kap Riley und Beechey hindurch. Noch einmal weht Englands stolze Flagge. Das ist der Abschiedsgruß der Franklin-Expedition. Von da glitt sie hinein in das Dunkel – in den Tod …
Der tüchtigste Forscher Dr. Sir John Rae war der Erste, der Nachricht darüber brachte, in welcher Gegend die Franklin-Expedition verunglückte. Aber die Ehre des ersten sicheren Berichts über das Schicksal der ganzen Expedition gehört dem Admiral Sir Leopold McClintock.
Gar viele Reisebeschreibungen enthalten die Geschichte dieser Tragödie, deshalb will ich sie nicht wiederholen. Franklin und alle seine Leute setzten ihr Leben ein im Kampf um die Nordwestpassage. Wir wollen ihnen ein Denkmal setzen, das dauernder ist als irgendein Bautastein: die Anerkennung, dass sie die ersten Entdecker der Nordwestpassage waren.
Der 23. August brachte schon in der Frühe Nebel. Wiik und ich gingen sogleich an die magnetischen Beobachtungen, die diesmal von allen mit großer Spannung und höchstem Interesse verfolgt wurden. Hing doch unser Weg nach dem magnetischen Pol von dem Ausfall dieser Beobachtungen ab. Ich kann nicht leugnen, viele hatten ihre Hoffnung darauf gesetzt, dass die Kompassnadel nach Westen zeige – nach den Bisamochsen auf der Insel Melville und nach Prinz-Patrick-Land. Die Deklinationsnadel wurde losgelassen und wir folgten ihren Bewegungen mit atemloser Spannung. Die Nadel schwankte lange hin und her und blieb dann in südwestlicher Richtung stehen. Obgleich auch ich zeitweise mit angenehmen Gefühlen an die Jagdgefilde im Nordwesten gedacht hatte, fühlte ich mich jetzt, wo die Entscheidung gefallen war, sehr befriedigt, denn mein ursprünglicher Plan konnte weiterverfolgt werden. Auch meine Kameraden waren
von demselben Gefühl beseelt. Von Anfang an waren wir alle darin einig gewesen, dass der beste Weg für die Nordwestpassage gerade der sein müsse, wohin die Magnetnadel jetzt deutete.
Wiik war ein zuverlässiger Arbeiter, wir hätten keinen gewissenhafteren und sorgfältigeren Gehilfen bekommen können.
Leutnant Hansen bekam keine Gelegenheit zum Gebrauch seiner astronomischen Instrumente. Die Sonne wollte sich nicht zeigen und wir mussten uns mit der Messung einzelner bekannter Punkte begnügen. Glücklicherweise hatte Kommandeur Pullen im Jahre 1854 eine Spezialkarte von der Insel Beechey aufgenommen, und diese war uns nun von großem Nutzen. Der Leutnant fand übrigens Veranlassung, die Beschaffenheit des Bodens zu untersuchen, und er nahm eine große Menge Versteinerungen mit. Northumberland House ist der Name eines Hauses, das auf der Insel Beechey im Herbst 1852 von Pullen gebaut wurde. Es sollte für das Geschwader von Sir Edward Belcher, der auf die Suche nach Franklin ausgezogen war, Proviant und Ausstattungsgegenstände enthalten. Bei der Heimreise dieses Geschwaders wurde das Haus nebst Inhalt als ein Depot für Franklin zurückgelassen, falls dieser an der Insel vorbeikäme. Drei Boote von verschiedener Konstruktion wurden auch zurückgelassen. Auf seiner Untersuchungsexpedition mit dem »Fox« besuchte Sir Leopold McClintock diesen Ort im Jahr 1858. Damals schon hatte das Depot Schaden gelitten. Und als Sir Allan Young 1878 mit der »Pandora« dahin kam, war es von Bären, die eingebrochen waren, so gut wie zerstört. Kein Wunder also, dass wir im Jahr 1903 das Ganze vollständig vernichtet fanden. Die letzten Reste von Kohlen nahmen wir mit. Desgleichen einen kleinen Vorrat Sohlenleder, das uns sehr willkommen war. Obgleich so viele Jahre lang Wetter und Wind ausgesetzt, war das Leder noch ganz gut, ja es wurde sogar unserem neuen Vorrat von »prima amerikanischem Sohlenleder« vorgezogen.
Die Ruinen des Franklin-Depots auf der Insel Beechey
Aber das Schicksal dieses Depots erscheint mir als eine Warnung für die Polarfahrer, die ihre Hoffnung auf fünfzigjährige Depots setzen.
Die im Auftrag von Lady Franklin zum Andenken an ihren Mann und seine Gefährten und seine Leute von McClintock errichtete Marmorplatte war in Ordnung. Sie lag noch da, wo sie im Jahre 1858 hingelegt worden war, am Fuß der Belcher-Säule, die zur Erinnerung an die Verunglückten der Belcher-Expedition errichtet wurde. An dieser Säule ist auch eine kleine Erinnerungstafel an den in der Gegend ertrunkenen französischen Leutnant Béllot eingelassen. Dies alles fanden wir im besten Zustand, desgleichen die Gräber selbst; einen einzigen umgestürzten Grabstein richteten wir wieder auf …
Die Traurigkeit und Schwere des Todes ruht über der Insel Beechey; es ist kein Leben, keine Vegetation da, kaum Wasser ist zu finden. Als zwei von unseren Leuten nach vieler Mühe endlich Wasser zum Füllen unserer Behälter entdeckt hatten und es in einem unserer Segeltuchboote zum Schiff schleppten, bekam das Boot ein Loch und das Wasser lief aus. Ein Spaziergang auf den Gipfel der Insel gewährte uns einen ziemlich guten Überblick, der freilich ohne den anhaltenden Nebel noch besser gewesen wäre. Einige Meilen weit konnten wir aber doch da und dort hinausspähen. Das Meer war auf allen Seiten eisfrei, nirgends war auch nur eine einzige Scholle zu sehen.
Aber was ist das? Plötzlich ist der Eingang zu der Erebus-Bucht mit einer schweren weißen Masse angefüllt. Es sieht am ehesten wie plötzlich aufgetauchtes zusammenhängendes Neueis, »Pfannkucheneis«, aus. Unsere Fernrohre bestätigen das Phänomen – es ist Bewegung in der Masse …
Und dann ertönt in des Walfischfängers erfreulicher Sprache die Kunde, es sei ein gewaltiger Schwarm Weißwale, der sich da nähere.
Am vierundzwanzigsten August gegen Mittag waren wir mit unseren magnetischen Beobachtungen fertig. Wir hatten unser Zelt am Ufer eines ausgetrockneten Flussbetts aufgeschlagen. Die Stelle ist durch eingerammte Fassdauben und große Steine bezeichnet, sodass es einem etwaigen künftigen Observator wahrscheinlich nicht schwer sein wird, den Ort wiederzufinden.
Noch einmal versammelten wir uns alle miteinander bei dem alten Franklin-Depot und untersuchten genau, ob sich nicht vielleicht noch etwas fände, was uns von Nutzen sein könnte. Einige hatten ihr Herz an einen alten Handkarren gehängt und verwendeten sich eifrig für dessen Mitnahme. Auf die Frage, ob sie ihn zu sich in ihre Koje nehmen wollten, ließen sie von ihrem Begehren ab. Sie sahen ein, dass wir keinen Platz dafür hatten. Aber der Schmied hatte einen Fund gemacht, über den er in höchstes Entzücken ausbrach – einen uralten Amboss. Ihn von dessen Mitnahme abzubringen, wäre nicht ratsam gewesen. Die Expedition wäre einfach zugrunde gegangen, wenn wir den Amboss nicht mitgenommen hätten! – Er wurde nie benutzt!
Das Denkmal für Franklin, Béllot und Belcher auf der Insel Beechey
Den Bericht über unsere bisherigen Erlebnisse steckten wir in eine Blechhülse und hängten sie an den am meisten in die Augen fallenden Platz – über die Béllot-Platte an der Belcher-Säule. Dann ruderten wir an Bord hinüber – alle sehr befriedigt von dem Aufenthalt auf Beechey und nur von dem Wunsch beseelt, weiterzukommen.