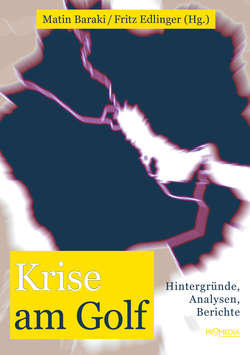Читать книгу Krise am Golf - Robert Fitzthum - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWerner Ruf
Die Jemenpolitik Saudi-Arabiens
Wozu dieser grausige Krieg, der in unseren Medien kaum thematisiert, von den Vereinten Nationen als die wohl größte humanitäre Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wird? Dieser Krieg dauert nun schon seit März 2015, hat die gesamte Region entflammt und die Hauptprotagonisten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) werden von Ägypten, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Marokko und Sudan unterstützt. Im Kampf gegen die Huthi verfügt die Allianz dank US-amerikanischer (aber auch britischer und französischer) massiver Unterstützung über ein gigantisches Arsenal an High-Tech-Waffen, kann aber offensichtlich den Kampf gegen die Stammeskrieger nicht gewinnen.
Saudi-Arabien auf dem Weg in die Moderne?
Saudi-Arabiens starker Mann Mohamed bin Salman (MBS) hat in seiner »Vision 2030«79 ein entwicklungspolitisches Programm vorgelegt, das geradezu zwingend erscheint, wenn das Land aus seinen anachronistischen Strukturen herausgeführt und von seinem einzigen, weltmarktabhängigen Produkt, den fossilen Kohlenwasserstoffen, unabhängig gemacht werden soll: Ausbau der Infrastruktur, Industrialisierung, Forschung und Entwicklung sollen die Basis liefern für einen modernen, wirtschaftlich autarken Staat. Dies erscheint umso notwendiger, als das Land seit sechs Jahren erhebliche Haushaltsdefizite zu verzeichnen hatte, die vor allem durch den Verfall des Ölpreises seit 2014 hervorgerufen wurden. Der IWF schätzt das Haushaltsdefizit für 2019 auf 7,9%.80 Dieses wurde schon in den vergangenen Jahren durch den Rückgriff auf Reserven und Anleihen ausgeglichen. Über den Börsengang der bislang staatlichen Aramco, die auf einen Unternehmenswert von zwei Billionen US-Dollar geschätzt wird und als das wertvollste Unternehmen der Welt gilt,81 wird spekuliert. Einnahmen aus dem Verkauf von Aktien der Aramco könnten die Haushaltslöcher stopfen. Der Schritt an die Börse wäre Teil der neoliberalen Vorstellungen des Kronprinzen.
Unmittelbare Folge dieser Rentenökonomie ist das Fehlen einer eigenständigen Industrie und wirtschaftlicher Selbständigkeit, ja, im Prototyp des Rentenstaats sind Unterentwicklung und Rückständigkeit geradezu die Basis für die Aufrechterhaltung des archaischen politischen Systems: Die Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas alimentieren nicht nur das Herrscherhaus und die gewaltigen Apanagen der geschätzten 6.000 bis 10.000 Prinzen und stellen die Grundfinanzierung des Lebensunterhalts von Millionen von Staatsangehörigen dar, sondern auch den für die Legitimation der Herrschaft unentbehrlichen Klerus, den Repressionsapparat und die schier unfassbaren Käufe von Rüstungsgütern, bei denen man sich fragen darf, ob sie überhaupt für die Sicherheit und die Kriegführung taugen oder ob sie eher dazu geeignet sind, die außenpolitische Loyalität der Verkäufer-Staaten (insbesondere jüngst die der Trump-Administration) zu sichern und über die in diesen Geschäften üblichen Provisionen für die Besteller die systemische Korruption auf höchstem Niveau zu pflegen.
Soweit es in diesem Land produktive Arbeit gibt, wird sie von Arbeitssklaven aus Süd- und Ostasien geleistet. »Beschäftigung« für die »Staatsangehörigen« gibt es vor allem im öffentlichen Sektor, wo die Zahl der dort »Tätigen« zwischen 1962 und 1971 von 37.000 auf 85.000 wuchs, 1988 waren im öffentlichen Dienst bereits 388.000 Beamte tätig, die meisten von ihnen hatten Grundschulniveau.82 Bei diesem System geht es offensichtlich weniger um Arbeitseffizienz als um die Sicherung von – rentenabhängigen – Einkünften in nepotistischen Strukturen. Da mutet die von De-facto-Alleinherrscher Mohamed bin Salman propagierte »Vision 2030« geradezu revolutionär an: Das Land soll in diesem Zeitraum zu einem industriellen und logistischen Zentrum gemacht werden. Der Lebensstandard soll gesteigert werden, ebenso die Effizienz der Regierungstätigkeit. Der Finanzsektor soll in die Lage versetzt werden, das schnelle Wachstum einer privaten Wirtschaft voranzutreiben und ausländische Investitionen anzulocken. Dienstleistungen sollen in bester neoliberaler Tradition vom öffentlichen auf den privaten Sektor übergeleitet werden. Ein öffentlicher Investitionsfonds soll zu einem Motor werden, der bis 2020 (!) dafür sorgen soll, dass gewaltige Investitionen im In- und Ausland eine Diversifizierung von Wirtschaft, Entwicklung und Wachstum sichern. Ob diese Ziele in und mit einer zutiefst durch die Rentenmentalität geprägten Gesellschaft leistbar sind, bleibt abzuwarten.
Alle diese Ziele aber basieren zunächst ausschließlich und wohl auch weiterhin auf den Einnahmen aus dem Kohlenwasserstoffexport, die nun eingesetzt werden sollen, um die Abhängigkeit von der Rohstoffextraktion zu überwinden. Gerade für die Verwirklichung der »Vision 2030« bleibt das Öl die Basis der saudischen Gesellschaft und der Politik des despotischen Herrscherhauses, denn weiterhin müssen erhebliche Teile des unproduktiven Legitimations- und Herrschaftsapparats wie insbesondere der Klerus aber auch die feudalen Stammesstrukturen alimentiert werden. Die Fortdauer ihrer großzügigen Alimentierung dürfte umso wichtiger sein, als diese parasitären Strukturen um die Unterminierung ihrer Macht fürchten müssen, wenn eine tatsächliche Industrialisierung des Landes in Gang käme, die auf einer einheimischen, die Staatsbürgerschaft besitzenden Arbeiterschaft basieren würde: Die Arbeitskraft könnte nicht mehr nach Belieben ausgetauscht werden, ja es könnte eine Dynamik entstehen, die sogar die Bildung von Gewerkschaften und politischen Parteien zur Folge hätte. Ob die despotische Herrrschaft eine solche Entwicklung überleben würde?
Der Krieg im Jemen
Die in Jemen herrschende und von den Briten unterstützte zaiditische Monarchie, die in der Vergangenheit stets eng mit Saudi-Arabien verbündet war, wurde 1962 von der Armee gestürzt, 1967 kam es zur Ausrufung der sozialistisch orientierten Republik Südjemen, das Land war gespalten. 1990 vereinigten sich beide Staaten wieder. Langjähriger Präsident wurde der seit 1978 amtierende nordjemenitische Präsident Ali Abdullah Saleh, der nach einem Bombenattentat und einer Behandlung in Saudi-Arabien schließlich im Oktober 2011 zugunsten seines Stellvertreters Abed Rabbo Mansour Hadi von seinem Amt zurücktrat. Trotz des sozialistischen Experiments im Süden und der Ausrufung der Republik blieb Jemen eine Stammesgesellschaft. Kaum vom Staat kontrollierbar waren die Stämme im Innern des Landes, die heute in den Medien meist unter dem Begriff »Huthis« zusammengefasst werden.83 Sie gehören einer Religionsgemeinschaft an, die zu den Schiiten gezählt wird, obwohl sie den Sunniten näher steht als den iranischen Zwölferschiiten. Ihr Widerstand hat lange Tradition und war vor allem durch die Vernachlässigung der Stammesgebiete durch die Zentralregierung motiviert: Zahlreiche Entführungen in der jüngsten Vergangenheit hatten elementare Ziele: Den Bau von Straßen, Wasserleitungen, Schulen und Krankenhäusern.
Das im Westen gehandelte Klischee, die Huthis seien eine Art fünfte Kolonne des Iran im Kampf um die Hegemonie am Golf, entlarvt Lüders84 überzeugend, wobei er u. a. auf Berichte von US-Botschaften in Riad und Sanaa verweist: Erst die massive Unterstützung der saudischen Invasion und die Einordnung der Huthis als Hilfstruppe iranischer Expansionspolitik hoben den Konflikt auf die Ebene einer regionalen hegemonialen Auseinandersetzung, die die westliche Unterstützung für die Saudis rechtfertigen soll. Auch Guido Steinberg85 von der »Stiftung Wissenschaft und Politik« (SWP) kommt zu der Feststellung, dass die Kriegführung der Saudis, indem sie auf die konfessionellen Gegensätze setzt, die Huthi-Rebellen in die Arme des Iran trieb.
Völlig unbelichtet in der Literatur zu diesem Konflikt scheint die geopolitische Lage Saudi-Arabiens (und der Golfstaaten) und deren Folgen für den ungehinderten Export von Öl. Ein kurzer Blick auf die Landkarte zeigt, dass die Exporte aus der Arabischen Halbinsel leicht behindert, ja blockiert werden können: Im Norden müssen die Öltanker den Suezkanal passieren. Abgesehen von der Tatsache, dass die Riesentanker diese Wasserstraße nicht nutzen können, bleibt Saudi-Arabien hier also auf gute Beziehungen zu Ägypten angewiesen, die derzeit relativ stabil erscheinen, ist Ägypten doch Verbündeter der Saudis im Kampf gegen die Huthis.
Im Süden des Roten Meeres ist das Bab al-Mandab (Tor der Tränen), eine Meerenge, die von Frankreich und den USA kontrolliert wird, die beide im Kleinststaat Dschibuti am Ausgang aus dem Roten Meer gewaltige Militärbasen besitzen und wo China im Zuge seines Projekts der »Neuen Seidenstraße« an Einfluss gewinnt und gleichfalls einen Militärstützpunkt aufgebaut hat. Die strategische Lage der Meerenge rückt sie also ins Visier nicht nur der regionalen sondern auch der großen Mächte.86
Im Persischen Golf stellt die Straße von Hormus ein weiteres Hindernis dar. Dieser Wasserweg, der die Arabische Halbinsel vom iranischen Festland trennt, könnte im Konfliktfall leicht durch versenkte Schiffe und Minen des als Erzfeind betrachteten Iran gesperrt werden. Da die saudische Ölproduktion auf den Osten der Arabischen Halbinsel konzentriert ist, ist die Straße von Hormus die Lebensader der saudischen Exporte und weit wichtiger als die Kontrolle des Suez-Kanals. Für ungehinderte Exporte seines Öls braucht Saudi-Arabien einen ungehinderten Zugang zum Indischen Ozean. Das Problem des freien Zugangs zu den Weltmeeren und zu den Pipelines, die von Zentralasien über die Türkei nach Europa führen, ist keineswegs neu: Schon 1947 hatte Saudi-Arabien den Bau einer Pipeline von seinen Fördergebieten im Osten des Landes begonnen, die ursprünglich in Haifa enden sollte. Eine nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg (1948) als Alternative gebaute und kurzfristig betriebene Trasse führte über die Golanhöhen nach Sidon an der Mittelmeerküste. Nach dem Sechs-Tage-Krieg und der israelischen Besetzung der Golanhöhen wurde diese Pipeline schließlich 1976 stillgelegt, auch weil sich die Verhandlungen mit den Durchgangsstaaten Jordanien, Libanon und Syrien immer schwieriger gestalteten.
1981 begann der Bau einer Pipeline vom Ölförderzentrum Abqaiq in der Ostprovinz nach Yanbu al Bahr am Roten Meer, nördlich von Djeddah. Die Pipeline hat eine Kapazität von fünf Mio. Barrel pro Tag, ergänzt wurde sie durch eine parallel verlaufende Pipeline für verflüssigtes Erdgas. Die Länge der nördlich von Riadh verlaufenden Pipelines beträgt 1.200 km. So wird die Straße von Hormus vermieden, das Bab al-Mandab gewinnt strategische Bedeutung.