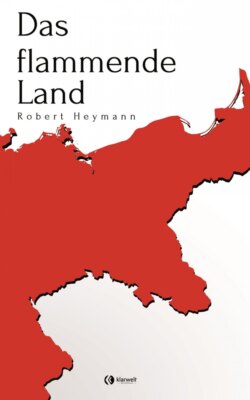Читать книгу Das flammende Land - Robert Heymann - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erstes Kapitel.
ОглавлениеDie Uhr der Kathedrale Saint Pierre schlug elf, als Dr. Hans Scholz mit großen Schritten über den breiten Platz eilte, um, an dem Rathaus vorüber, in die Rue de la Station einzubiegen.
Er konnte nie an dem Hotel de Ville vorüberkommen, ohne einige Sekunden zu verweilen und die unvergleichliche gotische Fassade zu betrachten, wohl auch einen raschen Blick in die mittelalterliche Säulenhalle zu tun. Heute aber hatte er es eilig. Er hatte kaum ein Auge für das Leben und Treiben auf dem Grand place, denn er hatte sich ohnehin etwas verspätet.
Als er vor dem alten Patrizierhaus stand, das seltsam abstach von den neuen Häusern der weiten Nachbarschaft, da holte er aus seiner inneren Rocktasche ein Schreiben, dann zog er die Klingel. Ein Fenster im Keller öffnete sich und ein spitznasiger Diener fragte mit honigsüßer französischer Höflichkeit nach dem Wunsche des Besuches.
„Ich möchte den Herrn Archivrat Rambaud sprechen.“
„Sofort mein Herr!“
Das schwere Tor öffnete sich. Dr. Scholz wurde in ein schwer und behaglich ausgestattetes Empfangszimmer geleitet. Der Diener ging mit der Karte durch einen endlosen Korridor.
Neben dem Zimmer, in welchem der junge Deutsche stand, spielte eine Dame Klavier. Dr. Scholz sah zwischen den Portieren hindurch, welche die Räume trennten, nur die schlanke Figur in dem weißen Kleide, dichtes braunes Haar, ein paar helle Hände, die wie verloren über die Tasten glitten.
Die junge Dame war so sehr in ihre musikalischen Träumereien versunken, dass sie den Eintritt des Gastes offenbar gar nicht bemerkt hatte; denn sie erhob sich und schritt ohne jede Benommenheit dem Empfangszimmer zu.
Dr. Scholz trat rasch zurück. In diesen wenigen Augenblicken konnte er den Liebreiz der Erscheinung, die jetzt ganz im Lichte stand, auf sich wirken lassen.
Die hohen Bogenfenster ließen die Sonne in das Gemach strömen. Ein Blick in ihr Antlitz brachte ihn auf die Vermutung, die etwa achtzehnjährige junge Dame müsste eine Deutsche sein, und sogleich bekam er durch sie selbst die Bestätigung.
„Ach“, sagte sie erschreckt und in der ersten Verwirrung in deutscher Sprache, als sie plötzlich den Fremden vor sich sah. „Entschuldigen Sie“, und dann setzte sie etwas in Französisch hinzu. Aber Dr. Scholz unterbrach sie mit hastiger Freude:
„Wie ich höre, sind Sie Deutsche!“
„Ja, mein Herr, und Sie — Sie kommen aus meiner Heimat?“ Der Klang ihrer Stimme verriet die innere Bewegung. Er erwiderte rasch: „Ich bin aus der Mark!“
„An der Aussprache merkte ich es. Meine Eltern wohnen in Berlin, ich selbst entstamme einer kleineren Stadt.“
Dann erlauben Sie, dass ich Ihnen die Hand küsse, gnädiges Fräulein — es tut so wohl, in diesem welschem Lande die Laute der Heimat zu hören!“
Impulsiv führte er die Hand an seine Lippen. Sie gestattete es zögernd. Ihr Blick überflog sein Gesicht, die sehnige große Gestalt. Die schmal gefasste goldene Brille konnte die hellen Augen nicht verbergen, die klar und sicher und voll Frohsinn in die Welt sahen.
„Sind Sie schon lange in Belgien?“ fragte Dr. Scholz in leichter Verlegenheit.
Ein halbes Jahr etwa. Ich erziehe die Kinder des Hauses.“
„Und ich bin hier, um archivarische Aufzeichnungen zu machen. Mein Name ist Dr. Scholz.“„
Sie neigte ein wenig das Haupt.
„Elsa von Sandern.“
In diesem Augenblick wurde die Tür hastig geöffnet. Ein belgischer Offizier trat ein.
Kaum hatte die junge Deutsche einen Blick auf ihn geworfen, als eine fahle Blässe ihr Antlitz überzog. In einer Verwirrung, die dem Gast nicht entgehen konnte, sagte sie:
„Guten Tag, Eugen!“
Es lag etwas Gequältes und Erzwungenes in dem Ton ihrer Worte, und das Lächeln, das um ihre Lippen spielte, war so schmerzlich, dass der Besucher unwillkürlich den neuen Gast fest ins Auge fasste.
Jener erwiderte den Blick, aber mehr mit Gehässigkeit als mit Festigkeit. War es Eifersucht oder sonst ein unerklärliches Gefühl? — es schien dem Deutschen, als messe ihn der Belgier mit einem Ausdruck des Hasses, der im gegebenen Moment durch nichts begründet war. „Herr Eugen Rambaud, Leutnant, mein Bräutigam“, stellte die Dame vor.
Sie hielt dabei die Augen niedergeschlagen, als hätte sie sich dieses Geständnisses zu schämen. —
Die Sonne war aus dem Gemach geglitten. Es war dem Besucher, als ströme ein eisiger Hauch über ihn hinweg. Er konnte sich, als er das Zimmer verlassen hatte, nicht mehr erinnern, wie dieser Offizier aussah. Er hatte nur die Vorstellung von einer feindlichen, gefährlichen Macht, und als er, von dem Diener geleitet, der lautlos wie eine Katze eingetreten war und ihn aufgefordert hatte, ihm zu folgen, durch den düsteren Korridor schritt, da verstärkte sich dieses Gefühl des Unbehagens noch mehr. —
Es erlosch auch nicht, als Dr. Scholz dem Archivrat gegenüberstand.
Professor Henri Rambaud war höchstens fünfzig. Er trug einen Knebelbart, der bereits stark meliert war, aber das dichte Haar und eine gewisse Frische in den Zügen ließen ihn eigentlich jünger erscheinen als er — seinem Sohne nach — sein musste.
Mit jener Verbindlichkeit, die sich in die Herzen schmeichelt und die natürliche Vorsicht, die der Deutsche im Verkehr mit Leuten anderer Nationalität an den Tag legt, einschläfert, wurde der bis dahin unbekannte Besuch empfangen.
Der Deutsche stellte sich vor und übergab dem Archivrat einige Briefe:
„Ich erlaube mir, Ihnen Empfehlungen vorzulegen, die meine Vorgesetzten mir in der Heimat übergeben haben. Der Zweck meines Aufenthaltes in Löwen ist, gleichwie in Brüssel die Handschriften der Archive zu studieren, um mein Teil zu dem Werke beizutragen, das im Auftrage des Kultusministeriums herausgegeben wird . . .“
„Es ist mir eine ganz besondere Ehre, mein Herr, dass Sie meine Hilfe in Anspruch nehmen. Seien Sie überzeugt, dass ich Ihnen gerne jede Gefälligkeit erweisen werde, die Sie wünschen. Wollen — und dürfen Sie mir verraten, welches Werk das ist, welches in offiziellem Auftrag Ihres Ministeriums herausgegeben wird und an dem Sie — so will es mir wenigstens scheinen — den Hauptanteil haben sollen?“ „Dies ist kein Geheimnis“, erwiderte Dr. Scholz lächelnd. „Sie als geborener Belgier, Herr Professor Rambaud, kennen wohl am besten die historischen und sprachlichen Dissonanzen, die dieses Land spalten. Sie werden auch wissen, welchen großen Einfluss die deutsche Kultur auf Bestand und Entwicklung dieses Staates genommen hat. Dies zu untersuchen, nach Quellen geschichtlicher Angaben, ist meine Aufgabe, und mein Buch soll lauten: Deutsches Wesen in Belgien.“ Es war die Art des Deutschen, in das Licht zu sehen, wenn er sprach.
Darum blickte er auch jetzt zum Fenster hinaus und übersah den lauernden Ausdruck in dem Gesicht des Archivrates. Es entstand eine kleine Pause. Als Scholz Herrn Rambaud fragend ansah, hatte dieser schon wieder ein verbindliches Lächeln aufgesetzt:
„Ich fürchte, Herr Dr. Scholz, Sie werden in einem allerdings begreiflichen germanischen Optimismus — wenn dies das rechte Wort für das ist, was ich ausdrücken will — den deutschen Einfluss auf die hohe Entwicklung, die Belgien in den letzten Jahrhunderten genommen hat, überschätzen. Denn in der Tat haben wir unser bestes Teil aus französischer Kultur übernommen.“ „Nun, das bestreite ich entschieden“, erwiderte der Deutsche beinahe heftig. „Wer hat Belgien denn überhaupt zu einem bedeutenden Staate gemacht? Karl V.! Ein Herrscher, den wir Deutschen wohl mit gutem Recht als einen der Unsern ansehen dürfen, denn in erster Linie war er deutscher Kaiser, wenn auch in seinem Reiche die Sonne nicht unterging. schließlich war er doch ein Mehrer deutscher Macht . . .“ „Und ein geborener Belgier“, setzte der Archivrat spitzig hinzu. „Unser keizer Karel de Vyfde — so sagen wir heute noch in Flämisch. Belgische Edelleute regierten damals die Welt, Herr Dr. Scholz!
Hatte Belgien bis dahin 60 Millionen Einfuhr, so stieg sie unter diesem Kaiser auf 390 Millionen. Antwerpen war die Hauptstadt der Welt, und . . .“ „Oho, Herr Rambaud . . .“
„O bitte. Ein Sprichwort sagt: Die Welt ist ein Ring und Antwerpen darin der Diamant. Sie sehen, ich bin in der Geschichte unseres Landes beschlagen, und wenn Sie auf den deutschen Einfluss Karls V. in Belgien hinweisen“ so darf ich von dem belgischen Einfluss unter der Regierung unseres Karl reden . . .“
„Und was hat Ihnen sein Nachfolger gebracht, Philipp II.? Den blutigen Herzog Alba sandte er Ihnen ins Land — und dieser Herr war ein Spanier. und was hat Ihnen Frankreich gebracht? Ludwig XIV. führte hier seine Eroberungskriege, die Revolution von 1792 verwüstete Ihr Land und düngte die Felder mit Flüchen und Blut. Nach der kriegerischen Affäre mit den Holländern wollte Napoleon III. — ich verweise auf Benedettis Anerbieten an Bismarck — Belgien zu Frankreich schlagen. Gewiss, das sind nur politische Fragen gewesen. Aber die von Osten nach Westen gehende Sprachgrenze teilt Belgien deutlich in ein rein flämisches, also germanisches Gebiet . . .“
„. . . und in eine wallonische, als französische Hälfte. Und dann vergessen Sie nicht, dass das deutsche Wesen wie ein überwundener Gegner langsam, aber auffällig vor der französischen Sprache zurückweicht. Ich werde Ihnen darüber sehr interessantes statistisches Material zur Verfügung stellen können. Daran ändern auch deutsche Schulen in Brüssel und Antwerpen nichts — doch, mein Herr, wir streiten hier um des Kaisers Bart. Sparen wir uns solche Auseinandersetzungen für gelegenere Zeit und seien Sie heute zum Souper mein Gast, wenn Sie mir die Ehre geben wollen.“
Er reichte Dr. Scholz mit einem gewinnenden Lächeln die Hand. Und wieder war der aufsteigende Groll vergessen. Der junge Deutsche war froh, eine Gelegenheit gefunden zu haben, dieses Haus wieder zu betreten. Er versprach, sich pünktlich einzufinden. Als er an dem Empfangszimmer vorüberschritt, vernahm er eine heftige Männerstimme, in der er die des belgischen Leutnants zu erkennen glaubte. Sie verstummte aber sofort auf das Geräusch von Schritten hin, und es war Dr. Scholz nur noch, als vernehme er leises Schluchzen. Es war wie stilles, verzweifeltes Hilfeflehen, und das unheimliche Gefühl, das in ihm war, wuchs. Warum also in aller Welt zog es ihn nach diesem Hause zurück, in dem er gar keine Berührungspunkte zu seinem ureigensten Wesen fand? Warum übte es trotzdem eine solche Anziehungskraft auf ihn aus? Wie eine kleine Festung stand es mit seinen gotischen Türmchen da, finster und verschlossen. Es lag in der Unheimlichkeit der Bauart etwas Großartiges, Machtvolles. Wie eine Belfriede war es, wie ein mächtiger Wachtturm, der die Vergangenheit schützen sollte. Und während der Deutsche noch unter dem Eindruck des Baues stand, den er lange betrachtete, war es ihm wieder, als dringe das geheimnisvolle Schluchzen an sein Ohr, übertönt von dieser rauen, brutalen Männerstimme. Und ohne dass er es selbst recht begriff, fasste ihn ein Hass gegen dieses Haus, ein dumpfer Hass, in den sich eine unerklärliche Furcht vor etwas Unbestimmtem mischte wie vor einem Schicksal, gegen dessen Entfaltung er machtlos war.