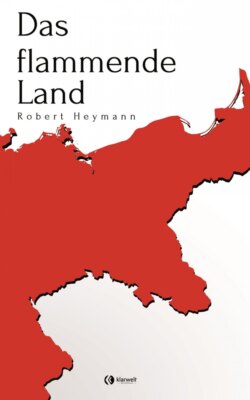Читать книгу Das flammende Land - Robert Heymann - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Viertes Kapitel.
Оглавление„Elsa“, sagte Eugen am Abend, „ich war vielleicht etwas heftig gegen dich an diesem Morgen. Bist du mir böse darüber?“
Sie schüttelte den Kopf und sah ihn traurig an. Er setzte sich neben sie und legte seinen Arm um ihre Schulter. Und obgleich dies ein unangenehmes Gefühl in ihr weckte, war sie doch gleichzeitig dankbar für diese kleine Zärtlichkeit.
Denn nichts ließ sich mit dem Gefühl der Verlassenheit vergleichen, das sie beherrschte, nichts mit dem Heimweh, das in ihr war und ihr seit Monaten jede Kraft und jeden Lebensmut benahm.
„Du solltest weniger heftig gegen mich sein“, sagte sie leise. „Du weißt, ich habe niemanden auf Erden, zu dem ich Vertrauen fassen dürfte, außer denen, die weit von mir entfernt sind. Und auch von ihnen steht einzig mein Bruder meinem Herzen nahe.“
„Man hat dir also in deiner Familie immer noch nicht den sogenannten „Fehltritt“ verziehen? Du hast mich niemals so ganz offen darüber aufgeklärt.“
„Fehltritt!“ erwiderte sie bitter. „Wie kannst du nur in diesem Tone sprechen? In meiner Familie ist niemand, der meine Ehre anzutasten wagen würde, denn von unserem Blute hat nie ein Mann oder eine Frau vergessen, dass der Name Sandern unbefleckt und hochgeehrt in der Geschichte meines Vaterlandes geschrieben steht!“
„Nun ja“, erwiderte er ungeduldig. „Man hat dich doch immerhin gezwungen, eine Stellung im Auslande anzunehmen.“
„Niemand hat mich gezwungen. Es war mein eigener Wille!“
„Weil dir die Kleinlichkeit deiner Familie den Aufenthalt in deinem Vaterlande unmöglich gemacht hat.“
„Du treibst Missbrauch mit dem Vertrauen, das ich dir entgegengebracht habe, Eugen. Es war nicht Kleinlichkeit. Zwei verschiedene Weltanschauungen standen sich gegenüber. Es war eine neue Zeit über Deutschland gekommen, der meine Familie vollkommen ferne stand und noch ferne steht.
Vielleicht — wenn einmal eine große Gefahr an unser Land herantritt, werden sich alle diese Gegensätze zusammenschweißen, und es wird eine neue, große, herrliche Epoche für unser Land anbrechen.“
Sie sah nicht sein hämisches Lächeln.
„Du hast jedenfalls viel in modernen Büchern gelesen . . .“
„O nein, Eugen! Du musst das, was mir heilig war, nicht lächerlich zu machen versuchen. Gewiss, es gab eine Zeit, da hatte die Frau keine Überzeugung außer der, dass sie ein untergeordnetes Wesen sei, das nicht teilnehmen dürfte an dem großen Ringen der Menschheit um neue Werte in Kultur und Zivilisation. Und gerade aus diesem unerträglichen Zustande heraus wird auch die Entartung verständlich, der viele Kreise unseres Volkes und andere Nationen entgegentrieben. Ich hatte einen Lehrer, der in seiner politischen Überzeugung Sozialdemokrat war. Ich wusste damals nicht, was das bedeutete. Ich nahm nur das Gute und Starke, das in seinen Ansichten war, in mich auf, „und ich lernte mich in neue Probleme, in eine neue Zeit hinein, bis es wegen Sebald Willmer zum Streit zwischen meiner Familie und mir kam.“
„Sebald Willmer dachte jedenfalls, dich einmal zu heiraten?“
„Eugen! Muss der Gedanke zwischen zwei Menschen, die sich verstehen und von denen der eine der Gebende, der andere der Empfangende ist — muss der Gedanke immer lauernd im Hintergrunde stehen? Sebald Willmer wurde nach einer heftigen Auseinandersetzung mit meinem Onkel, in der er seine Ideen verteidigte, aus unserem Hause gewiesen, mit mir aber begann ein monatelanges Ringen und Kämpfen, bis ich nicht mehr konnte, bis ich in die Welt hinausging, denn für meine Familie war ich meiner Ansichten wegen eine Heimatlose geworden — und ich hing doch an meinem Lande wie keine zweite Frau! Ich liebte und liebe es aus überströmendem Herzen — doch die persönliche Unabhängigkeit musste ich mir erkämpfen. Ich nahm also in diesem Hause die Stellung als Erzieherin an.“
„Und wir hatten das Glück, uns kennen und lieben zu lernen.“
Sie antwortete nicht. Nach einer Weile flüsterte sie:
„Ich hatte vielleicht meine Kraft überschätzt. Ich war seine Frau, die für den Kampf geboren wurde. Ich brach innerlich zusammen, als ich entwurzelt war.
Ich war so schutz- und hilflos!“
„Und hast du nicht an meiner Seite Schutz und Schirm gefunden?“
Sie nickte weltverloren. Dann sagte sie:
„Wenn einer derer von Sandern wüsste, dass der Archivrat Rambaud wohl die Verlobung seines Sohnes mit einer Sandern billigte, dies aber vor der Welt geheim zu halten wünscht, dass ich hier sozusagen eine Doppelrolle spiele und geächtet bin . . .“
Sie brach in Tränen aus.
Eugen umfing sie.
„Närrchen! Du hast wieder deinen sentimentalen Tag. Meine Eltern wollten uns doch bloß beide prüfen. Ich war in früher Jugend ein Tunichtgut . . . Du bist Deutsche . . . eine andere Rasse und auch aus ganz anderer Familie wie wir — es sollte erst einige Zeit verstreichen, bis meine Eltern sicher waren, dass wir zusammenpassten . . .“
Sie nickte. Aber man sah, dass ihre Gedanken weit fort waren. „Ich muss mich fügen. Ich muss. Was bliebe mir anderes übrig, jetzt, nachdem ich heimatlos geworden bin?“
Ein bitteres und verzweifeltes Lächeln irrte um ihre Lippen.
Eugen sah nachdenklich zu Boden.
„Warum die Verzweiflung, die gerade jetzt ganz unangebracht ist, Else? Sieh, meine Eltern wollen nicht länger zögern, die Zustimmung zu unserer Verheiratung zu geben. Und wäre da nicht gerade ich berufen, eine Aussöhnung zwischen dir und deinen Blutsverwandten herbeizuführen?“
Sie horchte auf. Ein heller Glanz trat in ihre Augen.
„Dass ich wieder eine Heimat hätte?“
„Findest du sie wirklich nicht bei uns?“
„Doch. Aber es ist nicht das, was ewig im Herzen klingt — das Rauschen deutscher Eichen, deutsche Städte, deutsche Seen, deutsche Klänge — ach, und das Haus, in dem man seine Kindheit verlebt hat, das in dem man zuerst das heilige Wort Mutter stammelte — wer könnte uns dies jemals ersetzen?“
Er zuckte die Achseln.
„Wir sind vielleicht nicht so tief veranlagt wie ihr Deutsche. Doch wie wäre es, Elsa? Soll ich versuchen, eine Verbindung zwischen deinen Verwandten und dir wieder anzubahnen?“
„Ach, wenn es dir gelänge!“ „Apropos! Was ist denn aus diesem Sebald-Willmer geworden?“
„O, der hat seinen Weg gemacht! Er ist Abgeordneter im bayerischen Landtag geworden, denn er war von Geburt ein Münchener.“
„Der Mann interessiert mich. Könntest du mir einen Empfehlungsbrief an ihn mitgeben?“
„Ja, willst du denn nach Deutschland?“
„Mein Freund, der Marquis Soubise, hat in Deutschland zu tun. Da ich gerne eine wissenschaftliche Reise durch das mächtigste Land Europas unternommen hätte, habe ich mir vom Militärkommando Urlaub erbeten und erhalten. Du siehst, es wäre doch ein leichtes, nun das eine mit dem anderen zu verbinden.“
„Ach, Eugen, wenn du das vermöchtest! Einmal noch eine Heimat haben! Es würde so vieles zwischen dir und mir anders, glaube mir!“
Wieder flog ein hässliches Lächeln über sein gelbliches Gesicht.
„Du müsstest mir natürlich alles in die Hand geben, damit ich im Hause der Sanders eingeführt würde. Besonders deinen Bruder möchte ich zuerst kennen lernen. Der Marquis, den ich eingeweiht habe, wird als bekannter Sportsmann die Sache einleiten können.“
Else war Feuer und Flamme. Und als Eugen sie verließ, da zuckte ein triumphierender Zug um seinen Mund.
Eine Stunde später traf er den Marquis.
„Nun?“
„Es ist alles vorbereitet. Unser Werk kann beginnen.“
— — — — — — — — — — — — — — — — —
In einer der vielen Seitenstraßen der Grand Place liegt eine ehemalige Kaserne, die jetzt für militärische Zwecke eingerichtet worden war, ohne dass sich das Publikum ganz klar geworden wäre, welcher Art diese Zwecke waren.
Es machte sich wohl auch niemand Gedanken darüber, und die Leute gingen täglich mit gleichgültigen Blicken an diesem grauen Hause mit dem dumpfen Hof vorüber, aus dem manchmal, besonders in den Abendstunden, Offiziere kamen, auch des Öfteren Zivilisten, die schnell in einer Nebenstraße verschwanden.
Nach diesem Hause lenkte Eugen Rambaud seinen Schritt. Er war gegen Abend in Brüssel angekommen. Der Marquis, welcher mit ihm gereist war, hatte einen anderen Weg eingeschlagen, doch wollten sie sich beide in dem bezeichneten Hause treffen.
Die Dämmerung spann schon seine Schatten um die Spitzbogen des wundervollen Rathauses, über das schon Dürer in sein Tagebuch schrieb: „ . . . zu Brüssel ist ein sehr köstlich Rathaus, groß und von schönem Mauerwerk gehauen, mit einem herrlichen, durchsichtigen Turm . . .“
Selbst Eugen Rambaud, der im allgemeinen wenig Sinn für architektonische Kunstwerke hatte, blieb einige Minuten vor dem Hotel de Ville stehen und ließ seine Augen wieder über dieses einzigartige Denkmal einer kunstreichen Zeit schweifen, bis es schließlich an der mehrere Meter hohen Figur des Erzengels Michael haftete. Die scheidende Sonne warf ihre letzten Strahlen auf das vergoldete Kupfer, und eine weiße Wolke, die eben über den Turm des Rathauses segelte, wurde von dem Widerschein des Purpurs überstrahlt.
Hier, rings um die Grand Place, liegt die alte Bürgerstadt Brüssel, der Platz selbst ist ein zweiter Markusplatz, in flämischer Bauart gehalten.
Nun setzte der Leutnant seinen Weg fort, vorbei an alten Gildenhäusern, durch winklige dunkle Gassen, in die die Nacht früher einzog als in die breiten Straßen des Koudenberges.
Er verschwand in der Kaserne. Schnell ging er einige gewundene Treppen empor, an mehreren Schildwachen vorüber, die ihn nur auf Parole hin passieren ließen, bis er schließlich auf einen Unteroffizier stieß, der im Tone einer bestimmten Vertraulichkeit sagte:
„Der Herr Hauptmann ist bereits anwesend.“
Damit öffnete er eine Tür. Der Leutnant sah sich in einem großen Zimmer, von dem aber nur der Teil erleuchtet war, in dem ein mächtiger Schreibtisch stand. Dort hing von der Decke eine riesige Lampe nieder, doch hatte man offenbar bis jetzt noch nicht daran gedacht, elektrisches Licht einzuführen.
„Leutnant Rambaud“, meldete sich Eugen.
Ein bärtiger Offizier erhob sich am Schreibtisch. Er trug das Abzeichen des Generalstabes. Seine untersetzte, beinahe kleine Figur passte zu dem breiten Gesicht mit den finsteren Zügen, die auch das verbindliche Lächeln nicht erhellte, das jetzt um die brutalen Lippen spielte.
„Freut mich, dass Sie pünktlich sind, Herr Leutnant. Nehmen Sie Platz.“
Er reichte Raumbaud eine Zigarette. Beide Männer schwiegen eine Weile und bliesen den Rauch zur Decke empor.
Endlich begann der Hauptmann Belliard — ein Nachkomme jenes Belliard, der 1870 französischer Gesandter am belgischen Hofe gewesen war und dessen Standbild in der Nähe der Passage de la Bibliotheque steht: — „Ja, ja, mein Herr Leutnant! Wir gehen ernsten Zeiten entgegen.“
„Glauben Herr Hauptmann wirklich, dass wir kriegerische Verwickelungen bekommen?“
„Wir? — Wir wohl nicht. Wir sind neutral!“„ Er lachte leise durch seinen Bart. „Aber wir gestatten doch Frankreich den Durchmarsch!“
„Selbstverständlich. Das ist auch einleuchtend. Unsere Zukunft ist in jeder Hinsicht so unzertrennlich mit dem Geschick Frankreichs verknüpft, dass wir unbedingt auf der Seite dieses uns verwandten Landes stehen werden. Und in dem zukünftigen Kriege wird alles von einer schnellen Offensive abhängen. Frankreich wird mehrere Armeen zugleich in Deutschland einbrechen lassen, eine aber wird durch Belgien geworfen werden.“
„Ahnt man in Deutschland etwas von diesem Plane?“
„Mon dieu, mon lieutenant, wie können Sie eine so naive Frage stellen! Der Generalstab wird kaum schlafen, und die belgische Neutralitätsfrage ist so wichtig, dass Deutschland sich sicher schon mit der Möglichkeit befasst hat, selber einzumarschieren, falls es zum Kriege käme.“
„Sie halten das für möglich, Herr Hauptmann?“
„In der Theorie. In der Praxis — ausgeschlossen. Erstens würde sich Deutschland an unserer Armee so schwächen, dass sich nur mehr Reste von Marodeuren nach Frankreich retten könnten — ich sage: retten, denn von einem Kampf könnte keine Rede sein — zweitens würde England die willkommene Gelegenheit sofort ergreifen, der deutschen Flotte das Schicksal der Armada zu bereiten!“
„So ist es also wahr, dass England ein Bündnis mit Frankreich abgeschlossen hat?“
„Nach meinen Informationen ist dieses Bündnis sogar sehr weitgehend, wenn auch Sir Grey es in Verfolgung einer klaren diplomatischen Taktik ableugnet.“
„Und Herr Hauptmann haben sich schon mit dem Gedanken befasst, dass Belgien der Kriegsschauplatz werden könnte?“
„Mais naturellement! War nicht Belgien seit Jahrhunderten die blutige Walstatt, wenn die Völker aufeinanderschlugen? Vielleicht wird Deutschland schnell genug die Absicht Frankreichs durchschauen und einen Gegenzug versuchen — das sind Vermutungen, Herr Leutnant, über die Sie und der Herr Marquis de Soubise uns nun wohl bald Gewissheit verschaffen werden!“
Er rückte näher zu dem jungen Offizier heran. Seine Worte wurden von einem leidenschaftlichen Pathos getragen:
„Herr Leutnant Rambaud, Sie haben eine gefährliche Karriere eingeschlagen, das soll nicht geleugnet werden. In der jetzigen erregten Zeit wird man sie in Deutschland ins Zuchthaus sperren, wenn Sie Unglück haben. Aber wenn Sie geschickt sind — die höchsten Stellen der Armee warten auf Sie. Und welchen Dienst erweisen Sie ihrem Vaterlande? Ihr Name wird nicht nur in Belgien, auch in Frankreich gesegnet werden! Der Präsident der Republik interessiert sich sogar persönlich für das Gelingen des Planes, und Herr Pichon wird nicht mit seiner Protektion geizen, wenn das Werk gelingt! Wir müssen wissen, wie der Mobilmachungsplan Deutschlands angelegt ist und wie der Aufmarsch der Armeen an der Westgrenze vor sich gehen soll!“
„Herr Hauptmann, Sie werden mir glauben, dass ich von reinster Vaterlandsliebe durchdrungen bin; ich hasse Deutschland, dieses Land des finsteren Militarismus und des Barbarentums. Ich werde alles aufbieten und Leben und Freiheit einsetzen, um in den Besitz der Pläne zu gelangen!“ „Nachdem Ihnen ein so gewiegter Taktiker wie der Marquis zur Seite steht, wird das Werk gelingen“, sagte der Hauptmann und erhob sich, um den Franzosen zu begrüßen, der in diesem Augenblick eintrat. Die weiteren Verhandlungen wurden im Flüstertone geführt und drehten sich um das gleiche Thema:
„Nur mit List, nur mit List!“ mahnte der Hauptmann immer wieder, worauf der Franzose mit einem zynischen Lächeln hinzusetzte:
„Nur mit der Frau können wir etwas erreichen, Herr Hauptmann. Übrigens hat Herr Leutnant Rambaud famos vorgearbeitet, und Madame M. wird sicher auch diesmal nicht vergeblich eingreifen.“
Der Hauptmann lächelte.
„Wollen Sie mir das Geheimnis dieser Madame M., die durch alle 5pianagebureaus der Erde spukt, nicht entschleiern, Herr Marquis?“
„Herr Hauptmann, ich bin bereit, Ihnen mit jeder Gefälligkeit zu dienen, aber hier . . .“ „Sie haben recht. Reden wir nicht weiter von Madame M. und hoffen wir, dass sie den Deutschen ebenso verhängnisvoll wird wie den Engländern.“
„Herr Hauptmann!“
„Nun, Herr Marquis, wir dürfen mit offenen Karten spielen. Wer hat dem deutschen Generalstab den Wortlaut des Bündnisses zwischen England und Frankreich verraten? Drei Tage nach Abschluss war der deutsche Generalstab im Besitz der Abschrift!“
„Wie können wir dies wissen?“
„ „Madame M. warum diese Zeit in London!“
„Parbleu! Sie werden sich doch nicht einbilden, Herr Hauptmann, dass Madame M. gegen und für Deutschland zu gleicher Zeit spioniert?“
Der belgische Generalstäbler, der Chef des Spionagebureaus Belgiens, zuckte die Achseln.
„Wir haben auch Madame M. schon beobachten lassen. Freilich, wir sind noch nicht hinter ihr Geheimnis gekommen, aber sicher ist, dass sie nicht aus Vaterlandsliebe Spionage treibt.“
Der französische Agent schüttelte den Kopf.
„Nein; denn Madame M. hat kein Vaterland.“
„Eben. Sie verbraucht aber Unsummen.“
„Und sie leistet Bedeutendes.“
„Zweifellos. Doch kommen wir zur Sache —“
Der Unteroffizier trat ein und flüsterte dem Hauptmann etwas zu. Darauf dieser nach kurzem Besinnen:
„Wir haben vor Mr. Hay keine Geheimnisse, lassen Sie den Herrn Major eintreten.“
Er stand schnell auf und eilte mit lebhafter Begrüßung einem hochgewachsenen stämmigen Engländer entgegen, der mit einem raschen Blick die Herren musterte.
Hauptmann Belliard machte schnell bekannt. Der Major grüßte nur den belgischen Leutnant mit höflicher Note. Gegen den französischen Agenten blieb er kalt.
Denn es bestand ein sehr feiner Unterschied zwischen den Spionen, die aus militärischer Initiative und Vaterlandsliebe heraus handelten, und denen, die nur bezahlte Agenten waren.
Freilich fielen gerade dem letzteren die gefährlicheren Aufgaben zu.
Man sprach noch weiter über den vorliegenden Plan. Mr. Hay, der immer eine tiefe Falte über den Augenbrauen trug und seinem ganzen Aussehen an seinen Chef, Lord Kitchener, erinnerte, betonte auch seinerseits die Notwendigkeit, sich über die Aufmarschlinie der Deutschen klar zu sein.
„Überhaupt muss das Bestreben Frankreichs im Falle eines Krieges die schnelle Offensive sein“, bemerkte auch er. „Aber wir müssen wissen, welche Eisenbahnlinien französische Flieger zerstören sollen und wo das Zerstörungswerk unserer vorgeschickten verkleideten Pioniere einsetzen muss.“
„Wird England im Kriegsfalle Truppen in Belgien landen?“ fragte der Hauptmann.
„Yes. In Frankreich und Belgien. Wir stellen eine Million Soldaten auf.“
„Und weiß Deutschland, dass es mit England Krieg bekommen wird?“
„Das wollen wir eben wissen“, entgegnete der Oberst. „Denn wir wünschen, dass Deutschland Belgiens Neutralität verletzt. Es muss dies aber tun, wenn nicht der deutsche Generalstab versagt. Dies ist für uns die Causa belli. Verstehen Sie? Ein feingewebtes Netz, in dem sich Deutschland verstricken muss. Die Möglichkeiten sind einfach folgende:
Entweder respektiert Deutschland Belgiens Neutralität, dann verliert es den Krieg ohne weiteres und der Kampf wird auf deutschem Boden ausgefochten. Oder Deutschland tut, was es tun muss, es bricht in Belgien ein, dann hat Sir Grey den moralischen Konflikt, den er haben will. Am Kriege werden wir teilnehmen um jeden Preis. Die Frage ist nur: In welcher Form und wann. Darum wünscht meine Regierung, von Frankreich in Bälde Aufklärungen über den deutschen Aufmarschplan zu erhalten. Ich werde an die Ostgrenze gehen.“
„An die Ostgrenze?“ sagte der Hauptmann in grenzenlosem Erstaunen, aber der Engländer machte eine so undurchdringliche Miene, dass er weite keine Frage mehr tun wollte. Bis in den grauenden Morgen hinein dauerte die Konferenz. Dann waren alle Wege festgelegt, die zum gleichen Ziele führen sollten:
Zur Einkreisung Deutschlands — ein Ziel, an dem in diesen Sommertagen alle Kabinette Europas arbeiteten — mit Ausnahme einiger weniger kleinerer Staaten und der österreichischen Monarchie.
Ehe die Spione das Gebäude verließen, wandte sich der Marquis nochmals an den Hauptmann:
„Sie sondierten vorerst bei mir wegen des geheimnisvollen Verrats des französisch-englischen Bündnisses — ich will Ihnen ohne weitere Bemerkungen eine Spur verraten, Herr Hauptmann. Verfolgen Sie dieselbe, es wird im Interesse Belgiens liegen . . .“
„Name?“
„Dr. Hans Scholz.“
Der Hauptmann holte ein kleines Notizbuch aus seiner Tasche.
„Nationalität?“
„Deutscher.“
„Beruf?“
„Altertumsforscher.“
„Wohnt in . . .?“
„Löwen.“
„Schön. Ich danke Ihnen. Diese verfluchten Deutschen überschwemmen Belgien mit ihren Spionen. Ich werde nach einem Wege suchen, ihn festnehmen zu lassen.“
„Das wäre das beste“, sagte der Marquis mit einem heimlichen Lächeln.
Am nächsten Morgen reisten Leutnant Rambaud und der Marquis ab.