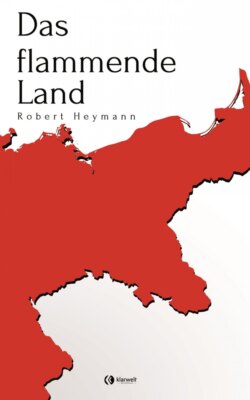Читать книгу Das flammende Land - Robert Heymann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel.
ОглавлениеDer Sohn des Archivrates Rambaud war noch nicht zu Hause. Aber Dr. Scholz lernte inzwischen Madame Rambaud kennen. Sie war eine elegante Vierzigerin mit lebhaften Manieren und ergriff sogleich die Führung der Unterhaltung. Sie sprach ein fließendes, reines Französisch, ohne jeden Dialekt, so daß ihr Gast nicht wenig verwundert war, zu hören, sie sei Südfranzösin.
„Ich habe mich aber vollkommen naturalisiert“, setzte sie hinzu, „und darf sagen, ich bin nicht weniger überzeugte Belgierin wie meine Tochter, die hier geboren ist und ihr Vaterland mit ganzer Hingabe liebt. Haben Sie ihren Namen noch nicht in den Zeitungen gelesen? Sie schreibt viel für die Gazette de Liège und für den Patriote in Brüssel . . .“
„Mademoiselle Rambaud . . . lassen Sie mich nachdenken.“
,.Yvonne Rambaud . . .“
„Ah ja, jetzl erinnere ich mich. Yvonne Rambaud — schreibt sie nicht sehr viel über die Hebung der belgisch-en Landwirtschaft, die sie gegenüber der industriellen Entwicklung ganz besonders von der Regierung begünstigt sehen möchte?“
„Ja, mein Herr! Ich sehe, Sie haben die Aufsätze mit Interesse gelesen.“
„Einige davon. Aber ich muß gestehen, daß mich manches zum Widerspruch reizte. Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die Hauptbedeutung Belgiens auf industriellem und handelspolitischem Gebiete liegt.
Beachten Sie: Der belgische Handelsumsatz beträgt ein Drittel des deutschen, die Bevölkerung aber nur ein Neuntel. Das sind doch Erfolge, die für sich selber sprechen!“ Ich muß Ihnen darauf die Antwort schuldig bleiben“, erwiderte Madame Rambaud, und setzte lächelnd hinzu: „Ich, müssen Sie wissen, stamme noch aus der alten Zeit. Ich habe nicht, wie meine Tochter, auf der Universität in Lüttich studiert. Mein Reich ist die Küche und meine Interessen liegen im Hause.“
„Womit Sie das eigentliche Reich der Frau beherrschen“, sagte Dr. Scholz mit einer leichten Verneigung. „Die Artikel ihrer Tochter sind jedenfalls mehr von der Liebe zum Bauernstand als von praktischen Kenntnissen beeinflußt.“
Er sagte das, nicht nur, weil es seine Überzeugung war, sondern auch, weil Yvonne Rambaud noch ein anderes Steckenpferd hatte: die Polemik gegen Deutschland.
Diese kam immer wieder in ihren Artikeln zum Durchbruch, und dieser Haß war ebensowenig durch Tatsachen begründet, wie ihre seltsame Auffassung über Belgiens Wirtschaftspolitik. Es war einfach eine persönliche Gefühlspolitik, die Yvonne Rambaud in den Blättern betrieb, die ihr aus Gott weiß welchem Grunde ihre Spalten öffneten. Dr. Scholz sah wieder einmal seine Überzeugung bestätigt, daß Frauen nicht geeignet seien, sich in Tagesfragen zu mischen. Er hielt nicht viel von den „studierten Frauen“, vielleicht nur deshalb, weil die Vorstellung einer intellektuell völlig gleichberechtigten Frau seinem ausgesprochenen Männlichkeitsgefühl widersprach.
Als sich die Türe öffnete und er flüchtig eine hohe, weibliche Erscheinung sah, dachte er an die deutsche Erzieherin. Eine unbeschreibliche Unruhe ergriff ihn, aber sofort wich diese Empfindung einem Gefühl des Staunens, mit Bewunderung gemischt, vielleicht auch mit angenehmer Enttäuschung, als die etwa zwanzigjährige junge Dame eintrat und Madame Rambaud sie ihrem Gaste sogleich vorstellte:
„Meine Tochter Yvonne . . . Herr Dr. Scholz . . .“
Aufstehend flüsterte sie Yvonne zu: „Ein bedeutender Mensch“ — und laut sagte sie: „Ich bitte dich, mein Kind, unseren lieben Gast zu unterhalten, ich will nur schnell einmal nachsehen, ob der Tisch in Ordnung ist.“
Fast gleichzeitig trat auch der Archivrat ein. Er wechselte mit seinem Gast einige höfliche Phrasen und dieser antwortete zerstreut; denn nie im Leben vorher hatte eine Frau eine solche Wirkung auf ihn ausgeübt wie Yvonne, die ihn mit dem Augenblick ihres Erscheinens vollständig in ihren Bann genommen hatte.
Sie war von bezaubernder Schönheit.
Mehr Frau in ihrem Äußeren als Mädchen hatte sie etwas Überlegenes, wozu die hohe schlanke Figur noch beitrug. Ein kleiner, kräftig gezeichneter Mund, den das weiche runde Kinn wieder vollendet frauenhaft machte, die hochgeschwungenen Brauen verrieten einen festen Willen, die Nase war gerade, edel, die Flügel bebten, wenn sie sprach, wie in verhaltener Leidenschaft. Die mandelförmig geschnittenen Augen verliehen ihr fast etwas Orientalisches, aber die Pupillen hatten nichts von dem weichen, verträumten Schmelz einer Slavin. Sie waren klar und groß, voll Feuer und Kraft, und ohne weiteres mußte sich Dr. Scholz gestehen, daß eine ungewöhnliche Intelligenz aus ihnen sprach — eine Intelligenz allerdings, die leicht von jener lauernden Leidenschaftlichkeit beherrscht wurde, die das ganze Antlitz ausdrückte, sogar die widerspenstigen kastanienbraunen Haare, die die Stirne in zwei Flügeln rahmten.
„Sie erinnern mich an ein Gemälde“, sagte er leise, nachdem er ein paar belanglose Worte mit ihr gewechselt hatte. „Im Antwerpener Museum hängt ein Bild von Jordaens: ,Wie die Alten sungen, so pfeifen die Jungen‘. . .“
Sie unterbrach ihn mit einem herzhaften Lachen, in dem ein voller, weiblicher Ton mitklang, der ihn erbeben ließ:
„Nun wollen Sie mich wohl gar mit der Dame im Mittelstück des Bildes vergleichen . . .“
„Sie nahmen mir das Kompliment —vorweg, mein Fräulein!“
„Nun, mein Herr, ich bin gewohnt, daß man mir Schmeichelhaftes sagt, aber ich muß gestehen, Sie wählen dafür eine originelle Form. Denken Sie nicht, ich fühlte mich nun verpflichtet, die Schmeichelei mit gleicher Münze zurückzugeben! Ich finde aber, daß Sie das Aussehen eines Gelehrten haben, wie ich ihn mir vorstelle: Kein altersschwacher Bücherwurm, sondern ein kluger Mensch voll frischer Männlichkeit, der mit dem Verständnis der Jugend aus dem Vollen schöpfen kann.“
Er lächelte, diesmal wirklich verwirrt:
„Sie machen mich verlegen. Meine Verdienste sind bisher so kleine . . .“
„O, treiben Sie keine konventionelle Politik der Bescheidenheit. Ich pflege mich bei meinem Vater stets vorher über die Gäste zu erkundigten, die ich bei Tisch sehen werde, und Ihr Name ist mir aus mehreren archäologischen Zeitschriften nicht mehr unbekannt.“
„Wirklich? Sie haben meine Essays gelesen?“
„Sicherlich viele davon. Und ich freue mich aufrichtig, mich wieder einmal mit einem Manne unterhalten zu können, der etwas zu sagen weiß. Wir sind mithin Kameraden, Herr Dr. Scholz, und jedwedes Kompliment ist von jetzt an zwischen uns verpönt — wollen Sie mir das auf Handschlag versprechen?“
Sie reichte ihm eine schmale, gepflegte, kräftig geformte Hand. Er schlug mit Herzlichkeit ein.
„Also Kameraden, — obwohl — ich Deutscher bin?“
Sie lachte belustigt.
„Ich beiße Sie deswegen nicht, Doktor. Ja, ich gestehe, ich hasse eine bestimmte Art non Deutschen, aber das sind Preußen. Und zwischen Deutschen und Preußen besteht ein gewaltiger Unterschied . . .“
„Wohl nur in der Diktion.“
„Nein, überhaupt. Unter Preußen verstehe ich die Potsdamer Wachtparade, wie man in Europa die militärischen Maschinen des Königs Friedrich, den die Preußen den Großen nennen, getauft hat. Ich meine also das preußische Militär, diese Sklaven des Drills, diese Offiziere, deren soldatische Anmaßung die ganze Welt unterwerfen möchte. Das ‚Volk der Dichter und Denker‘ hasse ich nicht, denn ich weiß sehr wohl, daß die Intelligenz in Deutschland sich in einem steten, erbitterten Kampfe mit dieser rohen Diktatur der Gewalt befindet, die sich in allen Regierungs- und Verwaltungsgebieten behauptet.“
Er hatte mehrmals den Kopf geschüttelt.
„Wie sehr verkennen Sie Deutschland, mein Fräulein, und wie oberflächlich urteilt das Ausland über das herrliche Ringen zwischen einer ungehemmt und schrankenlos vorwärtsstrebenden intellektuellen Jugend und dem fundamentalen Gesetz der deutschen Ordnung! Gerade in diesem Ringen der Parteien drückt sich kein Konflikt aus, wie sie glauben, sondern es ist der Ausdruck einer uneingedämmten Kraft, eines Überschusses an Kräften, die dieses Land stets und in alle Ewigkeit einzusetzen hat.“
„Sie sympathisieren also mit dem militärischen Drill?“
„Dieser militärische Drill ist von der höchsten Geisteskraft durchflutet, mein Fräulein, was schon daraus hervorgeht, daß fast alle Vertreter des Handels, der Intelligenz und der Kunst als Reserveoffiziere dem Heere angehören.“
Sie zuckte die Achseln.
„Sie wollen nichts auf Ihr Vaterland kommen lassen. Ich achte diesen Standpunkt, denn sonst leugnen gerade die Deutschen ihre Nationalität im Auslande gerne ab. Im Herzen denken Sie ja doch anders.“ Und lachend setzte sie hinzu: „Sie als preußischer Unteroffizier — nein, wissen Sie, dagegen sträubt sich meine gesunde Vorstellung.“
Die Hausfrau bat zu Tisch. Eben traten auch Leutnant Rambaud ein, und — wahrhaftig, dachte Dr. Scholz, er hat die Frechheit! — und stellte seinen Freund vor:
„Marquis Julien de Soubise . . .“
Wie ganz anders war Yvonne gegen diesen neuen Gast als gegen Scholz! Vollendete Dame, beinahe herablassend, ließ sie kaum eine oberflächliche Unterhaltung zwischen sich und dem Marquis, der ihr Tischnachbar war, aufkommen:
Neben der Dame des Hauses hatte die Erzieherin Platz genommen. Yvonne schien zu glauben, Dr. Scholz habe sie noch nicht gesehen oder gesprochen, denn sie wandte sich zu ihm:
„Ein Fräulein von Sandern, unbedeutend und harmlos, ich glaube, Mama hat sie nur engagiert, weil sie adelig ist.“
Von diesem Augenblick an war der Doktor schweigsam und verstimmt. Denn Elsa von Sanderns Augen hatten eben auf ihm geruht, als Yvonne diese taktlose und häßliche Bemerkung machte, mit der sie gleichzeitig verriet, daß sie die Deutsche haßte.
Aber je kühler der Doktor war, desto mehr unterhielt sich Yvonne gerade mit ihm, zum Ärger des Grafen, der schon bei der Vorstellung dem Deutschen eine Antipathie zu erkennen gegeben hatte.
Jetzt warf er ihm von Zeit zu Zeit einen forschenden Blick zu, in dem sich nur allzudeutlich der Haß spiegelte, den die Bevorzugung, die ihm die Tochter des Hauses zukommen ließ, mit jeder Minute steigerte.
Als er zu Eugen hinüberblickte, machte dieser eine sonderbare Handbewegung, etwa als wollte er sagen: Nur Geduld! Diesen lästigen Ausländer wollen wir schon noch kalt stellen!
Es erging dem Marquis wie dem Deutschen: Er war gefesselt durch die majestätische Schönheit Yvonnes, während diese ihn links liegen ließ.
Der Doktor sah mit einem Gefühl der Beschämung zu seiner deutschen Landsmännin hinüber. Er erinnerte sich der Vorgänge vom verflossenen Morgen und daß ihn eigentlich gerade der Liebreiz des jungen wieder hierhergezogen hatte.
Und nun konnte er in einem Augenblick so völlig auf sie vergessen!
Am liebsten hätte er ihr Abbitte geleistet — mit den Augen wenigstens — hätte ihr gezeigt, daß er sich auch mit ihr unterhalten wollte, denn es interessierte ihn so vieles aus ihrem Leben — aber sie hielt die Augen auf ihren Teller gesenkt.
Kam es nur ihr so vor, oder lag über ihr der Schimmer einer Hilflosigkeit die ihn rührte und bedrückte zugleich? Manchmal warf sie einen scheuen Blick zu dem Leutnant hinüber — nein, dachte der Deutsche, Liebe drückt dieser Blick nicht aus, und der finstere überlegene Ausdruck, mit dem Eugen Rambaud seine Braut zu mustern pflegt, erinnert mehr an Gewalt als an Zärtlichkeit.
Sie sind verlobt — und sie wechseln bei Tisch kein Wort zusammen. Madame Rambaud ist von konventioneller Höflichkeit zu ihr, und die Bemerkung Yvonnes —
Seltsam, seltsam, dachte er für sich. Die Verlobung scheint geheim gehalten zu werden, wenigstens wissen offenbar weder der Vater, noch die Mutter, noch die Schwester davon. Vielleicht hatte Elsa von Sandern bloß in der ersten Verwirrung ihn eingeweiht und war darum von dem Leutnant nachher zur Rede gestellt worden . . .
Das war alles so merkwürdig und unnatürlich in diesem Hause. Yvonne zog ihn wieder ins Gespräch.
Sie erzählte ihm, daß. sie in London erzogen sei.
„England ist wunderschön, und die englische Nation verehre ich. Kennen Sie London?“
Er mußte verneinen. In Italien war er schon gewesen und in Holland und in Polen . . .
„Russisch Polen?“
„Ja. Ich habe dort einen Bruder, in Kielce. Der baut russische Bahnen und ist mit einer Polin verheiratet.“
„Wie interessant! Er kommt nie mehr nach Deutschland?“
„Vorläufig wohl nicht; denn er ist sehr glücklich verheiratet. Freilich, durch jeden seiner Briefe klingt die Sehnsucht nach der deutschen Heimat, nach den deutschen Eichen.“
„O, ich kann mir nicht vorstellen, daß der Deutsche im Auslande so sehr Heimweh hat. In London leben so viele Deutsche, die sich ganz als Engländer fühlen, und erst in Amerika . . .“
„Zugegeben! Lassen Sie aber einmal das Vaterland nach all denen rufen, die jetzt mit ausländischen Mänteln prunken, dann sollen Sie sehen, wie diese Mäntel fliegen und der deutsche Panzer sichtbar wird!“
„Wir wollen es abwarten, Herr Dr. Scholz. Nach meinen Informationen wird es ja nicht mehr allzulange dauern, bis die eisernen Würfel fallen. Sir Grey zum Beispiel, ein Freund der Familie, in der ich in London lebte, äußerte sich erst vor kurzem noch sehr pessimistisch über Österreich.“
„Deutschland, mein Fräulein, will den Frieden. Wenn aber einmal ein frecher Nachbar wagen sollte, an unsere heiligsten Güter zu tasten, dann, ja dann würde das Volk im Sturme aufstehen und dann würde in Europa wieder ein Lied gesungen werden von dem deutschen Zorn!“
Er hatte sich in Hitze geredet. Seine letzten Worte waren von allen verstanden worden.
Es war eine Pause in der Unterhaltung eingetreten, die Madame Rambaud benutzte, die Tafel aufzuheben.
Dr. Scholz fühlte einen Moment das Peinliche der Situation. Er war ärgerlich über sich selbst, daß er sich nicht mehr im Zügel gehabt. Aber da traf ihn ein Blick Elsa von Sanderns, ein so warmer, herzlicher, dankbarer Blick, daß er sogleich die Gelegenheit benützte, zu ihr zu treten:
„Ich fühle, daß. Sie so denken wie ich, gnädiges Fräulein!“
„Oh! Sie haben mir aus der Seele geredet! Ich hasse diese Menschen hier! O, wie ich sie hasse!“
„Sie hassen? Können Sie denn hassen?“
Sie schlug die Augen auf. Ein Feuer loderte in ihnen.
„Wenn Sie wüßten — wenn Sie wüßten, was man mir hier angetan hat, wie man mich demütigt und was man mir noch antut.“
„Wie, mein liebes gnädiges Fräulein, man behandelt Sie schlecht?“
„Nein, das ist es nicht. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen. Nur warnen möchte ich Sie. Nehmen Sie sich in acht!“
Er zuckte die Achseln — aber da fiel ihm sein Erlebnis auf der Landstraße ein. Er nickte ihr dankbar zu. Sie zog sich zurück, mit einem verlorenen Lächeln auf den Lippen, das ihm ins Herz schnitt.
Was war ihr? Konnte er ihr denn nicht helfen? Er wollte es doch — aber nun mußte er sich nach Yvonne umsehen!
Sie unterhielt sich mit ihrem Bruder und dem Grafen.
Der Archivrat zog ihn ins Gespräch.
Zwischen Yvonne und den beiden Männern fand eine erregte Auseinandersetzung in der Fensternische statt. Der Doktor konnte es bemerken, ohne doch ein Wort von dem zu erhaschen, was gesprochen wurde.
„Und ich wiederhole dir, daß es ein deutscher Spion ist“, sagte der Bruder eindringlich.
„Nein, ich mache diese Sucht, die ich in England schon hinreichend kennen gelernt habe, nicht mit“, erwiderte Yvonne, aber der Klang ihrer Stimme war nicht mehr fest.
„Sie wollen nicht glauben, daß Deutschland alle Welt mit seinen Kundschaftern überschwemmt?“ warf der Marquis ein. „Ah — in Frankreich ziehen sie umher als Leierkastenmänner, arbeiten in den Steinbrüchen, schleichen sich in unsere Bureaus, ja sogar die Legionen ihrer dienenden Frauen haben sie mobil gemacht! Jeses zweite Kindermädchen, jede Bonne in Paris ist eine Spionin!“
„Ammenmärchen!“
„Wir haben Beweise!“
„Auch daß Dr. Scholz ein verkappter Spion ist?“
„Das wissen wir aus seinem Benehmen — ja, wenn wir Beweise hätten!“
„Er ist doch so ganz in deinem Bann, liebe Schwester, daß es dir nicht schwer fallen kann, ihn auszuholen“, sagte Eugen. „Er wird Frauen gegenüber genau so tölpelhaft sein wie alle Deutschen.“
„Sie sind Hunde, diese Prussiens!“ setzte der Marquis hinzu.
Sie lehnte sein zudringliches Lächeln mit einem kühlen Blick ab.
„Ich kann mich nicht dazu hergeben, Polizeidienste zu übernehmen“, sagte sie, zu dem Bruder gewandt. „Wenn ich aber im Laufe weiterer Unterhaltungen mit Dr. Scholz die Überzeugung gewinnen sollte, daß er ein Spion ist, werde ich nicht zögern, die Beweise dafür der Polizei zu übergeben.“
Der Marquis nickte. befriedigt. Er beugte sich über Yvonnes Hand mit einigen 5chmeichelworten, die sie mit kalter Herablassung entgegennahm.
„Er darf nicht nach Deutschland zurück“, sagte Eugen entschlossen zu seinem Freunde. „Sie hätten dort nicht die geringsten Chancen mehr!“
„Das ist wahr. Wie weit sind Sie mit der Deutschen?“
„Ich habe nicht ganz in ihr Vertrauen eindringen können. Ich verfüge nicht über die sentimentale Note, die diese deutschen Mädel lieben. Aber ich weiß so ziemlich alles, was wir wissen müssen. Der Bruder steht bei der Artillerie, ist seit einiger Zeit in Berlin. Der Onkel sitzt im Generalstab. Vollkommen verarmte Familie, aber, wie meine Informationen lauten, tadellos. preußische Unantastbarkeit, verstehen Sie!“
„Wird man also mit List arbeiten müssen.“
„Unter Umständen auch mit Gewalt.“
Sie hatten sich ganz leise unterhalten. Niemand konnte ein Wort davon verstehen . . .
Als Dr. Scholz nach Hause kam, fand er einen Brief seines Bruders aus Polen vor.
Darin war allerhand Interessantes:
„Meine Frau und die Kinder lassen Dich vielmals herzlichst grüßen. Hier ist nicht alles, wie es sein soll. Über die fürchterliche Wirtschaft, die überall herrscht, wo russisches Regierungssystem eingeführt ist, habe ich Dir ja schon oft genug geschrieben. Aber hier geht es seit Neuestem ganz unglaublich zu. Der neue Gouverneur von Kielce scheint mit dem besonderen Auftrag hierher geschickt worden zu sein, polnische Geheimklubs — deren es ja etliche gibt — aufzuspüren.
Da weder er noch seine famosen Polizeiorgane in der Lage oder auch nur fähig sind, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, so werden hier die rigorosesten Haussuchungen vorgenommen. Man könnte wirklich denken, man stünde am Vorabend ganz besonderer Ereignisse, wenn man den brutalen Eifer beobachtet, mit dem die Behörde hier diejenigen sucht, die nicht der Meinung sind, daß das russische Regiment das beste aller Regierungssysteme sei.
Ich bin nun zufällig einer der „Eingeweihten“, und wenn die Sache nicht ein so ernstes Gesicht hätte, wenn diese sinnlosen Verhaftungen, die meist Unbeteiligte treffen, nicht in den überwiegenden Fällen Verbannungen, Verschickungen nach Sibirien, Armut, Not, unglückliche Frauen und jammernde Kinder im Gefolge hätten, so würde ich die ganze Geschichte wirklich von der humoristischen Seite nehmen.
Ich habe nämlich einen Freund, einen sehr guten Freund, dem ich außerordentlich zugetan bin, einen Chemiker, der einer geheimen polnischen Verbindung angehört. Der hält mich auf dem laufenden. Du kannst ohne Sorge sein, lieber Hans, ich halte mich selbstverständlich weit ab vom Schuß, denn was gehen mich im Ernst die innerpolitischen Verhältnisse dieses Landes an. Doch mich packt manchmal ein heiliger Zorn, wenn ich in das russische System hineinsehe, und dann wünschte ich fast, ich könnte teilnehmen an der Auflehnung gegen die Kosakenwirtschaft. Freilich trägt Sonja ihr Teil zu dieser Stimmung bei.
Sie ist nun einmal mit Leib und Seele Polin. Und seit Jahrhunderten steckt diesem Volke der Begriff der freien Persönlichkeit so unausrottbar im Blute, daß man sich keinen größeren Gegensatz denken kann als diese Nation und die Wirtschaft, die hier herrscht und die im schlimmsten Sinne eine „polnische“ ist.
Du weißt, daß meine Frau aus jüdischen Kreisen stammt. Sie glaubt Anzeichen dafür erkannt zu haben, daß man in Rußland — und auch bei uns — in Regierungskreisen wieder gegen die Juden hetzt. Ich habe hier Gott sei Dank noch kein Pogrom erlebt, aber Sonja sagt, die Polizei brauche wieder ein Ventil für die wachsende Not und Unruhe unter der niederen Bevölkerung. Das ist eben das Schlimme im Wesen dieser durch keine fundamentale Bildung gefestigten Massen:
Sie fühlen das Verbrecherische in dem System, sie haben förmlich das instinktive Bedürfnis, sich aufzulehnen, bessere Zeiten zu erringen, aber schließlich verfehlen sie stets das gute Ziel und lassen sich von den schlechtesten Machenschaften leiten, so daß sie das Gute wollen und — einen Pogrom arrangieren. Ich spreche da natürlich von dem besseren Teil der Bevölkerung, nicht von dem Gesindel, das sich hier in allen Schichten herumtreibt und für Väterchen spioniert.
Unser Isprawik an der Ecke hat auch so einen Freund in unserem Hause, das ist unser Hausmeister, ein ehemaliger Donkosak, der die Knute mit dem Gummiknüttel vertauscht hat (sobald nämlich die Polizei Hilfe braucht, alarmiert sie die Hausmeister der betreffenden Straße, die dann mit Gummiknütteln zu ihrer Unterstützung herbeieilen). Er ist so gut ein Spion wie unsere Zofe Natuschka — ich durchschaue sie ja alle.
Aber glücklicherweise gibt es bei uns nichts zu spionieren, denn wir leben ganz abgeschieden und für uns, und bis auf die zwei Abende in der Woche, wo Sonja einen akademischen Kurs besucht, sind wir stets zu Hause.
Die Deutschen sind bei den Russen nicht sehr beliebt, na, das weißt Du ja, aber wir kümmern uns nicht darum. Zwischen Serbien und Österreich scheinen sonderbare Leute zu „wechseln“. Man erzählt sich hier allerhand, was wohl übertrieben ist.
Der österreichische Thronfolger ist in Russland geradezu verhaßt. Sie scheinen ihn zu fürchten. Die „serbischen Brüder“ sollen sich jedenfalls nicht zu mausig machen. Ich meine immer, Franz Ferdinand wird nicht allzulange Geduld mit ihren Unverschämtheiten haben. Ach, wenn man hier so sieht, wie alles morsch und faul ist, möchte man zu dem Allwissenden beten, daß er einmal mit einem eisernen Besen durch Europa fahren und unter diesem Gesindel aufräumen möchte! Hoffentlich hält die Freundschaft zwischen Deutschland „und England an — diese beiden Mächte, mit Österreich vereint, könnten das Jahrhundert in die Schranken fordern.
Doch nun schließe ich, bitte Dich, recht bald von Dir hören zu lassen und küsse Dich und unsere gute Mutter zu Hause — und mit Euch das liebe, goldene Deutschland! — tausendmal Dein treuer Bruder Franz . . .“
Hans Scholz holte tief Atem.
Er riß an seinem Hemdtragen.
Sonderbar, dachte er. Sonderbar. Es weht so etwas wie Gefahr aus diesem Briefe. Ich verstehe es nicht — aber es ist da — es hockt in den Ecken und stiert mich an mit gläsernen Augen — ich will ausgehen und auf andere Gedanken kommen. —