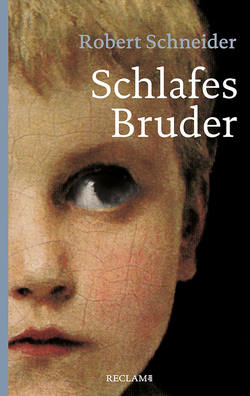Читать книгу Schlafes Bruder - Robert Schneider - Страница 12
Die Gadenzeit
ОглавлениеNachdem Gott den Elias auf so wunder- wie grausame Weise hörend gemacht hatte, wurde es in dem Jungen still. Allein um den Jungen wurde es nicht still. Darum versteckten die Alderschen Eheleute ihn ängstlich vor dem Zugriff der Öffentlichkeit, kerkerten ihn unter Maulschellen, Ohrfeigen und Stockhieben in seinen Gaden, den er ungefragt nicht mehr verlassen durfte.
In den sonst stillen Hof des Seff Alder kam Leben. Alle nur erdenklichen Verwandten – das waren nahezu alle Eschberger – befanden auf einmal, es sei endlich wieder an der Zeit, die Lieben im Weiler Hof zu besuchen. So kamen sie unter den hinterfotzigsten Vorwänden ins Haus, zeigten gespieltes Interesse am Gedeih des Viehs, lobten eindringlich den sauberen Stall und daß keine Kuh auf ihrer Klatter liegen müsse, schnupperten angetan an dem so auffallend trockenen Heu, tranken übermäßig vom aufgetischten Most, priesen laut die so ungewöhnlich saubere Küche der Seffin und frugen endlich allesamt nach dem Befinden des lieben und ach so bedauernswerten Kindleins. So hofften sie, den Kretin zu Gesicht zu bekommen, aber Seff und sein Weib antworteten monoton: »Der Gob ist marod, hat Fleckenfieber.«
Späteren Besuchern fiel auf, daß der würzige Most nicht mehr aufgetischt wurde, und daß der Bub jetzt schon über das gewohnte Maß hinaus im Scharlach liege. Als gar Nulf Alder, der Todfeind, die Hausschwelle betrat, riß dem armen Seff der Geduldsfaden. Er packte den Bruder bei den Schultern und stopfte ihn in ein Schneeloch. Niemand bekam den Jungen zu Gesicht.
Das bewog eine Handvoll Eschberger Kinder – aufgewühlt durch die geheimnisvollen Mutmaßungen der Alten – nach der Christenlehre einmal zum verwunschenen Hof zu schleichen. Das Fenster des Bubengadens hatte man schon früher ausfindig gemacht. Dorthin zogen sie nun und verhöhnten den Elias ob seiner Augen, gelb wie Kuhseiche. Er solle sich doch am Fenster zeigen und ihnen das Kunststück seiner Stimme vorführen. Elias hatte ihr Kreischen schon vernommen, als sie vom Kurateihaus herüber tänzelten. Er zog den Laubsack ins Gesicht, wollte schweigend warten, bis daß der Spuk vorüber wäre. So sehr er die Hände gegen die Ohren stemmte, es half nicht. Als die Beschimpfungen nicht enden wollten und eines ihn laut Gelbteufel schalt, hielt es ihn nicht mehr. Er sprang ans Fenster, riß es auf und stieß einen derart brüllenden Schrei hinab auf die Köpfe, daß auf der Stelle alles in heulender Angst davonstob. Noch tagelang flennten die Kinder davon, daß ihnen der Gelbseich wahrhaftig erschienen sei.
Ein Kind jedoch blieb ruhig unterm Fenster stehen. Es hieß Peter Elias und war der Sohn des Nulf Alder. Wir sind ihm schon begegnet, denn es wurde mit unserem Elias getauft. Peter stand und rührte sich nicht mehr von der Stelle. Nicht, weil er unter Schock stand, keineswegs. Peter blieb aus einer plötzlich erwachten kalten Faszination an dem so Andersgearteten. Und er hörte, wie der da oben in ein lautes Weinen ausbrach. So herzzerreißend weinte Elias in den Frühlingsabend hinaus, daß die jungen Bündtgräser traurig niederwogten und das Rauschen vom nahen Wald herüberdrang wie ein Schluchzen. Aber Peter empfand keine Rührung. Er stand mit offenem Mund, und seine Augen stachen kalt in den da oben. Von diesem Tag an suchte Peter die Freundschaft des Elias zu gewinnen. Anfänglich stand er jeden Abend unterm Gaden. Dann kam er seltener, aber mit einer beharrlichen Beständigkeit. Er brauchte nicht zu pfeifen, sich nicht durch Käuzchenrufe bemerkbar zu machen. Elias erwartete ihn.
Wir dürfen behaupten, daß Peter der einzige Mensch im Leben des Elias Alder gewesen ist, der das Genie dieses Menschen erkannte. Er ahnte, daß dem Elias Großartiges gegeben war. Und weil er diese Ahnung sein Lebtag nicht mehr loswerden konnte, trachtete er, den Elias niederzuhalten. Und Elias gehorchte dem Freund fast willenlos. Gehorchte aus naiver Dankbarkeit dafür, daß ihn ein Mensch in den bittersten Stunden seines Lebens nicht im Stich gelassen hatte. Elias liebte den Peter.
Zwischenzeitlich unterließ die Seffin alles, was einer günstigen Entwicklung ihres frühreifen Jungen hätte förderlich sein können. Sie sprach nicht mit ihm, stellte die Suppe vor die Gadentür, wie man einer Katze die Milch hinstellt. Anfänglich vermied sie jede Berührung aus Angst, sich am Gelbfieber seiner Augen anzustecken. Zärtlichkeit, ein solches oder ähnlich lautendes Wort, war ihr und den meisten Eschberger Weibern unbekannt. Auch trug sie immer weniger Sorge um seine Reinlichkeit, weshalb es schließlich dahin kam, daß Elias verdreckte und verlauste. Üblicherweise wusch sie ihre Kinder samstäglich, und ihr Traum als junges Mädchen war es gewesen, die Kleinen dereinst mit den glanzigsten Näschen und saubersten Kräglein dem Kirchenvolk zu präsentieren. So etwas auch nur geträumt zu haben, stellte sie jetzt energisch in Abrede. Die Seffin ließ sich gehen. Sie verrohte, und daß ihre Küche so ungewöhnlich sauber gewesen sein soll, stimmte natürlich mit keinem Wort.
Einmal noch schöpfte sie Hoffnung, raffte sich auf aus ihrer lebensmüden Apathie und sang wieder die Lieder ihrer Mädchenzeit. Die Hoffnung währte nur einige Tage. Geschürt hatte sie die Haintzin, des blinden Mesmers Weib. Die Haintzin riet ihr, es beim Jungen mit verschiedentlichen Abreibungen, Aufgüssen und Umschlägen zu probieren. Die Idee sei ihr gekommen, schnaufte sie, wie sie nichtsdenkend in den grünen Maimorgen geblinzelt habe. Grün, überall Grün, habe sie gedacht. Es müsse doch möglich sein, etwas von diesem Grün dem Elias zurückzugeben, und sie wisse auch schon wie.
Man versuchte es zuerst mit den Blättern des Löwenzahns, befeuchtete sie mit Speuz und klatschte sie dann auf die geschlossenen Lider des Kindes. Elias durfte sich den ganzen Nachmittag nicht ein Rückchen von der Stelle rühren. Am Abend löste man die erlahmten Blätter in der Erwartung, ein herrliches Löwenzahngrün in den Pupillen vorzufinden. Allein die Kerze leuchtete neidisch hinein in ein Gelb, das ihr eigenes Gelb verblassen machte.
Am nächsten Tag ging man früh ans Werk, streifte den halben Vormittag über die Bündten, sammelte Schürzen von Kräutern und überhaupt alles, das sich durch ein veritables Grün auszeichnete. Gar die Jährlinge der Rottannen, die man sonst zu Honig verkochte, brockten die emsigen Weiber. Die Haintzin riet, es mit den Jährlingen zuerst zu versuchen. Das führte allerdings zu dem Ergebnis, daß, nachdem die Trieblinge in siedendem Wasser gesotten und man das Wasser auf die Lider geträufelt hatte, der arme Elias schwere Verbrühungen davontrug. Kaum war der Elende genesen, ersann die Haintzin eine neue Methode, das Grün der Pupillen herbeizuführen.
Die Idee sei ihr gekommen, wie sie nichtsdenkend das Abendgras für ihr Vieh gesenst habe. Da es sich um ein innerliches Siechtum handle, könne man – Mein Gott und mein Herr, daß ihr das erst jetzt aufgehe! – selbiges auch nur innerlich behandeln. Also nahm sie einen Suppenteller und rieb etwas Birken- und Weißbuchenrinde hinein, vermengte die Rinde mit Faltrianblättern, Schmerwurz, Seidelbast und Türkenbund und träufelte zwei Löffel Erstmilch einer frischgekalbten Kuh hinein. Das Ergebnis führte diesmal zu einem nachtlangen Magenkrampf, und als sich die Weiber anschickten, es mit einer abermals neuen Kur zu versuchen, schmetterte sie der Bub mit einem lauten, bösen Röhren aus dem Gaden. Es blieb der Haintzin versagt, das melancholische Regengrün seiner Augen wieder zum Leuchten zu bringen und sie kehrte von da an nur noch selten bei ihrer Freundin ein. Es gebe, entschuldigte sie sich, neuerdings so viel Arbeit und eine Kalberei nach der anderen auf ihrem Hof.
Zwei Winter lebte Elias im Gaden eingesperrt. Hie und da kam Peter, stand schweigend unterm Fenster, stierte hinauf und ging wieder. Nulf, der Vater, Seffs Bruder und Todfeind, vermochte ihm diese Besuche nicht auszutreiben, nicht einmal durch blutige Prügel. Peter kam, schwieg und ging wieder. Die Jungen sprachen kaum drei Worte miteinander. Aber die eigenwillige Treue des Peter bewirkte, daß Elias Zutrauen zu ihm fand.
Der Weiße Sonntag kam. Elias hätte schon vor einem Jahr kommunizieren sollen, doch hatte die Mutter beim Kuraten eine Verschiebung erwirkt. Der Junge sei ganz unerwartet an einer schmerzvollen Gliedersucht erkrankt, log die Seffin, und derzeit plage ihn eine misteriose Schmalbrüstigkeit, gepaart mit fürchterlichem Kopfgrimmen. Man solle die Kommunion um abermals ein Jahr verschieben. Das mochte der Kurat Friedolin Beuerlein nun nicht mehr glauben und betrat festen Entschlusses den Hof des Seff Alder. Kurat Beuerlein war ein gutmütiger, dürrer und sehr langnasiger Herr. Als nach ruhigem Zureden sich die Eheleute noch immer nicht bereitfanden, den Elias kommunizieren zu lassen, tat der Kurat einige für ihn ungewohnt harte Worte und fing an, den viehischen Starrsinn der Eltern aufs heftigste zu tadeln. Seff und sein Weib blieben stur. Erst als der Kurat alle nur erdenklichen Höllenqualen für eine derartige Todsünde ins Treffen führte, willigte Seff ein. Sein Weib nicht. Es sei ihr gleichviel, bockte sie, wenn sie in der Hölle auf einer Lanze aufgestochen dahinschmore. Der Bub gehe nicht zur Kommunion.
Ohne den Hergang der Kommunion im einzelnen auszubreiten (das Gaffen und Halsgerenke, das jähe Verstummen des Kirchenvolks, als das Kind im Baß zu singen anhob), wollen wir dennoch festhalten, daß kein Kommunikant so fromm und lauter das Jesulein in sein Herz kämmerchen treten ließ als unser Elias Alder. Beim anschließenden Mahl im Gasthaus zum Waidmann war der Bub aber schon wieder verschwunden, und für die Zukunft hielt es die Seffin so, daß er zwar die Messe besuchen, jedoch die Kirche erst beim zweiten Kyrie betreten und noch vor dem Segen des Kuraten wieder zu verlassen hatte. Als Platz wies sie ihm die hinterste Bank der Epistelseite, dort, wo die tabakkäuenden Greise ihr Sonntagsnickerchen zu halten geruhten.
Wir richten unsere Augen wieder auf die Mutter unseres Helden, von der wir sagten, daß sie aufgrund ihres abnormen Kindes den Lebensmut verloren hatte. Diese Behauptung soll durch eine Episode untermauert werden, die sich am Festo Trinitatis desselbigen Jahres zutrug.
Am Festo Trinitatis wurde Kirchweih abgehalten, und das Fest endete zumeist in wüsten Händeln, gegenseitigen Beschimpfungen und durchaus blutigen Scharmützeln. An keinem anderen Tag des Jahres traf sich die ganze Bauernschar auf einem einzigen Flecken versammelt, nämlich auf der Bündt vor dem Kirchlein. Und an keinem Tag trank man so wüst in sich hinein als eben am Kirchweihtag, denn es gab Kirschgeist umsonst.
Das Fest begann mit einem Amt im Freien. Den Altarbezirk umgab ein lieblich gesteckter Blumenteppich aus Margeriten- und Löwenzahnblüten. In den Teppich waren die beiden Worte AVE MARIA gewirkt worden, doch hatte sich nachts eine Kuh in der Kirchenbündt herumgetrieben und nun klebte auf dem Buchstaben »R« eine fette, saftige Klatter. Das betrübte den Kuraten, der ein marianisch geprägter Gottesmann war und als junger Mann sogar der Jünglingskongregation vom Herzen Mariä angehört hatte. Der Kurat versuchte, den Buchstaben wieder herzustellen. Das rochen die Ministranten und hoben bei der Wasserreichung ihre Nasen wenig demutsvoll von den Händen des Kuraten ab. In allem, es war ein ergreifendes Hochamt, und beim feierlichen Segen mit der Monstranz grölten die Bauern das Tedeum so ausgelassen, als sängen sie schon ein Trink- oder Wanderlied.
Nach dem Amt begann das eigentliche Fest. Der Dorflehrer hatte mit den Kindern eine nimmer endende Ode auf das hochlöbliche Kaiserhaus einstudiert, dessen Verse von einem Mann stammten, der uns später noch des öftern wiederbegegnen wird. Er hieß Köhler Michel, wurde drum Köhler genannt, weil er die Kohlgrub im Weiler Altig befeuerte. Ein jedes Kind durfte zwei Strophen aus dem gewaltigen Poem rezitieren und das Gesagte in einer lebenden Szene darstellen. So auch Elias. Als die Reihe an den Elias kam, zogen etliche Personen bereits weingeistige Grimassen, was den Eklat noch um einiges steigerte. Der Junge trat vor das Publikum – ein Margeritenkränzlein im Haar – und fing an zu rezitieren. Als er mit warmer und hochtheatraler Baßstimme zu reden anhob, brach die Bauernschar in ein so entsetzliches Gelächter aus, daß es bis nach Götzberg hinabschallte. Elias brachte keine Silbe mehr vom Mund und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die grelle Menge, die ihrerseits in das grelle Gelb seiner Pupillen starrte. Die Seffin bekam plötzlich Atemnot und brach vor aller Augen zusammen. Elias stand noch immer angewurzt, so lange, bis ihn der Dorflehrer endlich vom Holzgerüst herunterhob. Das chaotische Gebrüll – einige Vornehmtuer schrien TACKAPO! TACKAPO! – beruhigte sich erst, nachdem der hochberühmte Feuerschlucker Signor Foco das Gerüst bestiegen hatte. Während der feurigen Kaskaden des Signor Foco erinnerte man sich scherzend an den Schwefelsonntag des Jahres 1800, wies lachend auf die zweifach gefütterten, eisenverkeilten und zwölfangligen Flügeltüren, und der blinde Haintz Lamparter, der damals sein Augenlicht verloren, bedauerte laut die gute alte Zeit. Seit der Kurat Benzer nicht mehr am Leben, sei in Eschberg einfach nichts mehr los. Er tat einen Seufzer und tappte geduldig nach seinem Schoppen.
In der Folgezeit ging es mit der Agathe Alder, der Seffin, erschreckend bergab. Sie wusch sich nicht mehr, kochte wochenlang nichts anderes als Grießmus, fraß und stopfte das stehengelassene Mus in sich hinein, wurde fettleibig und im Gesicht weiß wie Speck. Ihren Seff mochte sie nicht mehr beschlafen, und als sie »fett wie eine tragende Sau« geworden war – das Wort kam aus dem Mund ihrer einzigen Freundin –, mochte wiederum Seff sie nicht mehr lieben. Dabei war sie erst sechsundzwanzig Jahre alt. Im weiteren gab sie sich rätselhaften Kulten hin, wanderte des Nachts betend und singend durch Eschberg, setzte Kröten brennende Kerzen auf, suhlte sich nackt im Herbstlaub, ließ Mistkäfer über ihren Bauch krabbeln, verstopfte ihre Scham mit Lehm und schnitt sich zuletzt Fleisch aus ihrer linken Wange heraus. Das trug sie dann auf einem Kissen feierlich zum Kirchlein hinüber, breitete die Reliquie auf dem Altar des Hl. Eusebius, welcher angeblich auch ein Stück eigenen Fleisches vom Bresnerberg hinauf zum Viktorsberg getragen haben soll. Dies allerdings mit großer Virtuosität: Es war nämlich sein von Sonntagsschändern abgeschlagenes Haupt. Die Seffin verbrachte Stunde um Stunde kniend vor dem Altar, frug wieder und wieder die ewige Frage, weshalb ihr Gott so ein Kind hatte antun müssen. Wenn er ihr nur ein närrisches – damit meinte sie ein mongoloides – geschenkt hätte, es wäre im Dorf nicht weiter aufgefallen. Bedauerlicherweise ging Jahre später – sie hatte sich vom Kummer längst erholt und zu neuer Lebensfreude gefunden – ausgerechnet dieser fatale Wunsch bei ihrem dritten Kind in Erfüllung. So herzlos es klingen mag, aber das vorübergehende Irrsein der Mutter bedeutete für Elias den Beginn seines Lebens. Man ließ ihn, besser gesagt, er kam frei. Im Alderschen Haus war ohnehin alles einerlei geworden.
Was aber tat Seff, dessen Zuneigung die Seinigen so not gehabt hätten? Denn es geschah, daß Elias sich bitter weinend an seine Brust warf, unfähig, ein Wort zu sprechen, einfach in der Hoffnung, der Vater möchte ihn halten, möchte ihn wortlos trösten.
Seff schwieg.
Und der Bruder Fritz? Wir geben ohne Hehl zu, daß er uns nicht interessiert. Fritz war zeitlebens ein so unbedeutender Mensch, daß wir ihn dem Leser am liebsten überhaupt unterschlagen möchten. Er war von jener Art des vollkommen nichtssagenden Zeitgenossen. Und tatsächlich: Aus dem Mund des Fritz Alder ist uns kein einziges Wort überliefert. Wäre eines überliefert, es interessierte uns nicht.
Das Bild der frühen Jugend unseres Helden ist dunkel. Trotzdem gab es Momente heller Freude, die dem Leser vorzuenthalten unehrenhaft wäre. Eine letzte Episode will davon erzählen, und wir kehren zurück zum Frühjahr 1808, zum Fünfjährigen.
Es war an einem verregneten Aprilvormittag. Etwa um die Mittagszeit stand Elias beim Fenster seines Gadens und konnte beobachten, daß ein fremdes Weib den Dorfweg heraufkeuchte. An den geschulterten Gurten und dem roten Lederkoffer erkannte er sogleich, daß es eine Hebamme war. Elias schob das Fenster auf, wollte sehen, wohin das Weib ginge. Sie war seinem Gesichtskreis schon entschwunden, darum bog er sich gefährlich weit aus dem Fenster und dann sah er, daß sie im Haus des Nulf Alder einkehrte. Etwa eine halbe Stunde später, er lag eben auf seinem Laubsack, schoß ihm ein schneidender Schmerz in den Kopf, und ins Herz ging ein Stich, und der Atem stand ihm plötzlich still.
»Herrgott, Herrgott, was ist das?« wirbelte es durch sein kleines Hirn. »Was ist das?« Das Herz raste. »Was ist das, was ist das?« schrie er tiefkehlig, lachte und weinte gleichermaßen, sprang entsetzt auf, rüttelte an der versperrten Gadentür und hämmerte die Fäustchen gegen das braun verwelkte Wandtäfer. Und Elias rannte den Kopf in die Fensterscheibe und schrie hinab in den Wald, dahinter die Emmer floß. Schrie: »Hör nicht auf, Du! Hör nicht auf, Du!« Virgina Alder, die Nulfin, hatte ihrem Mann ein Mädchen geboren. Es war ein an Leib und Seele gesundes. Das Kind sollte auf den Namen Elsbeth getauft werden. Auf dem Seitenaltar der Muttergottes stand von diesem Tag an ein prächtiger Wiesenstrauß. Man kann sich nicht entsinnen, den Strauß jemals verwelkt gesehen zu haben.
Und Elias schluchzte vor Freude. Er jubilierte. Jubilierte an Leib und Seele. Denn er vernahm ein wundersames Pochen, und vom Klang dieses Pochens wurde ihm zumute, als schaute er das Paradies.
»Hör nicht auf, Du!« wimmerte das Kind hinab zum Waldrand, dahinter es jenen Klang zum ersten Mal gehört hatte.
Es war Elsbeths Herzschlagen. Es war der Klang der Liebe.