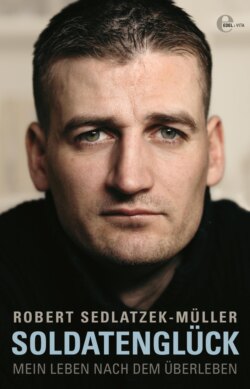Читать книгу Soldatenglück - Robert Sedlatzek-Müller - Страница 7
ICH WERDE ELITESOLDAT
ОглавлениеNach kurzer Zeit habe ich mich in meine Kompanie gut eingelebt. Es macht mir Freude, mich im sportlichen Wettkampf mit meinen Kameraden zu messen. Die Herausforderungen sind vielseitig – 30 Kilometer-Märsche mit Gepäck, die im Feldanzug mit Stiefeln im Laufschritt absolviert werden, Schießübungen mit diversen Waffen und Orientierungsmärsche, bei denen man mit Landkarte und Kompass oder GPS, manchmal auch anhand einer hastig unter Zeitbegrenzung handgemalten Skizze oder auch nur mit der grob genannten Himmelsrichtung und Entfernung bestimmte Stellen im Gelände finden muss, an denen die Orientierungshilfen für die nächste Wegstrecke versteckt wurden. Der alltägliche Dauerlauf von mindestens 5 Kilometern ist nach anfänglicher Quälerei bald zur Gewohnheit geworden. Obwohl man mir an meinem vorgesehenen Arbeitsplatz die wesentlich besser bezahlte Stelle als Chefkoch noch frei hält, entscheide ich mich, meine Wehrdienstzeit um weitere 13 Monate auf insgesamt 23 Monate freiwillig zu verlängern. Dadurch sichere ich mir endlich einen Lehrgangsplatz an der Fallschirmspringerschule in Altenstadt. Wegen der Sparmaßnahmen wird nicht mehr jeder Wehrdienst leistende Fallschirmjäger automatisch für diese kostspielige Springerausbildung eingeplant.
Ich bin unglaublich aufgeregt und erzähle meinen Kameraden im Mannschaftsheim stolz davon. Jeder hat noch einen guten Rat oder eine Horrorgeschichte, die er mir unbedingt mit auf den Weg geben zu müssen meint. Selbst der Spieß hat noch einen Tipp für mich parat, als er mich mit einer Bahnfahrkarte und dem Marschbefehl ausgestattet auf die Reise schickt: Ich solle mich zum Teedienst einteilen lassen, ruft er mir zu.
Den Samstag verbringe ich bei meinen Eltern, dann muss ich, mit einem schweren Seesack bepackt, die Reise quer durch die Republik bis nach Oberbayern antreten. Herrlich, in Bayern war ich noch nie und jetzt bin ich dorthin auf dem Weg, um den ersten Flug meines Lebens anzutreten, den ich dann mit einem Fallschirmsprung beenden sollte. Es ist ein ruhiger Sonntagmorgen im November. Da es sich um eine Dienstreise handelt, ist es meine Pflicht, in Uniform zu reisen. Damit ist allerdings nicht der tarnfarbene Feldanzug gemeint, den wir gerne scherzhaft als den »leichten Biertrinkeranzug« bezeichnen, sondern der »kleine Diener«. Es ist die Ausgehuniform des Heeres: eine graue Anzugjacke, deren Schnitt sich seit den Sechzigerjahren nicht geändert hat, zu der man ein hellblaues Hemd mit Krawatte, eine schwarze Bügelfaltenhose und Halbschuhe trägt. Die Uniform ist vielleicht nicht ganz so kleidsam wie die der Luftwaffe oder Marine, aber ich trage sie mit sehr viel Stolz. Nicht zuletzt wegen des bordeauxroten Fallschirmjägerbaretts, das ich ab morgen allerdings erst mal im Spind lassen muss. Traditionell setzt man das Barett erst zum Ende des Springerlehrgangs wieder auf, wenn einem das begehrte Abzeichen mit den Schwingen an die Brust gesteckt wird. Das Recht, es zu tragen, muss man sich, wie schon bei der Grundausbildung, erst verdienen.
Mit meiner guten Laune ist es vorbei, als ich in die Bahn steige und erkenne, dass ich die nächsten 13Stunden wahrscheinlich im Stehen oder auf meinem Seesack hockend verbringen muss, weil der Dienstherr mir zwar eine Fahrkarte für den IC stellt, eine Sitzplatzreservierung aber nicht für nötig hält. Einen Augenblick später steigt meine Laune wieder, als ich unter den anderen Soldaten, die mit mir im Gang zwischen den Abteilen hocken, ein paar bekannte Gesichter aus meiner Kaserne sehe. Wir kommen ins Gespräch und haben kein anderes Thema als den bevorstehenden Lehrgang. Die Geschichten und Anekdoten, die wir nur aus Erzählungen kennen, tragen wir uns gegenseitig vor, als hätten wir sie selbst erlebt. Alle sind betont gelassen und furchtlos. Über so etwas wie Höhenangst reden wir nicht – obwohl die insgeheim meine größte Sorge ist. Doch ich tue so, als würde ich zweifellos alles meistern. In Wahrheit weiß ich nicht mal, ob ich meinen ersten Flug überstehe.
Statt uns mit unseren Ängsten zu befassen, kommen wir lieber auf »Die Kutsche« zu sprechen. In jeder Stadt, zu der eine Kaserne gehört, scheint es eine Kaschemme zu geben, die fast ausschließlich von Soldaten besucht wird und von Frauen, die ein großes Herz für sie haben, sozusagen. Einer der alten Hasen meiner Kompanie sagte mir, dass es sich bei der »Kutsche« um eben solch ein Lokal handele. Man könne dort gut tanzen, flirten und Spaß haben, solange man sich höflich benehme, keinen Streit anfange und den Abend rechtzeitig beende. Denn irgendwie komme es zu fortgeschrittener Stunde immer zu einer Art Massenschlägerei. Da einem bereits bei Lehrgangsbeginn der Besuch dieser Kneipe verboten werde, gebe es kein Pardon, wenn man dort von der Polizei oder, schlimmer noch, der Militärpolizei erwischt werde – mit der Folge, dass man die freien Wochenenden künftig mit dem Schrubben der Toiletten und Bodenfliesen im Kasernengebäude verbringen müsse.
Die lange Bahnreise vergeht durch die Gesellschaft meiner Kameraden schneller als erwartet. Wir verstehen uns so gut, dass wir beschließen, den vierwöchigen Lehrgang über zusammenzubleiben und uns gegenseitig zu unterstützen.
An der Luftlandeschule Altenstadt müssen wir uns auf dem großen Gelände erst einmal orientieren und unseren Unterkunftsblock suchen. Am Sonntagabend werden wir noch verschont, aber bereits vor dem Frühstück wird offenbar, dass hier wieder ein Ton herrscht wie in der Grundausbildung. »Antreten! Richt’ euch! Durchzählen!«, schallt es uns schon am Kasernentor entgegen. Bei einer ersten Führung über das Gelände beobachten wir, wie Soldaten im Laufschritt von einer Ausbildungsstation zur nächsten marschieren. Sie tragen den typischen Springerhelm aus Stahl. Er fällt sofort auf, weil der tief gezogene Nackenschutz des normalen Gefechtshelms fehlt, mit dem man sich beim Öffnen des Schirms mit den Fallschirmleinen den Helm unsanft vom Schädel reißen würde, was schnell zu einem Halswirbelbruch führen kann. Auf dem Rücken tragen die Soldaten den 13 Kilogramm schweren Fallschirm, der, nach einem bestimmten Prinzip zusammengelegt, in eine Packhülle geschnürt ist. Wenn ich es nicht besser wüsste, hielte ich das Teil für einen kleinen, olivgrünen Tagesrucksack mit großen Schnappkarabinern daran. An einem der Karabiner hängt ein noch kleineres rechteckiges Päckchen, etwa 40Zentimeter lang und 20 Zentimeter im Durchmesser. Darin steckt der nur 5,4 Kilo schwere Reserveschirm. Dieser Schirm ist mit 40 Quadratmetern nicht einmal halb so groß wie der Hauptschirm und wird vor die Brust geschnallt. Die Worte meines Ausbilders dazu waren: »Mit dem T10-R bleibt ihr wahrscheinlich nicht heil, aber ihr bleibt zumindest am Leben, wenn ihr die Reserve ziehen müsst.«
Am nächsten Tag laufe ich selbst mit Stahlhelm und Gurtzeug bepackt durch die Kaserne. »Links – zwo! …«, zählt der Ausbilder neben uns an. »… drei – vier!«, tönt die Antwort aus etwa drei Dutzend Kehlen zurück. Und weiter: »Zählen, zählen, Laufschritt zählen …!« Die Sohlen der schweren Kampfstiefel treffen hart und im Gleichschritt auf das Pflaster. Dieser Klang in Kombination mit dem melodiösen Singsang des Anzählens löst bei mir eine angenehme Gänsehaut aus. Ich gebe mir Mühe, möglichst laut und kräftig mitzuzählen, muss aber erheblich nach Luft schnappen. Von nun an werden wir ständig körperlich gefordert. Die einzelnen Phasen eines Fallschirmsprungs, der Absprung, das Lenken des Schirms und der »Landefall« werden bis über die Schmerzgrenze hinaus trainiert. Die Handgriffe und Bewegungsabläufe werden so drillmäßig eingeübt, dass ich nachts noch intensiv davon träume.
In der zweiten Woche werde ich eines Morgens von einem »Scheiße, wie geil ist das denn?! Es schneit!« aus dem Schlaf gerissen. Als ich aus dem Fenster blinzle, sehe ich große Schneeflocken wie unzählige Miniaturfallschirme zu Boden gleiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich wach bin oder noch träume. Etwas schwerfällig schlüpfe ich in die blauen Badelatschen und schlurfe zum Fenster. Ich habe Muskelkater von der anstrengenden Ausbildung und der Nacken ist vom ständigen Tragen des Stahlhelms steif. Aber als ich durch die altmodischen Flügelfenster gucke, erfasst mich eine kindliche Begeisterung. Die ganze Landschaft ist von einer dicken Schneeschicht bedeckt. Richtig schön und völlig neu für mich. In meiner Heimatstadt Rostock fällt im Winter gerade einmal so viel Schnee, dass man einen Fußabdruck darin hinterlassen kann. Am liebsten würde ich sofort hinauslaufen, mich im Schnee wälzen und eine Schneeballschlacht anzetteln. Nur die Befürchtung, mich vor allen Kameraden lächerlich zu machen, hält mich davon ab. Trotzdem will ich den Schnee hautnah genießen.
Das Duschen lasse ich heute ausfallen. Stattdessen springe ich schnell in die Klamotten und laufe nach draußen. Schon als ich die schwere, hölzerne Eingangstür aufstoße, merke ich, dass es deutlich kälter geworden ist. Da es um 05:30Uhr noch stockdunkel ist, sieht man die Soldaten auf ihrem Weg zum Speisesaal nur im Lichtkegel der Laternen auftauchen. Ihrer angespannten Körperhaltung ist anzusehen, dass sie nicht mit der Kälte gerechnet haben und Winterbekleidung angebracht ist. Ich flitze die Treppen zu meinem Stubenflur wieder hoch und schnappe mir das wattierte Innenfutter für den Parka und die dicke Wintermütze mit Webpelzfutter und Ohrenklappen. Im Militärjargon werden sie auch Muschi-Liner und Bärenfotze genannt. Mit dem Teil auf dem Kopf sieht man wie ein Dorfdepp aus, aber die Bäfo hält den Schädel samt Ohren wirklich warm. Die Ausbilder wissen das offensichtlich auch zu schätzen, denn die meisten von ihnen, die mir auf dem verschneiten Weg zum Frühstück begegnen, haben ihre Feldmütze ebenfalls gegen die Wintermütze ausgetauscht.
Beim allmorgendlichen Antreten merke ich, dass Schnee und Kälte ihr Gutes haben. Unser Ausbilder sagt uns, dass wir, solange Schnee liegt und es glatt ist, nicht mehr im Laufschritt von einer Ausbildungsstation zur nächsten hetzen müssen. Es werden auch zwei Freiwillige für den Teedienst gesucht. Mir kommt zwar der Rat meines Kompaniefeldwebels, mich unbedingt für ihn einteilen zu lassen, in den Sinn, aber als ich die vier großen Thermobehälter sehe, die von den beiden getragen werden sollen, glaube ich, dass der Spieß mir einen Streich spielen wollte. Dafür melden sich zwei andere Soldaten eiligst freiwillig. Mir dämmert schon bald, dass ich auf meinen Spieß hätte hören sollen. Während wir an den folgenden Tagen morgens bei eisiger Kälte vor dem Kasernenblock angetreten stehen und der Tagesparole des Hörsaalleiters zuhören, gehen die beiden Freiwilligen in aller Ruhe zur Küche und holen den Tee ab. Und wenn wir Ausbildungsmaterial beim Zeugwart entgegennehmen und an den Ort seiner Verwendung schleppen, sind die beiden mit ihren Teeeimern fein raus. Ich nehme mir vor, mich als Erster zu melden, wenn in der nächsten Woche zwei andere Teeträger gesucht werden.
Wenn ich schon mal in Bayern bin, dann will ich mir auch etwas davon ansehen. Mit einigen meiner Lehrgangskameraden fahre ich am Wochenende in die nahe gelegene Ortschaft im Tal. Wir lassen die bayerische Bergkulisse auf uns wirken und es kommt ein wenig Urlaubsstimmung auf. Beim Abendessen in der Kaserne verabrede ich mich mit meinen Kameraden zu einem Besuch der legendären »Kutsche«. Da beim Bund immer schon um 16:30Uhr zu Abend gegessen wird, haben wir noch Zeit. Ich verbringe sie damit, umherzuschlendern und mich umzuschauen. Als ich um die Ecke eines Flurs biege, traue ich meinen Augen kaum: Vor mir steht ein Getränkeautomat. An sich nichts Außergewöhnliches, aber einen wie diesen habe ich noch nirgendwo auf einem Kasernengelände gesehen. Es ist ein Bierautomat! Man kann sich Weizenbier in verschiedenen Variationen ziehen. Das probiere ich natürlich sofort aus und werfe ein Fünfmarkstück in den Geldschlitz. Der Automat rumpelt und zwei gut gekühlte Flaschen Bier rollen sanft nacheinander ins Ausgabefach dieses Wundergerätes. Klasse! Von diesem Zeugnis bayerischer Lebensart muss ich meinem Vater unbedingt erzählen, wenn ich zurück bin. So etwas Tolles gab es bestimmt nicht einmal bei der NVA. Meine Kameraden auf der Stube wollen sich selbst von der Existenz dieses Bierautomaten überzeugen, als ich ihnen davon erzähle.
Als wir zur »Kutsche« aufbrechen, haben wir alle schon leichte Schlagseite. Am Kasernentor fragen wir die Wache nach dem Weg. Der Soldat schaut uns mit einem breiten Grinsen an. Als er uns die Marschroute beschrieben hat und wir aufbrechen, fällt mir auf, dass er uns irgendwie mit schelmischwissendem Blick nachschaut. Unterwegs male ich mir gemeinsam mit den Kameraden aus, was uns wohl erwartet. Wir stellen uns vor, dass die Diskothek wie ein Oktoberfestzelt aussehen wird, von hübschen bayerischen Mädels besucht, deren pralle Oberweite in zünftigen Dirndln steckt. Jeder von uns hat schon einiges von der »Kutsche« in Altenstadt gehört. In unserer Vorfreude erwarten wir mitten in der Provinz den absoluten Hammerladen vorzufinden. Umso größer ist unsere Enttäuschung, als wir ankommen. Es ist ein einstöckiges schmuckloses Gebäude irgendwo außerhalb, wie es jeder wohl unter der Bezeichnung »Dorfdisco« kennt. Dementsprechend ist das Publikum: Dorfjugend. Die Einrichtung besteht aus rustikalen Holztischen und Stühlen. Wagenräder und Deichseln ausgeschlachteter alter Holzkutschen hängen als Dekoration an den Wänden und Decken. Die schummerige Kerzenbeleuchtung in Verbindung mit dem dicken Zigarettenqualm lässt mich annehmen, eher in einem Westernsaloon zu sein als in einer Disco, wie es mir so vollmundig in Aussicht gestellt worden war. Den anderen steht die Enttäuschung ebenso deutlich ins Gesicht geschrieben.
Der Türsteher, der auch im Laden seine Runden macht, scheint ebenfalls aus einem Baumstamm geschnitzt zu sein. »Holzmichel« fällt mir bei seinem Anblick ein. Er behält seine betrunkene Kundschaft genau im Auge. Auftreten und Statur lassen keinen daran zweifeln, dass er den Saal zur Not auch ganz allein räumen würde. Aber das soll unsere Sorge nicht sein. Immerhin ist es hier warm und ein paar Mädchen sind auch da. Wir beschließen zu bleiben und uns zu amüsieren. Allein die Einheimischen geben uns reichlich Anlass dazu. Wir sind ausgelassen und fühlen uns auch zahlenmäßig einer möglichen Massenkeilerei gewachsen. Es dauert nicht lange und zwei der Mädels, zu denen wir Blickkontakt aufgenommen hatten, gesellen sich zu uns. Ihrem Gang ist anzumerken, dass sie bereits mehr als ein Bier getrunken haben. Eine setzt sich zu mir auf die Bank und fragt: »Ja hobts ia scho a Wurfeckn oagricht?« Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an ihrem Alkoholpegel oder Dialekt liegt, aber ich muss halb zu ihr hinübergebeugt zurückfragen: »Was ist eine Wurfeckn?« Statt zu antworten, trinkt sie mit einem großen Schluck ihre Bierflasche leer, hält sie mir erklärend entgegen und schleudert sie anschließend mit voller Wucht an unseren Köpfen vorbei an die Wand. Halb erstaunt, halb erschrocken halten wir kurz die Luft an, um im nächsten Moment lauthals loszulachen. So was haben wir ja noch nie erlebt.
Für die beiden Mädels findet der Abend damit jedoch ein jähes Ende. Der Holzmichel schnappt die beiden mit seinen Pranken am Nacken und brüllt: »Für euch ists genug!« Ruckzuck schiebt er sie zur Tür hinaus. Unserer Stimmung tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil, wir lachen noch den ganzen Abend über den Vorfall und kehren erst spät in der Nacht vergnügt zur Kaserne zurück. Mit dieser Geschichte konnten wir in der heimatlichen Einheit unseren Beitrag zu den Legenden um die »Kutsche« leisten. Dass die Wurfecke bei den Mannschaftssoldaten und im Unteroffizierskorps eine lang gepflegte Tradition ist, habe ich erst sehr viel später erfahren.
Zum Glück habe ich am Sonntag ausreichend Zeit, um meinen Rausch auszuschlafen. Ich bewundere einen bayerischen Stubenkameraden, der sich mit den Worten »Ah, gegn die Kopfschmerzn hülft nur oa Konterbier!« direkt zum Frühstück ein Weizenbier einschenkt, aber das Rumoren in meinem Magen gibt mir deutlich zu verstehen, dass ich es ihm lieber nicht nachmachen sollte.
Am folgenden Tag erwartet uns der wohl am meisten gefürchtete Teil der Ausbildung – der Sprungturm. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Auf dem Sprungturm verweigern mehr Leute den Absprung als im Flugzeug. Von unseren Ausbildern haben wir etliche Male gehört: »Jungs, reißt euch da oben zusammen! Wenn ihr da hinausspringt, dann ist der Sprung aus der Transall ein Klacks für euch.« Das macht mir den Marsch zum Turm nicht gerade leichter. Am Fuß des etwa 13Meter hohen, rechteckigen Holzturms befinden sich an zwei Seiten visàvis kleine graue Hütten mit Schiebefenstern. Sie erinnern mich an die Kartenhäuschen einer Achterbahn. Mich erfasst auch etwa die Anspannung wie vor der rasenden Fahrt, lediglich der wohlige Schauer bleibt aus.
An der Tür des kleinen Häuschens nimmt uns der Hörsaalleiter persönlich in Empfang. Wir treten in der gleichen Formation vor ihm an, in der wir zukünftig beim Fallschirmspringen stehen und das Flugzeug betreten sollen. Etwa sechzig Mann stehen in vier Linien, den sogenannten Sprungreihen, vor ihm, jeweils vier Mann hintereinander und fünfzehn nebeneinander. Die gleichen Nebenmänner hat man später in der Maschine vor und hinter sich. Alle haben eine Attrappe des Reserveschirms und Gurtzeug angelegt, an dem statt des schweren Fallschirmpakets zwei Flachbänder befestigt sind. Die Karabinerhaken an den Enden sollen wir auf der obersten Plattform des vierstöckigen Turms in einen auf Rollen gelagerten Kasten einhaken, der dann ein Stahlkabel entlang schräg abwärts fährt, wenn man vom Turm gesprungen ist. Der Hörsaalleiter ruft uns dabei zu, auf welche Situation wir reagieren müssen, und kontrolliert unser Verhalten vom Absprung an bis zu einer gegebenenfalls notwendigen Öffnung des Reserveschirms. So viel zur Theorie.
In der Praxis werden mir die Beine mit jeder Stufe, die ich hochsteige, schwerer und schwerer. Ich versuche mich auf dem Weg nach oben verzweifelt daran zu erinnern, was um alles in der Welt mich auf die unsägliche Idee gebracht hat, an einem Fetzen Stoff aus einem intakten Flugzeug springen zu wollen. Irgendwie fällt es mir nicht ein. Ich weiß nur noch, dass ich es unbedingt wollte.
Auf jeder Etage sind vier Mann auf der linken Seite und ebenso viele auf der rechten Seite der Holztreppe, die mittig den Turm hinauf verläuft. Sie scheint uns mit jeder Stufe dem unausweichlichen Verderben näher zu bringen. Ich stehe an vierter Position und werde den drei Kameraden vor mir bei ihrem Sprung zusehen, ehe ich selber dran bin. Bevor wir synchron zu den Soldaten auf den anderen Turmebenen eine Etage hinaufsteigen, beantworten wir den Singsang des Ausbilders, der uns oben erwartet: »Vier Mann linke Tür!« Die dünne Luft trägt den Schall weit über den Ausbildungsplatz. Dann stampfen wir wie zur Bestätigung mit dem linken Fuß auf, bevor wir die nächste Ebene erklimmen. Das Aufstampfen hilft mir, das Gefühl für den Boden unter meinen Füßen nicht ganz zu verlieren. Meine Knie sind weich geworden und ich kämpfe gegen Höhenangst, die sich beim Blick nach unten immer mehr in mir ausbreitet, als wir die vierte und letzte Ebene des Turms erreichen. Die Tür dort ist mit den gleichen Rahmenmaßen und den Windabweisern dem Original der Transall grob nachempfunden. Das Häuschen, vor dem der Hörsaalleiter an einem einfachen Schreibtisch sitzt und sich zu jedem seiner Schüler Notizen macht, ist von hier oben unsagbar klein. Genauso gut könnte ich mich jetzt von einem Hochhaus stürzen wollen, denke ich. Damit meine Beine nicht gänzlich zu Pudding werden, lasse ich meinen Blick in die Ferne schweifen. Am Horizont sehe ich die Gipfel der Alpen.
Der Ausbilder an der Türluke der simulierten Transall steht mir genauso wie später der Absetzer in der Maschine gegenüber. Er überzeugt sich, dass die Karabinerhaken an den Flachbändern ordentlich in die sogenannte Laufkatze eines Stahlkabels eingehakt sind, das aus dem Turm hinausführt und irgendwo an einem niedriger gelegenen Erdwall in etwa 150Meter Entfernung befestigt ist. Ich muss mich wirklich zusammennehmen, um nochmals in die Tiefe gucken zu können, als ich mich mit den Worten »Gefreiter Müller, Nummer 4. Melde mich zum ersten Sprung!« beim Hörsaalleiter ankündige. Er erscheint mir winzig klein. »Ab!«, erhalte ich als Antwort. Der Ausbilder neben mir gibt mir einen Klaps auf die Schulter. Das Signal, dass ich hinausspringen darf. Darf! Als könnte ich mich kaum noch halten, in der zuvor einige Hundert Mal trocken geübten Haltung weit aus dem Turm hinauszuspringen und unaufhaltsam der Erde entgegenzustürzen. »Hopptausend, zwotausend, dreitausend, viertau…!«, schreie ich aus vollem Hals. Die letzte Silbe wird von einem kräftigen Ruck, der mich nach etwa 5Metern abrupt abbremst und dann wieder ein Stück emporreißt, abgeschnitten. An den Stahlkabeln hängend werde ich auf meiner Fahrt zum Erdwall hin und her gerüttelt. Ich freue mich, den Mut zum Sprung aufgebracht zu haben, und mit dem festen Boden zurück unter den Füßen wirkt das Ganze auf mich wie eine Seilbahn auf einem Kinderspielplatz. Der nächste Absprung kostet mich erheblich weniger Überwindung.
Damit ist der Tag der Wahrheit zum Greifen nahe. »Es gibt Männer und es gibt Nichtspringer!«, habe ich Dutzende Male in meiner Stammeinheit gehört. Ich weiß noch nicht, zu welchen ich gehören werde. Mit jedem Tag und jeder Stunde, die mein erster Fallschirmsprung näher rückt, wächst das Gefühl des Unbehagens. Schließlich ist es so weit. Wir fahren mit einem Shuttlebus etwa eine Stunde zum Flugplatz Penzing bei Landsberg. Dort nehmen wir unseren Fallschirm und den Reserveschirm direkt von der Ladefläche eines Lkw, dem sogenannten Schirmfahrzeug, in Empfang. Im Hangar tun wir uns paarweise zusammen und helfen uns beim Anlegen der Ausrüstung. Ich bin dabei sehr gewissenhaft, in dem Bewusstsein, für die Sicherheit meines Kameraden Verantwortung übernommen zu haben. Die gleiche Sorgfalt erwarte ich von ihm. Mit über den Kopf gestreckten Armen und den Worten »Neuer Mann im Gurtzeug!« melden wir uns anschließend bei einem Absetzer und lassen sein geschultes Auge den richtigen Sitz der Ausrüstung und die Funktionsfähigkeit der Auslösemechanismen überprüfen. Danach setzen wir uns, so gut es in dem straff angelegten Gurtzeug geht, auf den Boden der Halle und warten. Das Warten, so wurde uns gesagt, nimmt den größten Teil des Sprungdienstes in Anspruch. Obwohl ich extra vor dem Anlegen des Fallschirms das Klo aufgesucht habe, drückt mir schon nach Kurzem die Blase. Ich traue mich aber nicht zu gehen, weil ich die Beingurte nochmals lösen und hinterher wieder überprüfen lassen müsste. Ich möchte mir den verärgerten Blick und die höhnischen Bemerkungen sparen, mit denen einen der Absetzer bedenkt, wenn man es nicht schafft, bis nach dem Sprung an sich zu halten.
Als wir auf die abgesenkte Heckklappe des Transportflugzeugs zumarschieren, habe ich das Gefühl, zum Schafott geführt zu werden. Mir wird etwas übel vom Kerosingeruch und der gestauten Wärme im Inneren der Maschine. Paarweise betreten wir die Rampe, mit den Händen auf dem Stahlhelm. Dadurch können die beiden Absetzer sich nochmals vom korrekten Sitz der Sprungausrüstung überzeugen. Schnell füllen sich die Sprungreihen an den Bordwänden und anschließend in der Mittelreihe. Jeweils drei Personen können zusammengequetscht auf einer Klappbank Platz nehmen. Wir sitzen einander zugewandt und unsere Knie stoßen an die Knie der gegenüber sitzenden Person. Die bleichen und starren Gesichter unter den Helmen bestätigen mir, dass ich nicht der Einzige bin, der sich fühlt, als flöge er direkt in sein Verderben. Die Ladeklappe schließt sich und die Maschine beginnt unter der Kraft der Propellermotoren zu vibrieren. Mir schießt der Gedanke durch den Kopf, was wohl passiert, wenn ich nach dem Absprung ohnmächtig werde. Würde ich das überleben? Und was, wenn sich dann mein Schirm nicht richtig öffnet? Ich könnte in dem Fall ja nicht einmal die Reserve ziehen. Und wenn man nicht weit genug aus dem Flugzeug hinausspringt, erfasst einen der Luftstrom um die Maschine, man schlägt gegen die Bordwand und wird möglicherweise auf die andere Seite der Maschine gewirbelt, wo ein anderer Springer gleichzeitig abgesetzt wird.
Die Grübelei findet mit den Anweisungen des Absetzers ein jähes Ende. Laut brüllt er gegen die donnernden Motoren der Transall an: »Fertig machen!« Er macht dabei einen Ausfallschritt und stößt die flache Hand wie ein Surfer nach vorne. Die beiden Sprungreihen an der Bordwand, zu denen auch ich gehöre, lösen den Sicherheitsgurt und beugen sich einmal nach vorne. Dann heißt es »Aaaaufstehn!« Die Handinnenfläche des Absetzers ist bei der hebenden Bewegung nach oben gerichtet. Wir erheben uns, klappen die Sitze an die Bordwand und befestigen sie mit dem dafür bestimmten Flachgurt. Schon erfolgt das nächste Kommando: »Einhaken!« Der Absetzer formt mit Daumen und Zeigefinger ein C und macht eine Einhakbewegung. Wir klinken den Karabinerhaken unserer Aufziehleine an der Ankerleine ein, einem Stahlseil, das oberhalb der Köpfe mittig zwischen den beiden Sprungreihen einer Bordseite verläuft. In dem Moment, in dem wir abspringen, wird diese gelbe Leine gestrafft und soll die Packhülle vom Fallschirm reißen. Der Schirm wird dadurch automatisch geöffnet. Ein dicker Draht, den wir durch ein kleines Loch am Karabinerhaken stecken und umknicken, soll verhindern, dass der Haken sich versehentlich öffnet. Die Absetzer gehen ihre jeweilige Sprungreihe ab und überzeugen sich bei jedem Einzelnen von uns, dass er richtig eingehakt ist und die Aufziehleine ihren Zweck erfüllen kann.
Ein Schlag mit der flachen Hand auf das Schirmpaket ist das Zeichen, dass alles in Ordnung ist. Die Absetzer begeben sich an die Sprungtüren, öffnen sie und klappen die Türen seitlich weg. Dann beugen sie sich aus der Türluke hinaus und prüfen, ob außen an der Maschine nichts im Weg ist, was die Springer verletzen oder behindern könnte. Als der Absetzplatz in Sichtweite ist und die Grenzen der Landezone sichtbar werden, lehnt sich ein Absetzer zurück zu uns in die Maschine und ruft: »Straaaße!« Als Zeichen, das verstanden zu haben, antworten wir wie aus einer Kehle: »Straaaße!« Das von ihm folgende »Eisenbahn!« wird wie ein Echo von uns wiederholt. Dann heißt es »Vorrücken!« Mit einer entsprechenden Geste wird uns signalisiert, an die offene Tür des Flugzeuges heranzushuffeln. Es ist eine Art Gleitschritt, denn würde man versuchen, einfach zu gehen, wäre an Bord ein einziges Stolpern und Stürzen. Der Wind, der durch die offenen Hecktüren dringt, verursacht einen Höllenlärm. Die Transall fliegt jetzt in 350bis 400Meter Höhe mit einer Absetzgeschwindigkeit von 240km/h. Meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt. »Gleich ist es so weit, gleich ist es so weit! Gleich, gleich, gleich!«, ist der einzige Gedanke, der mich in diesem Moment erfüllt. Und tatsächlich, die rote Leuchte über der Tür schaltet auf Grün. Ein Hupsignal durchdringt meinen ganzen Körper. Ich weiß, was ich zu tun habe.
Nachdem der erste Kamerad, der in Absprunghaltung in der Tür steht, mit einem flachen Schlag auf die Schulter sein »Ab!« erhält und einfach aus dem Blickfeld verschwindet, geht alles rasend schnell. Wie die Lemminge folgen wir mit starrem Blick und leerem Hirn seinem Beispiel. »Hopptausend, zwotausend, dreit…!« Bevor ich weiß, wie mir geschieht, hat sich mein Fallschirm mit einem harten Ruck geöffnet. Völlig selbstverständlich greife ich in die Fangleinengurte über mir und rufe: »Überprüfe Kappe!« In voller Pracht haben sich die 83Quadratmeter olivgrünen Nylons zu einer Rundkappe mit 10 Meter Durchmesser geöffnet. Erleichtert schaue ich mich nach anderen Springern um, die mir gefährlich nahe kommen könnten. Die Worte »Halte Umschau!« verlassen kaum noch hörbar meine Lippen. Während der Wind mich der Erde entgegenträgt, erfasst mich ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Die Stille um mich herum und das Gefühl, frei wie ein Vogel zu sein, erfüllen mich mit Ruhe. Ich habe soeben den ersten Flug meines Lebens mit einem Fallschirmsprung gekrönt. Mir ist plötzlich klar, warum man in der Fallschirmjägertruppe der Frage, ob man Springer oder Nichtspringer ist, eine so große Bedeutung beimisst. Aus der Sicht vieler Militärexperten gilt das Absetzen mehrerer Hundert Soldaten in Feindesland zwar längst als taktisch überholt, weil es keinen Überraschungsvorteil mehr mit sich bringt. Doch wer bereit ist, seine Todesangst zu überwinden, indem er sich aus einem Flugzeug in die Tiefe stürzt, hat eine gehörige Portion Mut bewiesen. So etwas lässt sich nicht mit einem Sprung vom Zehnmeterturm im Schwimmbad mal eben simulieren.
In nicht einmal einer Minute haben mehr als dreißig Fallschirmjäger die Transall verlassen. Die Männer aus den mittleren Sprungreihen B und C werden unserem Beispiel sicherlich gleich folgen. Ich richte mich auf die Landung ein und presse die Knie und Füße so fest ich kann aneinander, um ihnen dadurch mehr Stabilität beim Aufschlag zu geben. Bei einer Sinkgeschwindigkeit von 6bis 9Metern pro Sekunde ist die Schirmfahrt leider nach nicht einmal 50Sekunden beendet. Der Landefall gelingt mir besser als gehofft. Ich spüre nach, ob ich irgendwo Schmerzen habe. Aber es ist alles in Ordnung und auch die Hose ist trocken geblieben. So schnell es geht, streife ich das Gurtzeug ab und verpacke den Fallschirm in einer eigens dazu mitgeführten Stofftasche. Das Gefühl der Erleichterung lasse ich durch meinen Körper strömen. Die ungenutzte Reserve befestige ich mit den Schnappkarabinern an den Trageschlaufen der Tasche und werfe mir das Zeug so über die Schulter, dass mein Kopf zwischen der Packtasche auf dem Rücken und dem Reservepaket unter dem Kinn hervorschaut. Im Laufschritt eile ich vom Landeplatz in Richtung Shuttlebus. »Noch vier Sprünge, dann hast du das begehrte Abzeichen!«, denke ich.
Während der Fahrt zum Flugplatz erzählen wir uns aufgeregt und in ausgelassener Stimmung, wie wir den ersten Sprung erlebt haben. Kein Detail wird ausgelassen und jede Erfahrung meiner Kameraden, die mir nützlich sein kann, sauge ich wie ein Schwamm auf. In Penzing wartet die Transall C160 bereits mit laufenden Motoren auf uns. Solange es das Wetter hergibt, soll gesprungen werden. Die Fallschirme werden uns im Vorbeigehen von der Ladefläche des Schirmwagens zugeworfen. Wieder helfen wir uns zu zweit beim Anlegen des Gurtzeugs. Das ganze Spiel wiederholt sich. In der Maschine stehe ich dieses Mal ganz dicht an der Tür, direkt hinter dem sogenannten Türspringer. Der ist bereits in Absprunghaltung im Türrahmen, während wir noch auf den Absetzplatz zufliegen, und hat einen perfekten Ausblick. Ich kann sehr gut an ihm vorbei in die Landschaft sehen. Erstaunlich, wie anders einem die Welt aus 350 Meter Höhe vorkommt.
Direkt hinter mir steht einer der Kameraden meiner Heimatkaserne, mit denen ich im Zug angereist bin. Er hat mir bei der letzten Sicherheitsüberprüfung in der Maschine zur Bestätigung einen besonders kräftigen Schlag auf die Schulter verpasst. Als ich über die Schulter zu ihm blicke, grinst er mich an und sagt: »Du, bei dir steht Attrappe auf dem Schirmpaket!« Ein blöder Witz, über den ich nicht lachen kann. Obwohl die so gekennzeichneten Schirmpakete, die wir während der Bodenausbildung erhalten, nie in den Umlauf mit den realen Fallschirmen kommen, steigert allein der Gedanke an so eine fatale Verwechslung mein Unbehagen vor dem Sprung. Viel Zeit zum Ärgern bleibt mir nicht. Das Lämpchen an der Tür schaltet von Rot auf Grün, die Hupe ertönt und wir stürzen uns aus der Maschine. Die Zögerlichkeit des ersten Sprungs ist vergangen. Jetzt scheint jeder nur noch schnell den kritischen Moment des Absprungs hinter sich bringen zu wollen. Auch mein Hintermann ist mir dicht auf den Fersen. Als ich meinen Blick nach dem Öffnungsvorgang des Schirms nach oben richte, um meine Fallschirmkappe zu überprüfen, sehe ich, wie der Möchtegernkomiker mir gefährlich nah kommt. Jetzt kriege ich wirklich Schiss und schreie ihm zu: »Hau ab, Mann – du bist viel zu dicht!« – »Alter, das geht nicht. Ich hänge irgendwie mit meinem Stiefel an deinem Basisnetz fest.« Wie bitte – er hängt an dem Basisnetz meines Schirms fest? Ich spüre, wie ich erbleiche.
Die Ausbilder haben uns gesagt, was passiert, wenn zwei Springer sich zu dicht beieinander befinden. Dem oberen Fallschirm fehlt der Luftwiderstand. Er fällt in sich zusammen und der Springer sackt mit dem Schirm an seinem Kameraden vorbei ab. Dann füllt sich sein Schirm wieder mit Luft, bläht sich auf und nimmt nun der Schirmkappe über sich den nötigen Auftrieb. Das böse Spiel wiederholt sich, bis beide Springer erheblich zu schnell auf die Erde krachen. Fahrstuhl fahren wird dieses Phänomen genannt. Ich bin nicht erpicht darauf, wie ein Kühlschrank auf den Boden zu schlagen, und reiße mit aller Kraft an den Fangleinen meines Schirms, um den Kerl loszuwerden. Ein lächerlicher Versuch. Die Kräfte, die auf uns wirken, sind wesentlich stärker. Zumindest bleiben die Schirme halbwegs geöffnet, da wir aneinander festhängen, aber sie haben sich schräg zueinander gestellt, wodurch wir der Erde schneller nahe kommen, als uns lieb sein kann. Panisch schreit der Trottel: »Das schaffen wir nicht! Wir stürzen ab!« Tatsächlich kommen schon etliche Personen auf unsere ungefähre Landezone zugelaufen und durch ein Megafon wird uns gesagt, dass wir uns auf die Landung vorbereiten sollen. Die plastische Darstellung unseres Ausbilders kommt mir in den Sinn. Er hatte zwei Streichhölzer zwischen Daumen und Zeigefinger genommen und gesagt: »Ihr müsst die Füße, Knie und Beine fest aneinanderpressen. Sonst zerbrechen sie beim Aufschlag wie Zündhölzchen.« Er erhöhte den Druck der Finger, die Hölzchen knacksten leise.
Ich presse meine Beine mit aller Kraft zusammen. Sie sollen nicht so zerknicken. Ohne einen klaren Gedanken fassen zu können, schlage ich mit Wucht auf die hart gefrorene Rasenfläche. Die Schneeschicht auf dem Boden ist leider noch viel zu dünn, um den Aufschlag merklich abzuschwächen. Der Schrei meines Kameraden endet abrupt beim Aufschlag. Ich öffne die Augen, die ich wohl automatisch so fest geschlossen hatte wie meine Beine, und schaue mich um. Sanitäter und Ausbilder stehen bereits neben uns. »Tut Ihnen etwas weh?«, höre ich. Zu meinem Erstaunen stelle ich fest, dass ich keinerlei Schmerzen habe. Auch mein übereifriger Kamerad scheint nicht schlimm verletzt zu sein. Ich würde das gerne nachholen und schreie ihn an: »Du Idiot! Das kommt davon, wenn man so dicht hinterherspringt!« Ein Ausbilder bringt mich zur Räson. »Beruhigen Sie sich, es ist ja noch mal gut gegangen. Trinken Sie heute Abend lieber gemeinsam ein Bier auf Ihre überstandene Bruchlandung!« Auch ein Sanitäter meldet sich zu Wort und fragt nochmals nach, ob wir irgendwo Schmerzen haben. Als wir beide verneinen, verrät ein leises Kopfschütteln das Erstaunen des Sani. »Wenn noch was sein sollte oder Ihnen auch nur schwindlig wird, dann melden Sie sich im Sanbereich«, sagt er uns noch. Ich habe es überlebt, denke ich erleichtert und bin stolz auf meine Leistung. Es ist ein denkwürdiger Tag für mich, der 26. November 1998. Leider verstärken sich der Wind und das Schneegestöber an den folgenden Tagen, sodass an weitere Sprünge erst einmal nicht zu denken ist. Die Idee der Ausbilder, sich die Wartezeit in der Pendelhalle mit Landefallübungen zu vertreiben, erweist sich als eher schädlich. Mit der Zahl absolvierter Landefälle erhöht sich auch die Unfallrate. Ein Bildungstag wird eingelegt, an dem wir Schloss Neuschwanstein besuchen.
Unser Aufenthalt in Bayern verlängert sich um 14 Tage. Mit jedem weiteren Tag wachsen meine Zweifel, ob ich überhaupt noch einmal das Risiko eines Fallschirmsprungs auf mich nehmen sollte. Aber als der nächste Sprung endlich so weit ist, stehe ich ihn ohne Blessuren durch. Wie zur Belohnung verschlechtert sich die Wetterlage derartig, dass nur noch die Hubschrauber Starterlaubnis bekommen. Meine beiden folgenden Sprünge von der Heckklappe des Transporthubschraubers CH 53 kommen mir wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk vor. Ohne Hektik schreite ich die Laderampe entlang, bis ich ins Leere trete. Da der Hubschrauber wesentlich langsamer fliegt als die C160, erfasst einen kein heftiger Windstoß. Der Schirm öffnet sich in 450 Meter Höhe und ich gleite in den Tiefschnee, als sei ich selbst eine Flocke. So schön sanft und entspannt kann ein Fallschirmsprung sein. Die feierliche Verleihung des deutschen Springerabzeichens, das einen kleinen eichenlaubumkränzten Fallschirm zwischen zwei Schwingen darstellt, ist ein besonderer Moment. Wir treten dazu im »kleinen Diener« an. Zum ersten Mal seit Wochen tragen wir endlich wieder das bordeauxrote Fallschirmjägerbarett. In München stoße ich mit meinen Lehrgangskameraden auf unsere neuen Sprunglizenzen, die Springerscheine, an, dann trennen sich unsere Wege. Während der Heimfahrt denke ich darüber nach, meinen Wehrdienst um weitere 13 Monate zu verlängern.