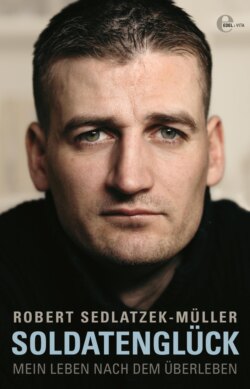Читать книгу Soldatenglück - Robert Sedlatzek-Müller - Страница 8
KFOR - EINSATZ IM KOSOVO
ОглавлениеNachdem ich mich bei meinem Spieß zurückgemeldet habe, darf ich meinen Weihnachtsurlaub antreten. Ich verbringe die Weihnachtszeit 1998 mit meinen Eltern und Geschwistern. Natürlich erzähle ich ausführlich von meinem Jungfernflug, vom Fallschirmspringen und von der beeindruckenden schneebedeckten bayerischen Landschaft. Dass mein zweiter Sprung auch mein letzter hätte werden können, lasse ich dabei aus. Ich möchte meine Familie nicht ängstigen. Die derzeitige Berichterstattung über den Einsatz der NATO im Kosovokonflikt beunruhigt meine Eltern sowieso schon. Ich mache mir keine großen Sorgen darüber, es beeinflusst auch nicht meine Entscheidung, mich für mehr als ein Jahr weiter zu verpflichten. Der Einsatz der Luftwaffe zur Überwachung der zerstrittenen Parteien im zerfallenden Jugoslawien betrifft mich als Infanteristen ja nicht. Das glaube ich zumindest, denn Auslandseinsätze der Bundeswehr mit bewaffneten Bodentruppen waren bislang die Ausnahme.
Allerdings ändert sich die Politik überraschend schnell: Ausgerechnet Außenminister Joschka Fischer von den Grünen setzt sich für die aktive Beteiligung deutscher Soldaten im Kosovo ein. Verteidigungsminister Rudolf Scharping spricht sich ebenfalls für den Einsatz von Bodentruppen aus. Es wird öffentlich über die Verpflichtung Deutschlands diskutiert, dem Völkermord im nach Autonomie strebenden Kosovo ein Ende zu bereiten. Die Bombardierung Serbiens durch die NATO im März 1999 stößt innenpolitisch letztlich kaum auf Widerstand. Etwa zwei Monate später verkündet uns der Spieß beim allmorgendlichen Antreten, dass wir als Einsatzverband für den Kosovo eingeplant sind. Ich wundere mich über diese Entscheidung der Regierung. Mit Heimatverteidigung scheint mir das nichts zu tun zu haben. Die Vorstellung, wie deutsche Fallschirmjäger über Jugoslawien aus der Transall C160abgesetzt werden und den Kampf aufnehmen, spukt mir durch den Kopf. In meiner Fantasie vermischt sich das, was ich aus Kriegsfilmen kenne, mit dem, was ich durch meine Ausbildung bereits weiß, zu einer unwirklichen Vorstellung dessen, was möglicherweise auf mich zukommt.
In der folgenden Woche bekomme ich von meinem Zugführer den Befehl, mich sofort beim Spieß zu melden. Meist bedeutet das nichts Gutes. Mit einem mulmigen Gefühl betrete ich das Geschäftszimmer. Obergefreiter Kutz, mit dem ich die Grundausbildung absolviert habe, sitzt als männliche Vorzimmerdame an seinem Schreibtisch. Als gelernter Bankkaufmann hat er die unter Infanteristen seltene Fähigkeit, einen PC bedienen und tippen zu können. Damit war seine Verwendung bei der Armee besiegelt. Er liest mal wieder den Sportteil der Tageszeitung. »Kutz, eh Kutz!« Leicht genervt schaut er von seiner Zeitung auf. »Ach, Müller, na wasn los?« – »Was los ist? Mensch, ich soll mich beim Spieß melden. Sag du mir was l…« Zum Ausreden komme ich nicht mehr. »Spieß, der Müller ist da!« So ein Blödmann, denke ich. Spieß Kams kommt aus seinem Dienstzimmer und stellt sich mir direkt gegenüber. Ich nehme schnell Haltung an. »Herr Hauptfeldwebel, Obergefreiter Müller. Ich melde mich wie befohlen!« – »Ja, ist gut, Müller. Stehen Sie bequem. Es werden noch Freiwillige für den Kosovoeinsatz gesucht. Wollen Sie mit?« – »Ich hab mich auch freiwillig gemeldet!«, ruft Kutz dazwischen. »Für die Zeit des Einsatzes würden Sie zum AVZ in die 1. Kompanie versetzt werden. Sie können aber auch hierbleiben und in der 5. Unteroffizier werden. Ich schick Sie dann auf den nächsten Unteroffizierslehrgang. Was meinen Sie?« Ich bin völlig perplex. Weder mit dem einen noch mit dem anderen habe ich gerechnet. Ich stammle irgendetwas Unsinniges, weswegen ich Bedenkzeit bräuchte. Der Spieß schaut mich leicht vergrätzt an. »Morgen will ich eine Entscheidung hören. Das ganze Bataillon geht in den Einsatz. Denken Sie daran!«
Das lässt mich stutzen. Ich will nicht als Drückeberger oder Fußkranker gelten, der die leer stehende Kaserne bewacht, während meine Kameraden sich im scharfen Einsatz beweisen müssen. Dass der Spieß mich überhaupt dem Aufklärungs- und Verbindungszug überstellen will, ist schon eine Art Auszeichnung, durch die ich mich geehrt fühle. Der AVZ hat die Aufgabe, eigenständig Marschwege zu erkunden und den nachfolgenden Einheiten eine sichere Route zu weisen. Er hat mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch als Erster Kontakt mit potenziellen Gegnern – eine verantwortungsvolle und gefährliche Aufgabe, da immer nur kleine Gruppen des AVZ unterwegs sind, um bei ihrer Erkundungstour möglichst unentdeckt zu bleiben. Daher sind in dieser Einheit viele raue Burschen, die jeder in der Kaserne kennt und sofort zuordnen kann. Viele altgediente Mannschaftssoldaten, die sich teilweise bereits im Einsatz in Bosnien ihre Sporen verdient haben. Keiner der jungen Soldaten wagt es, sich im Speisesaal oder im Mannschaftsheim zu ihnen zu setzen. Diese Männer, oftmals schon im Rang eines Stabsoder gar Oberstabsgefreiten, werden von den Offizieren und Unteroffizieren sehr geschätzt. Manche sind schon sehr viel länger Soldaten als ihre Vorgesetzten und haben diese teilweise noch als Rekruten ausgebildet. Es sind aber auch einige weniger erfahrene Soldaten in ihren Reihen. Einer von ihnen ist der Obergefreite Limmann, der während der Grundausbildung mit mir auf einer Stube war. Er wird mir sagen können, was mich bei ihnen erwartet.
Ich gehe gleich zu ihm und finde, als ich eintrete, eine außergewöhnlich gemütlich eingerichtete Stube vor. Sessel, Kühlschrank, Fernseher und sogar eine Spielekonsole stehen in dem Raum. Da niemand zu sehen ist, will ich gleich wieder rückwärts hinaus. Ich pralle gegen jemanden, der sich unbemerkt hinter mich gestellt hat. Wütend fährt er mich an: »Alter, was willst du hier? Wer bist du überhaupt?« Ich fühle mich ertappt und zucke zusammen. Als ich mich umdrehe, erkenne ich den Oberstabsgefreiten Zott – ein muskulöser Kampfsportler mit kurz geschorenem Haar, der eine sehr kompakte Erscheinung abgibt. Schnell trete ich einen Schritt zur Seite. »Ich wollte zu Limmann«, bringe ich kleinlaut hervor. »Limmann? Der ist mit den anderen Kradmeldern draußen. Die kommen erst morgen wieder«, kriege ich zu hören. Dann knallt er mir die Tür vor der Nase zu. Mist, ihn kann ich also nicht um Rat fragen.
Zum Glück treffe ich beim Verlassen des Gebäudes auf einen anderen Bekannten, der als Fernmelder für die Funkgeräte der 1. Kompanie verantwortlich ist. Er beantwortet meine Fragen bereitwillig und nimmt mir meine Bedenken, mich zum AVZ versetzen zu lassen. »Die Jungs sind alle in Ordnung. Einige sind etwas grob, aber davon solltest du dich nicht abschrecken lassen. Und mit Hauptfeldwebel Festas hast du einen superguten Häuptling. Der fordert seinen Leuten zwar ne Menge ab, aber er ist auch sehr fair. Ein Infanterist durch und durch. Wird aber dauern, bis du ihn kennenlernst. Er ist auf dem Rangerlehrgang in den USA. Ein Training für Spezialkräfte, bei dem du sechs Monate ununterbrochen auf den Einsatz in allen Regionen der Erde vorbereitet wirst. Von der Wüste bis zum Dschungel ist alles dabei.« Das klingt spannend. Meine Entscheidung ist gefallen. Wenn ich in den Einsatz gehen soll, dann mit diesen Männern. Keine vier Stunden nach unserem letzten Gespräch melde ich mich erneut beim Spieß und sage ihm, wie ich mich entschieden habe. »Das ging aber fix. Schön, dann lassen Sie sich von Kutz das 90 /5-Formblatt zur Feststellung Ihrer Auslandsverwendungsfähigkeit geben. Sie können dann gleich mit ihm zur Truppenärztin gehen und sich durchchecken lassen.«
Die folgenden Wochen beim AVZ vergehen mit der einsatzorientierten Vorausbildung. Patrouillen zu Fuß und mit Geländewagen vom Typ Mercedes Wolf 250-GD, Tarnung, verdeckte Überwachung, Fahrzeug- und Personenkontrollen und so weiter füllen die Tage aus. In der Kaserne geht es zu wie in einem Ameisenhaufen. So intensiv habe ich meinen Dienst bisher nicht wahrgenommen. Der bevorstehende Einsatz motiviert mich und all die anderen, mit einem neuen Verständnis und großer Ernsthaftigkeit zu trainieren. Vorbei ist die Zeit, in der man in spielerischen Trockenübungen einen imaginären Feind bekämpft hat. Meinen Eltern sage ich vorläufig noch nicht, was auf mich zukommt. Ich ahne, dass besonders meine Mutter versuchen wird, mir das auszureden. Als wir zum Abschluss der Vorausbildung geschlossen in das Übungsdorf Bonnland verlegt werden sollen, will ich diese unangenehme Stunde der Wahrheit aber nicht weiter hinauszögern. Uns wird klargemacht, dass wir bereits während der Ausbildungswochen jederzeit mit dem Marschbefehl in den Kosovo rechnen müssen. Es wird uns nahegelegt, unsere finanziellen und sonstigen Angelegenheiten für die nächsten sechs Monate zu regeln und Vertrauenspersonen mit einer Vollmacht auszustatten. Auch mit so unschönen Dingen wie einem Testament und einer Patientenverfügung müssen wir uns auseinandersetzen.
Ich bin jung, gesund und stark. Mir passiert schon nichts! Außerdem ist die Bundeswehr ja mit humanitären Aufgaben betraut und nicht wie die Amerikaner ständig in Kampfhandlungen verstrickt. Aber wie erklärt man das seiner Mutter? Am letzten gemeinsamen Wochenende fasse ich mir ein Herz. Ich besorge Samstag früh Brötchen von unserem Lieblingsbäcker und decke den Tisch. Nach dem Frühstück bitte ich meine kleine Schwester, aufs Zimmer zu gehen, da ich mit unseren Eltern etwas zu bereden hätte. Ruhig und bestimmt sage ich dann: »Ich werde in den Kosovoeinsatz gehen.« Meine Mutter reagiert viel heftiger, als ich erwartet habe: »In den Kosovo? Du spinnst ja wohl! Da gehen doch nur Mörder hin. Wenn du dort hingehst, wirst du auch zum Mörder!« Ich blicke zu meinem Vater hinüber. Auch er scheint überrascht zu sein, wie vehement sie sich gegen den Einsatz ausspricht. Vielleicht sagt er deshalb lieber gar nichts. Meine Mutter hingegen ist nicht mehr zu bremsen. Alle meine Versuche, sie umzustimmen, und jedes Argument von mir, weshalb es politisch und humanitär wichtig ist, sich dort zu engagieren, schmettert sie ab. »Seit wann interessierst du dich denn für Politik? Du hast doch keine Ahnung, was in Jugoslawien los ist. Und beim Bund haben die euch bestimmt auch nichts über die Zusammenhänge erzählt. Da auf dem Balkan bekriegen sie sich schon seit Jahrhunderten.« Wütend schreie ich durch die Küche: »Das ist mir doch egal! Ich gehe in den Einsatz! Ich habe mich schon dazu verpflichtet!« Jetzt fängt meine Mutter auch noch an zu weinen. Mein Vater nimmt sie tröstend in die Arme und ich komme mir furchtbar schlecht vor. Wütend verlasse ich die Wohnung und knalle hinter mir die Tür zu.
Ziellos laufe ich durch die Stadt und überlege, wie ich mich verhalten soll. Ich will mit meinen Kameraden in den Einsatz. Wir haben so viel gemeinsam erlebt und durchgestanden, da will ich mich jetzt nicht ausschließen. Irgendwie bin ich auch stolz darauf, dass ich als Soldat für diese heikle Aufgabe eingeplant bin, und habe das auch von meinen Eltern erwartet. Ich bin enttäuscht und beschließe, noch heute zurück in die Kaserne zu fahren. Meine kleine Schwester sitzt auf der Treppe vor dem Haus. Sie freut sich, mich zu sehen, vielleicht hat sie auf mich gewartet. »Mutti ist ganz schön sauer«, sagt sie. Ich packe schnell meine Sachen zusammen. Meine Eltern sagen zum Glück nicht viel, aber die Stimmung ist bedrückt. So hatte ich mir den Abschied nicht vorgestellt. Im Vorbeigehen sage ich: »Ich bin jetzt erst einmal ein paar Wochen in Hammelburg im Übungslager. Zum Telefonieren komme ich da aber nicht.« Die kleine Reisetasche mit meiner Wäsche schmeiße ich auf den Rücksitz meines Autos und fahre verärgert zur Kaserne. »Mörder«, geht mir durch den Kopf. Als ob ich ein Mörder wäre … So ein Quatsch!
Der Montagmorgen in der Kaserne beginnt bei tiefster Dunkelheit. Wir werden vom nahe gelegenen Güterbahnhof aus starten und etwa 13 Stunden bis zu unserem Ziel in Bayern brauchen. Antreten, Beladen der Lkw, geordnete Aufstellung an der Waffenkammer zum Waffenempfang, ein letztes Frühstück in unserem Speisesaal, wo wir auch unsere Marschbeutel mit der Verpflegung für die nächsten 24 Stunden erhalten, alles läuft nach einer Art Choreografie ab. Ich beeile mich mit dem Frühstück, da ich als Fahrzeugführer dafür verantwortlich bin, den Geländewagen auf dem Güterwaggon zu verzurren und gegen Wegrollen zu sichern. Als die Bahn sich in Bewegung setzt, herrscht eine ausgelassene Stimmung. Ich muss unwillkürlich an die Bilder der jungen Soldaten denken, die fröhlich aus einem Güterwaggon winkend in den Ersten Weltkrieg ziehen. Den Gedanken schiebe ich lieber schnell zur Seite und frage den Oberstabsgefreiten Zott, der mit mir im Abteil sitzt, weshalb wir 13Stunden bis Hammelburg brauchen. »Fährst wohl das erste Mal nach Hammelburg?«, kriege ich zur Antwort. Ein schiefes Lächeln erhellt sein mürrisches Gesicht. Ich nicke nur etwas verlegen. »Alter, du hast ja keine Ahnung! Alle Personenzüge, die unseren Weg kreuzen, haben Vorrang. Die meiste Zeit der Fahrt warten wir dumm vor den Bahnhöfen, bis die Zivilisten durch sind. Klar?« – »Klar.«
Dann werfe ich einen Blick in den Marschbeutel. Das ist wohl die stille Rache der Küchensoldaten, weil wir uns immer über das Essen beschweren, geht mir durch den Kopf. Vom Knistern der Plastiktüte animiert, kramt auch Zott seinen Proviant aus der Seitentasche seines Rucksacks hervor. Dort, wo ich streng nach Verpackungsplan eine wassergefüllte Feldflasche aus Aluminium und ein kleines olivgrünes Stoffmäppchen mit Nähzeug habe, zaubert er eine Flasche Cola und ein Paket Waffeln hervor. Zott bemerkt meinen gierigen Blick und reicht mir beides herüber. »Verpackungsplan schön und gut. Aber du musst lernen, in Zukunft zweckmäßig zu packen.« – »Ja«, sekundiert der ansonsten wortkarge Hauptgefreite Jennrich aus seiner Ecke: »Mann, du weißt doch, dass die nur unnützen Kram in die MArsch-Beutel stopfen!« Trotz meiner inzwischen fast 15Monate Dienstzeit komme ich mir zwischen diesen alten Hasen wie ein Grünschnabel vor. Als wir Hammelburg erreichen, ist es später Abend. Bis weit nach Mitternacht sind wir mit dem Abladen und dem Beziehen der Unterkunftsgebäude beschäftigt. Als wir uns endlich hinlegen dürfen, bin ich völlig erledigt und schlafe sofort ein.
Am nächsten Morgen erkunde ich das Lager genauer. Der Aufklärungs- und Verbindungszug wurde beauftragt, den Weg zu den einzelnen Übungsstationen mit Wegweisern zu kennzeichnen. Dabei erfahre ich von Oberfeldwebel Rüstmann, meinem direkten Vorgesetzten, den ich bei dieser Aufgabe begleite, dass Hammelburg bereits seit 1896der Infanterie als Truppenübungsplatz dient. Die Ortschaften Bonnland und Hundsfeld sind zentraler Bestandteil dieser Anlage, in der man den Ortsund Häuserkampf besonders realistisch übt, weil diese Gefechtssituation für diejenigen, die in Gebäude eindringen wollen, äußerst riskant und verlustreich ist. »Damit die ›Sturmtruppen‹ das üben können, wurden die beiden Siedlungen 1937von den Nazis kurzerhand zwangsgeräumt«, erzählt mir der Oberfeldwebel, während wir die Hinweisschildchen in den Boden pflanzen. Es ist die größte Anlage in Europa, um den Kampf in einer Ortschaft zu üben. Soldaten aus Partnerstaaten wie Frankreich und Belgien kommen hierher, um zu trainieren. Allein in Bonnland stehen etwa 120Häuser. Sie sind teilweise voll eingerichtet. Es gibt ein Straßencafé, ein Gemeindehaus mit Bürgermeisterstube, eine Werkstatt und viele kleine Schweinereien wie ein unterirdisches Kanalsystem, Scharfschützenverstecke, Löcher in der Decke und in den Wänden, von wo jederzeit ein Angriff erfolgen kann. »Die haben sogar ein Hochhaus hingestellt, damit wir uns vom Dach abseilen und durch die Fenster schwingen können«, erzählt mir Rüstmann lachend. Er liebt diese Art Nervenkitzel wohl und freut sich ganz offensichtlich auf die Wochen auf dem Übungsplatz. Anhand der eingelagerten Munition kann ich erahnen, dass wir in nächster Zeit mehr Patronen verschießen werden, als ich es während meiner gesamten bisherigen Dienstzeit getan habe.
Vom Ausschildern zurück, steht erst einmal trockener Unterricht auf dem Plan. Wir werden in die Sitten und Gebräuche Jugoslawiens eingewiesen und erhalten etwas Landeskunde. Auch die gebräuchlichsten Sätze für unseren Auftrag werden uns mitgegeben. Fett gedruckt ist dabei »Stop or I fire«, auf Serbokroatisch »Stani ili pucam« und auf Albanisch »Ndal ose une do te Quelloy«. Später gehen wir in eine Scheune. Um einen Sandkasten herum sind mehrere Holzbänke aufgestellt. Uns wird anhand des darin errichteten Modells der Ortschaft ein Übungsszenario beschrieben, das wir im Anschluss bewältigen sollen. Die Männer des AVZ sind einer Kampfkompanie unterstellt und auf die einzelnen Züge aufgeteilt worden. Mich hat man mit Oberfeldwebel Rüstmann dem Zug von Hauptfeldwebel Schleifer aus der 2. Kompanie zugeteilt. Ein sehr großer, kräftiger Mann mit lauter und sonorer Stimme. Ich habe ihn noch nie lächeln sehen, geschweige denn lachen hören. Er ist bekannt dafür, dass er die Dienstvorschriften nahezu wörtlich umsetzt und seinen Männern ein hohes Maß an Disziplin abverlangt.
Nach der Instruktion teilt der Hauptfeldwebel den einzelnen Gruppen seines Zuges ihre Aufgaben zu. Ich soll mich mit den Sanitätern in weniger exponierter Position aufhalten – eine logische Entscheidung, damit niemand im Weg steht, wenn er seine gut aufeinander eingespielten Leute durch das Geschehen dirigiert. Trotzdem bin ich enttäuscht und wäre lieber mehr eingebunden worden. Die Gelegenheit dazu bietet sich gleich nach dem ersten Szenario. Zwei Übungsgruppen, die miteinander verfeindete Ethnien in der Konfliktregion darstellen, sollen davon abgehalten werden, sich auf offener Straße anzugehen. Die ganze Situation wird in einem Worst-Case-Szenario auf die Spitze getrieben. Aus den umliegenden Gebäuden kommen immer weitere Akteure. Aufgebrachte Personen rufen von der Straße wütend irgendetwas Unverständliches in das Haus der anderen Konfliktgruppe. Die Stimmung ist merklich feindselig. Ein fremdartiges Sprachgewirr erschwert es den Soldaten auf dem Prüfstand, die aufgebrachten Parteien voneinander zu trennen. Da ein Teil der Darsteller russisch spricht, biete ich mich als Dolmetscher an.
Ab sofort bin ich mitten im Geschehen und werde beauftragt, in der nächsten Übungsdarstellung vorweg in ein einsturzgefährdetes Haus zu gehen. In dem Gebäude, aus dem dicke Rauchschwaden emporsteigen, soll sich noch eine Person befinden, die gerettet werden soll. Menschen, deren Absichten unklar sind, laufen aufgeregt umher, sie schreien und werden zudringlich, außerdem kann man sich im Haus nur mithilfe des Tastsinnes durch Geröll und Schutthaufen bewegen – ich gerate in erheblichen Stress. Obwohl es sich um eine Übung handelt, steigt mein Adrenalinspiegel. Ich muss mir immer wieder bewusst machen, dass es nur darum geht, uns auf heikle Situationen im Einsatzland gefasst zu machen. Meine Kameraden, von denen ich größtenteils nicht einmal die Namen kenne, und ich meistern die Aufgabe zur vollen Zufriedenheit der Ausbilder, die uns die ganze Zeit mit Argusaugen beobachtet haben. Als ich bei der abschließenden Beurteilung vom Übungsleiter vor die Front gerufen werde und mein Handeln explizit gelobt wird, bin ich mehr als nur stolz. Ich habe die Hoffnung, von den Berufssoldaten anerkannt und nicht mehr nur als einer dieser Wehrdienstleistenden wahrgenommen zu werden, die kommen und wieder gehen.
Es gibt noch andere Arten der Prüfung für uns. Dicht aufeinander folgend müssen wir ohne Taschenlampe einen engen Kanal durchkriechen, der vollständig abgedunkelt ist. Man möchte herausfinden, wer in solch einer Situation dazu neigt, die Nerven zu verlieren. Das zügige Überqueren eines Dachbodens auf einem schmalen Balken, ohne durch ein Seil gegen einen 4Meter tiefen Sturz gesichert zu sein, kostet ebenfalls Überwindung. Obwohl ich bereits mehrmals aus einem Flugzeug gesprungen bin, muss auch ich sehr gegen Höhenangst ankämpfen. Kaum ist das überstanden, erwartet jeden Einzelnen von uns ein Sprung in ein finsteres Loch, dessen Grund auch bei genauem Hinsehen nicht auszumachen ist. Ich höre angestrengt, ob ich anhand des Aufschlags der Soldaten, die vor mir in die Tiefe springen, abschätzen kann, wie lange man fällt. Es ist nutzlos. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mein Leben und meine Gesundheit in die Hände der mir vorgesetzten Ausbilder zu legen und Vertrauen zu haben. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass die eine Menge Ärger bekommen und etliche Stapel Papier ausfüllen müssten, falls mir etwas zustößt. Die nächste Beförderung ließe dann auch auf sich warten.
Eine Ausbildungsstation beeindruckt mich mehr als alle anderen. Es ist der Minenlehrpfad. Statt einer Detonation löst man glücklicherweise nur eine Klingel aus, aber die Häufigkeit, mit der ich versehentlich eine versteckte Sprengladung oder Mine ausgelöst hätte, erschreckt mich. Ein paar Meter weiter ist anhand einer durchsiebten Mauer, eines völlig verformten Autowracks und anderer, vermeintlich stabiler und schützender Objekte dargestellt, welch verheerende Wirkung bereits kleine Mengen Sprengstoff haben können. Zum ersten Mal entsteht in mir eine reale Vorstellung vom Krieg. Und trotzdem wächst mein Selbstbewusstsein. Ich bekomme das Gefühl, zusammen mit meinen Kameraden jede noch so schwierige Aufgabe bewältigen zu können. Die Rolle als Kampfsau mit schwarz getarntem Gesicht unter dem Gefechtshelm und dem Sturmgewehr im Anschlag fühlt sich irgendwie gut an.
Kurz vor unserer Rückfahrt in die Kaserne wird uns an einem Freitag Ausgang bis zum Abend gewährt. Jeder nutzt diese Gelegenheit und versucht so viel wie möglich vom schönen Leben zu erhaschen, bevor wir bald schon in eine uns fremde und gefährliche Welt aufbrechen. Die Wirtshäuser und Weinstuben sind an diesem Tag mehr als gut gefüllt. Die meisten von uns haben keine Zivilkleidung dabei und sind in Uniform unterwegs. Glücklicherweise stößt das in diesem Teil der Republik eher auf Zuspruch und etliche der hiesigen Mädchen erliegen unserem an diesem Tag mit besonderer Intensität versprühten Charme. Am Samstag beginnt der Dienst gnädigerweise erst um 08:00 Uhr. Wir nutzen die guten Trainingsmöglichkeiten an der Infanterieschule in Hammelburg auch am Wochenende für eine intensive Vorbereitung auf den Einsatz im Kosovo. Dafür wird uns für den Abbau und die Verpackung der Ausrüstung verhältnismäßig wenig Zeit eingeräumt. Zurück in unserem Heimatstandort in Varel, geht es in aller Hast weiter. Wir haben durchgehend Dienst und bekommen kaum die Gelegenheit, während einer kurzen Dienstunterbrechung noch ein paar Kleinigkeiten wie Rasierzeug oder Zahnpasta einzukaufen.
Am darauf folgenden Wochenende bekommen wir von Freitag bis zum späten Sonntagabend die letzte Gelegenheit, unsere Angelegenheiten zu regeln. Bis zum Zapfenstreich um 22:00 Uhr muss sich jeder beim UvD zurückgemeldet haben. Wer sich verspätet, muss mit ernsten Konsequenzen, sogar mit einer Inhaftierung rechnen. Ein Witz, denn eigentlich habe ich nur am Freitagvormittag die Möglichkeit, mein Auto abzumelden und bei der Bank eine Vertrauensperson zu bevollmächtigen. Das ist nicht ganz einfach, wenn die dazu bestimmte Person, meine Mutter, persönlich und in meinem Beisein einem Angestellten der Bank ihren Personalausweis vorlegen muss. Mein Konto habe ich nämlich am Standort meiner Kaserne eingerichtet. Die Zulassungsstelle hingegen, bei der ich mein Auto abmelden will, befindet sich 200 Kilometer entfernt an meinem Wohnort. Eine Unfall- und Sterbegeldversicherung abzuschließen, wie es uns empfohlen wurde, schenke ich mir, um mich nicht noch mehr zu stressen. Es ist mir wichtiger, mich in Ruhe von meiner Familie zu verabschieden. Ein Testament will ich auch nicht schreiben. Das empfände ich als ein schlechtes Omen. Was soll mir schon passieren? Immerhin gehe ich mit Leuten in den Einsatz, die bereits am SFOR-Einsatz in Bosnien oder sogar am Somaliaeinsatz beteiligt waren. Dort wurde die Bundeswehr auch aus allen Kampfhandlungen herausgehalten. Ich vertraue auf die Fähigkeiten meiner Vorgesetzten und darauf, gut ausgebildet worden zu sein. Das Gefühl von Besorgnis lasse ich gar nicht erst aufkommen.
Das Wochenende vergeht schnell und zum Glück friedlich. Meine Eltern fahren mich zur Kaserne und halten am Tor vor dem Wachgebäude. Ich will mich schnell im Auto verabschieden, aber meine Eltern lassen es sich nicht nehmen, mit mir auszusteigen. Meine Mutter umarmt und küsst mich tränenreich. Weil ich allzu rührselige Szenen vor den Augen der Wachsoldaten vermeiden will, bitte ich sie ganz sachlich, meine Wohnungsschlüssel mitzunehmen, die ich ja erst mal nicht brauchen werde, und kündige an, nach meiner Rückkehr per Bahn direkt zu ihnen zu kommen. Leider erziele ich die genau entgegengesetzte Wirkung. Unter Tränen fleht meine Mutter: »Robert, pass bitte gut auf dich auf. Geh ja keine unnötigen Risiken ein, hörst du? Und schreib uns, wenn du angekommen bist.« Erneut umarmt und drückt sie mich. Na toll, wenn die Wachmannschaft das beobachtet, werden die mich gleich schön damit aufziehen, wie Mutti ihren kleinen Liebling in den Krieg ziehen lässt.
Zum Glück ist mein Vater weniger dramatisch und drückt mir zum Abschied einfach nur fest die Hand. Ich rate ihnen noch, beim Chinesen gegenüber der Kirche essen zu gehen, um auf andere Gedanken zu kommen. Meiner Mutter laufen weiter die Tränen über das Gesicht, als mein Vater sie sanft zum Wagen schiebt und sagt: »Das wird schon gut gehen mit Robert.« Erleichtert winke ich den beiden kurz nach, als sie hupend davonfahren. Innerlich richte ich mich auf den Spott meiner Kameraden ein, doch glücklicherweise lächeln die nur milde und der Wachhabende sagt mir im Vorbeigehen: »Bist heute nicht der Einzige, dems so geht, Müller!« Nach und nach treffen alle Männer des AVZ in ihren Stuben ein. Bis zum Zapfenstreich trinken wir noch ein paar Dosen Bier und reden über belanglose Dinge, um die Anspannung zu lösen.
Am nächsten Morgen läuft alles wie ein Uhrwerk ab. Selbst die kleinen Pannen, die es sonst immer gibt, bleiben heute aus. Sogar die Truppenküche hat sich besonders viel Mühe gegeben und uns außer einem guten Frühstück auch reichhaltig gefüllte Marschbeutel bereitgestellt. Es geht also doch! Die gesamte Ausrüstung des Bataillons ist bereits von einer Spedition zum Flughafen gebracht worden. Fast alle Keller und Waffenkammern sind komplett leer geräumt. Da der Nachschub erfahrungsgemäß erst nach einigen Wochen ins Rollen kommt, hat man uns alles zusammenpacken lassen, um in der ersten Zeit möglichst autark zu sein. Es ist der erste Kriegseinsatz der Bundeswehr und wir werden als die ersten deutschen Bodentruppen in einem vom Krieg verwüsteten Gebiet ankommen.
Medienberichten der letzten Wochen zufolge ist die Infrastruktur dort völlig zusammengebrochen. Bilder der Ströme von Flüchtlingen, die verzweifelt versuchen, die Auffanglager des UNHCR zu erreichen, sind allgegenwärtig, ebenso die Berichterstattung über die Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO. Unser oberster Dienstherr, Verteidigungsminister Rudolf Scharping, macht seine Haltung vor dem Parlament und der Öffentlichkeit deutlich: »Wenn ich höre, dass im Norden von Pristina ein Konzentrationslager eingerichtet wird, wenn ich höre, dass man die Eltern und die Lehrer von Kindern zusammentreibt und die Lehrer vor den Augen der Kinder erschießt, wenn ich höre, dass man in Pristina die serbische Bevölkerung auffordert, ein großes S auf die Türen zu malen, damit sie bei den Säuberungen nicht betroffen sind, dann ist da etwas im Gange, wo kein zivilisierter Europäer mehr die Augen zumachen darf, außer er wolle in die Fratze der eigenen Geschichte schauen.« Außenminister Joschka Fischer bringt es mit seinem Appell an seine Partei auf den Punkt: »Wir haben immer gesagt: ›Nie wieder Krieg!‹ Aber wir haben auch immer gesagt: ›Nie wieder Auschwitz!‹«
Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber wir hoffen für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, als wir abrücken. Außer der sogenannten persönlichen Ausrüstung, dem Seesack und der Tragetasche, worin unser gesamter Spindinhalt verstaut ist, haben wir unseren Rucksack am langen Arm dabei. Glücklicherweise bin ich inzwischen um einiges kräftiger als damals, als ich das ganze Zeug zum ersten Mal schleppen musste. Mehrere Kraftomnibusse der Bundeswehr, kurz KOM genannt, stehen auf dem Exerzierplatz für uns bereit. Gerade als wir losfahren wollen, bemerkt einer, dass seine Waffe weg ist. Wir müssen auf den Befehl unseres wütenden Kompaniechefs hin alle wieder aussteigen und vor dem Bus antreten. Dem unseligen Kameraden fällt ein, dass er die Waffe im Speisesaal hat liegen lassen. »Sie haben exakt drei Minuten, um sich bei mir zurückzumelden«, wird ihm zornig entgegengeschleudert. Während er mit hochrotem Kopf an uns vorbeirennt, kassiert er Ausrufe wie »Idiot!«, »Mann, bist du blöd!« und »«Dämlicher Arsch!« Die Nerven liegen bei vielen blank. Ich nehme mir vor, noch besser auf meine Waffe aufzupassen, damit ich nicht zur Zielscheibe für Spott und Scheißaufträge werde.
Der amtierende Trottel der Kompanie erscheint zu seinem Glück wenige Sekunden vor Ablauf der gesetzten Frist und wir zwängen uns wieder in den Bus. Am Militärflughafen erwartet uns eine Transall C160. Ich bin gespannt, wie es ist, mit der Maschine nach dem Flug auch mal zu landen und nicht immer vorher rauszuspringen. Während des Flugs kreisen meine Gedanken. Ob ich wohl gezwungen sein werde, auf Menschen zu schießen? Die Taschenkarte mit den Rules of Engagement (RoE), also den Einsatzregeln, besagt, dass wir uns oder andere notfalls mit der Schusswaffe verteidigen dürfen. Das Massaker von Srebrenica vom Juli 1995hat deutlich gemacht, dass man sich und seine Schutzbefohlenen teilweise nur durch Waffengewalt vor Übergriffen oder gar Ermordung schützen kann. Doch das alles sind Gedanken, mit denen ich mich jetzt und hier nicht befassen will. Ich versuche mich abzulenken und frage den Bordmechaniker, der an mir vorbeigeht, ob ich aufstehen darf, um aus dem Fenster zu schauen. Er bejaht das und weist mich zu meiner Belustigung noch auf die Militärausgabe einer Flugzeugtoilette hin: ein schmaler grauer Vorhang, hinter dem sich eine Nische mit einem kleinen, auf Hüfthöhe angebrachten Becken befindet.
Wir landen in Skopje, von wo aus die NATO den Personen- und Materialtransport in den benachbarten Kosovo koordiniert. In der Hauptstadt Mazedoniens herrschen Temperaturen von über 40Grad. Kaum trete ich aus der Maschine, läuft mir der Schweiß über das Gesicht. Als wir uns den Reisebussen, die von den örtlichen Reisegesellschaften angemietet wurden, nähern, traue ich meinen Augen kaum. Mit diesen völlig abgewrackten Touristenbussen sollen Soldaten in eine Krisenregion transportiert werden? Unsere Militärfahrzeuge werden im Einsatzland regulär TÜV-geprüft, unabhängig davon, dass sie in kurzen Intervallen von der Instandsetzungseinheit auf ihren erstklassigen Zustand gecheckt werden, damit sie immer zuverlässig funktionieren. Wenn da ein Teil hakt, legt man den Wagen sofort still. Aber jetzt mit diesen schrottreifen Bussen hier auf abgefahrenen Reifen unterwegs zu sein, auf Straßen, die diese Bezeichnung nicht verdienen, mit einem Schlagloch neben dem anderen, ab und an auch noch mit einer Bodenwelle dazwischen – was soll man davon halten? Darauf gibt es die Standardantwort wie auf die meisten Fragen bei der Bundeswehr: »Ist halt so!«
Also steige ich mit meinem Rucksack beladen in das Schrottmobil ein. Die rostige Stufe gibt verdächtig unter meinem Gewicht nach, aber der jugendliche Busfahrer, der wie ein Freischärler in bunt zusammengewürfelter Militärbekleidung steckt, winkt mich freundlich hinein. Klar freut er sich, denke ich misstrauisch. Unbewaffnet, wie wir sind, verkauft er uns an der nächsten Ecke an einen serbischen Kriegsverbrecher. Wir türmen unsere Rucksäcke im Mittelgang übereinander auf und quetschen uns auf die viel zu kleinen Sitze. Dass sich die vordere Tür des Busses während der Fahrt nicht schließen lässt, ignoriere ich ebenso wie die leichte Schräglage. Für die knapp 50 Kilometer werden wir mindestens eine Stunde unterwegs sein.
Gerade als ich mir die Kopfhörer meines Discman in die Ohren stecken will, um mich während der Fahrt nach Tetovo etwas zu entspannen, kracht es heftig. Natürlich denke ich zunächst, dass etwas von dem Vehikel abgebrochen ist. Doch der anhaltende prasselnde Lärm und ein Blick aus dem Fenster belehren mich eines Besseren. Am Straßenrand stehen Leute, die uns mit einem Steinhagel begrüßen. Sechs oder sieben Männer haben die rechte Hand erhoben und machen den Hitlergruß und mit der Linken fahren sie sich über die Kehle. Der Busfahrer tritt aufs Gaspedal, aber die überladene Krücke kommt nicht in Fahrt. Wir haben noch nicht einen Schuss Munition in der Tasche und ich frage meinen Sitznachbarn Wolf: »Sollen wir uns hier vielleicht mit dem Messer verteidigen oder was hat sich unsere schlaue Führung gedacht?« – »Tja, Y-Tours, wir buchen – Sie fluchen«, antwortet er mir mit dem gleichen Sarkasmus in Anspielung auf die mit Y beginnenden Kfz-Kennzeichen der Bundeswehr. Während der Vorausbildung in Hammelburg gab es ein ähnliches Szenario, das mit einer Geiselnahme durch Aufständische endete. Besorgt und sicherlich auch etwas naiv frage ich laut, was die denn für ein Problem haben. Obergefreiter »Atze« Schröder dreht sich zu uns um und sagt in seiner lakonischen Art: »Da haben unsere Großväter wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen.« Atze gehört auch zum AVZ. Er ist ein großer, aber eher drahtiger Typ, der beim Laufen immer ganz weit vorn an der Spitze ist, obwohl er kaum dafür trainieren muss. Häufig bringt er uns mit seinem trockenen Humor zum Lachen. Endlich lassen wir die aufgebrachte Meute hinter uns. Die Fenster haben den Steinwürfen irgendwie standgehalten und niemand ist zu Schaden gekommen.
Auf der kurzen Strecke nach Tetovo wird kein Zwischenhalt eingelegt. Dummerweise haben aber einige wegen der Hitze im unklimatisierten Bus ihren Getränkevorrat geleert, ohne sich Gedanken zu machen, wo sie ihre Blase entleeren könnten. Der Bus hat keine Toilette und so müssen sie sich anders behelfen. Wer das Glück hat, eine Plastikflasche dabei zu haben, schneidet ihr den Hals ab und zirkelt so gut es geht seinen Urinstrahl hinein. Mit spitzen Fingern werden sie dann nach vorne zur offenen Tür durchgereicht und mit einem gekonnten Wurf wie eine Handgranate aus dem Bus geschleudert.