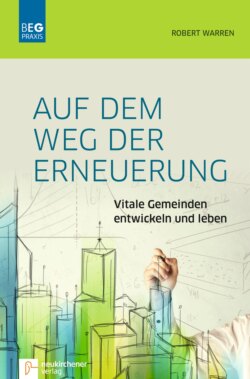Читать книгу Auf dem Weg der Erneuerung - Robert Warren - Страница 12
ОглавлениеKapitel 2 – Hindernisse überwinden
Gehen wir also davon aus, dass es die Aufgabe von Kirche ist, auf persönlicher und gemeinschaftlicher Ebene die Erkenntnis Gottes anzustreben und zu verkörpern, dann stellt sich die Frage: Warum ist dies nicht viel deutlicher sichtbar? Was hindert die Gemeinden daran, die Merkmale einer vitalen Gemeinde mehr nach außen hin zu zeigen? Viele Pfarrerinnen, Pfarrer und Laien sehnen sich danach, ihre Gemeinde zu einem lebendigen Zentrum christlicher Spiritualität und christlichen Lebens zu machen. Warum also ist das Bild von Kirche so anders?
„Immer weniger Menschen in den Ländern der ‚ersten Welt‘ fühlen sich angezogen vom Christentum, weil in Religion so wenig Spiritualität zu finden ist.“18
„Es ist beunruhigend und aufschlussreich zu hören, dass die die Kirche von Suchenden außerhalb nicht mehr dafür kritisiert wird, ‚langweilig‘, ‚altmodisch‘ oder ‚irrelevant‘ zu sein. Heute wird sie kritisiert, weil sie nicht ‚spirituell‘ genug ist.“19
Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass jede Gemeinde und jede Glaubensgemeinschaft einzigartig ist, so wie jede und jeder von uns einzigartig ist. Es gibt kein einfaches ‚Allheilmittel‘, das die eindeutig vorhandene Vielzahl von Gründen überbrücken könnte, die unsere Gemeinden daran hindern, geistliche Vitalität auszustrahlen. Es gibt allerdings gemeinsame Themen, auch wenn deren Umsetzung von einer Gemeinde zur nächsten unterschiedlich ist.
Wir wollen uns im Folgenden einige der wichtigsten Hindernisse anschauen und überlegen, wie man sie überwinden kann.
Hindernisse überwinden – biblische Wurzeln
Die Schrift erzählt nicht nur die Geschichte von Menschen, die der übernatürlichen Heiligkeit Gottes begegnen, sondern auch die von den vielfältigen Hindernissen auf einem Lebensweg in der Nachfolge.
Adam und Eva scheitern an der ersten Hürde, die Kinder Israels sehnen sich nach „den Fleischtöpfen Ägyptens“ zurück, Elia floh vor Isebel in die Wildnis, der sensible Jeremia landete in einem Brunnen, Daniel und seine Freunde fanden sich in einer Löwengrube wieder, Jakob kämpfte mit Gott auf dem Weg zurück zu seinem Bruder, den er betrogen hatte, Mose war mit Mangel an Nahrung und Wasser konfrontiert, Nehemia überwand physische Angriffe und psychologische Kriegsführung beim Wiederaufbau von Jerusalem; all dies sind Symptome für ein Volk, das um sein Überleben kämpft.
Auch Jesus erfuhr Gegenwind von den religiösen Autoritäten und politischen Mächten, die dann zu seiner brutalen Folterung und Kreuzigung führten. Kein Wunder also, dass er diejenigen, die ihm nachfolgten, lehrte, sich ebenfalls auf solche Kämpfe einzustellen: „Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.“ (Matthäus 5,12) Schließlich überwand Jesus in seinem Leiden die unterdrückende Kraft der Römer und der religiösen Führer durch seine aufopfernde Liebe und „öffnete damit das Reich des Himmels für alle, die an ihn glauben“.
Kein Wunder, dass das letzte Buch der Bibel einen neuen Begriff für die Gläubigen prägt: die Überwinder. Am Verwunderlichsten aber ist das, was Jesus tat und Paulus lehrte: Die Gläubigen sind aufgerufen entgegen der eigenen Intuition, das Böse mit Gutem zu überwinden.
Texte zum Thema: Matthäus 5,38-42; Markus 3,1-6; Lukas 4,1-13; Römer 12; 1. Korinther 13.
Die Tyrannei des Dringlichen
Die ständige Geschäftigkeit des Lebens und die endlose Liste von Aufgaben, die erledigt werden müssen, hindern Pfarrerinnen, Pfarrer und Laien daran, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die wirklich wichtig sind. Hat man die Wahl zwischen dringend und wichtig, dann entscheiden sich die meisten von uns für das Dringende, einfach weil es die lautere Stimme und eine unmittelbare Wirkung hat. Darüber vergessen wir oft, was wirklich getan werden muss. In exakt diese Situation kam Jesus vor 2000 Jahren als er sagte:
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“(Matthäus 11,28-30)
Gewöhnlich betrachten wir ‚Nachfolge Christi‘ als eine herausfordernde Art zu leben. Die Wahrheit ist jedoch, dass das Leben weniger von Angst geprägt ist, wenn wir seinem Weg folgen und seine Prioritäten zu unseren eigenen machen. Ja, es hat seinen Preis, aber es schenkt auch Ruhe. Diese Wahrheit kam auf überraschende Weise zum Vorschein bei unserer Suche danach, was eine vitale Gemeinde ausmacht. Wir alle, die wir Geschichten aus den 25 (zahlenmäßig) gewachsenen Gemeinden gesammelt haben, gingen unbewusst von der Annahme aus, dass es sich dabei einfach um Gemeinden handelte, die schneller und härter arbeiteten als andere. Entdeckt haben wir, dass diese Gemeinden ‚fokussiert statt aktionistisch‘ sind. Außerdem lag Ihr Fokus auf Dingen von Bedeutung: Das Wichtige zählte mehr als das Dringende. Sie hatten entdeckt, welches Geheimnis darin liegt‚ sich auf das Wesentliche zu konzentrieren‘.20
Wie also könnten Gemeinden, Geistliche und Menschen, die erkennen, dass sie mehr ‚aktionistisch sind als fokussiert‘, dieses Problem in Angriff nehmen? Ein großer Schritt ist schon getan, wenn man es zugibt. Ansonsten muss man damit rechnen, dass die Gemeinde und alle, die sich dort engagieren, an den Rand der Erschöpfung geraten mit dem Gefühl, trotz aller Bemühungen nichts zu erreichen. Innehalten ist also überlebenswichtig. Und das nicht nur mal eben kurz, sondern lange genug, um eine Bestandsaufnahme und einen Plan machen zu können, wie es gelingen kann, ‚zurückzukehren zum Herz dessen, worum es eigentlich geht‘.
Was also kann dabei helfen, ein solches Innehalten herbeizuführen?
Der erste Schritt ist, zwischen ‚Handeln‘ und ‚Dasein‘ zu unterscheiden. Sollen der Einzelne sowie die Gemeinschaft gesund sein, müssen diese beiden Pole menschlicher Existenz in eine Balance gebracht werden. Der griechische Philosoph Sokrates sagte vor über zweitausend Jahren, dass „ein Leben kein Leben ist, wenn es nicht kritisch betrachtet wird“. Um zurückzukehren zu dem, worum es im Kern geht, müssen sich eine Gemeinde und alle, die sich dort engagieren, zuallererst trauen innezuhalten. Sie müssen innehalten, um Bilanz zu ziehen, die eigene Situation zu bewerten und dann herauszufinden, wo hinein Energie und Aufmerksamkeit fließen müssen. Das ist schwer, besonders dann, wenn eine Gemeinde nicht daran gewöhnt ist. In diesem Fall müssen Wege gefunden werden, das zu vermitteln. Wenn Gemeinde sich in eine reflektierende Gemeinschaft verwandelt ist dies eine frohe Botschaft für alle: für die einzelnen Gemeindemitglieder genauso wie für die Glaubensgemeinschaft.
Im zweiten Schritt müssen Wege gefunden werden, um das Innehalten in das Leben Einzelner und der Gemeinschaft zu integrieren. Im Gottesdienst eine kurze Zeit der Stille einzuhalten nach Lesungen und Evangelium (wenigstens eine Minute – mit Blick auf die Uhr) und Zeit zwischen den Fürbitten sind hilfreich, um Gewohnheiten zu verändern. Auch wenn sich die Gemeindeleitung bei ihren Sitzungen und auch bei weniger formalen Treffen – wie einem gemeinsamen Wochenende – Zeit nimmt zur Reflexion und zum Gebet, ist dies hilfreich für den gesamten Prozess. Auch gemeinsames Lesen von entsprechender Literatur kann uns selbst, anderen Einzelpersonen und auch Gruppen dabei helfen, das Tempo so zu verlangsamen, dass wir Gottes Prioritäten für die eigene Gemeinde erkennen und den eigenen Anteil daran. Vertiefend – besonders für Leitungsteams – wirkt hier die Arbeit mit einem themenbezogenen Sachbuch.21
Ebenso helfen kann ein Leitungstreffen ohne Tagesordnung einmal im Vierteljahr, bei dem man darüber nachdenkt, worum es im Kern der Arbeit geht. Eine gute Maßnahme ist auch, Pfarrerinnen und Pfarrer zu ermutigen, Reflexionszeiten einzuplanen (z. B. einen Studientag im Monat). Hierzu bedarf es einer Selbstdisziplin, die geübt werden muss. Wenn Laien (z. B. Mitglieder der Gemeindeleitung) eine solche Praxis speziell fordern, kann dies auch Ansporn sein für die Hauptamtlichen der Gemeinde. Ein Innehalten aller Betroffenen soll im Wesentlichen zu der Erkenntnis führen, wie ein Gemeindeleben mit Fokus auf das ,Dasein‘ neu ausbalanciert werden kann.
Drittens hilft es – auch wenn dies am allerschwierigsten ist – ‚Nein!‘ zu sagen. Meistens möchte man anderen entgegenkommen, das gilt wahrscheinlich in besonderer Weise für Pfarrerinnen und Pfarrer. Trotzdem ist ‚Nein‘ ein Wort voller Vitalität. Es kann ‚nicht jetzt‘ bedeuten oder ‚nicht ich‘. Aber es braucht Mut, ‚Nein‘ zu sagen. Leichter wird es, sobald wir wissen, was Gott von uns erwartet, denn dann haben wir einen klaren Weg, von dem aus wir Ablenkungen besser erkennen können. Wie Nehemia müssen wir in der Lage sein zu sagen: „Ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen.“ (Nehemia 6,3), auch wenn wir sicher lieber einen anderen Weg finden würden, um das zum Ausdruck zu bringen!
Bei all dem tut es gut, sich daran zu erinnern, dass dieses Innehalten – so wie es die oben zitierten Worte Jesu sagen – eine gute Nachricht für von Aktionismus getriebene Menschen ist. Manche mögen sich davor fürchten, viele aber sehnen sich geradezu nach einem Leben in größerer Balance. Eine Gemeinde mit einer solchen Ausrichtung wird diesen Menschen guttun; ein weiterer Grund, diesen Schritt zu tun. Tatsächlich ist das Innehalten eines der Mittel, mit dessen Hilfe das ‚Hinauf zu Gott‘, das ‚Hinein zueinander‘ und das ‚Hinaus in die Welt‘ in einer Handlung zusammenkommen können – im Nichtstun.22
Wenn wir innehalten, um zu beten und nachzudenken, dann werden wir auf weitere Hindernisse auf dem Weg unserer ‚Rückkehr zum Kern‘ stoßen: Unser Nachdenken über uns selbst und die Situation unserer Gemeinde ist auf vielfache Weise verzerrt und abgelenkt. Wir müssen uns die ungesunden ‚geistigen Schubladen‘ sehr bewusst machen.
Verzerrte Sichtweisen
Eine ganz andere Art von Druck oder Ablenkung als die Tyrannei des Dringlichen wird ausgelöst dadurch, dass wir nicht klar oder auch nicht theologisch denken. Es gibt eine ganz Reihe von fehlerhaften ‚geistigen Schubladen‘, die uns daran hindern können, uns auf die Erkenntnis Gottes zu konzentrieren. Eine ‚geistige Schublade‘ ist häufig eine unterbewusste Festlegung, mit der wir in jegliche Situation hineingehen. Folgende Beispiele gehören zu denen, die mir während meiner Arbeit mit Gemeinden am häufigsten aufgefallen sind.
Silodenken
Silodenken beschreibt die in Gemeinden weitverbreitete Tendenz, verschiedene Aktivitäten mental in verschiedene Bereiche zu sortieren, die meistens von säkularem Denken oder Handeln bestimmt sind und nicht von guter Theologie. Die meisten Gemeinden sind zum Beispiel in der Lage, bei Tagen der Stille geistlich zu arbeiten, verlieren diese Dimension aber völlig aus dem Blick, wenn es um Finanzen geht (die meistens aus der ‚Fundraising‘-Perspektive betrachtet werden) oder wenn man als Gemeindeleitung agiert (hier greift meistens die säkulare ‚Sitzungs-Mentalität‘ statt einer christlichen Ausrichtung). Und wenn man versucht, sich in der lokalen Gemeinde zu engagieren, zum Beispiel durch das Angebot eines Seniorenfrühstücks oder einer Eltern-Kind-Gruppe, greift man auf die Schablone ‚soziales Engagement‘ zurück. Ein solcher Ansatz setzt voraus, dass der Glaube nichts Eigenes beitragen kann zum Dienst an anderen.23 Auch wenn es um Themen des Gemeindelebens geht, beschränkt man sich oft auf eine Problemlösung aus Management-Sicht. Die geistliche Dimension wird gar nicht erst ins Spiel gebracht. Dabei wäre aus christlicher Sicht die erste Frage die nach Gottes Berufung für unser Dasein und Handeln in jeglicher Situation.
Organisatorisch denken statt organisch
Wir leben in einer bürokratischen Gesellschaft mit einer Mentalität des Abhakens, in der wir instinktiv darauf trainiert sind, in schematischen Kategorien zu denken. Davon ist auch unsere Beziehung zu Kirche geprägt: Sie ist eine Organisation, eine Maschine, die ‚repariert‘ werden muss. Kirche ist zwar organisiert, ist aber keine Organisation. Sie ist lebendiger Organismus. Der Leib, die Braut Christi, der wahre Weinstock, königliche Priesterschaft lauten einige der Bilder, mit denen die Bibel die Kirche beschreibt. Es sind ausschließlich Bilder von einem lebendigen Organismus. Einen lebendigen Organismus können wir nicht behandeln, als wäre er eine Maschine. Und wir können der Kirche nicht gerecht werden, wenn wir sie nicht als lebendiges Netzwerk von Beziehungen verstehen.
Dies wird häufig deutlich in missionarischen Aktionsplänen. Wenn es um Gottesdienste geht, liegt der Fokus fast immer auf der Veränderung organisatorischer Elemente wie der liturgischen Form, der Gottesdienstzeit oder anderer praktischer Dinge. Sicher muss man sich auch damit beschäftigen, aber die wirklich wichtigen Elemente im Gottesdienst sind nicht so sehr die Strukturen, sondern die inneren Haltungen, mit denen der Gottesdienst gefeiert wird von Pfarrerinnen, Pfarrern und Gottesdienstbesuchern. Diese tiefer gehenden geistlichen, gemeinschaftlichen und organischen Dinge gehen verloren, weil das Thema ausschließlich durch die Brille organisatorischer Veränderung betrachtet wird. Das heißt nicht, dass missionarische Aktionspläne schlecht, falsch oder nicht hilfreich sind; das Problem liegt in der Art und Weise, wie wir sie angehen. Richtig eingesetzt, können sie – und genau das ist bereits geschehen – vielen Gemeinden zu neuen Visionen, Blickrichtungen und kreativen Ideen verhelfen.24
„Wir brauchen nicht primär Strategien und Strukturen, sondern vielmehr eine Veränderung des Bewusstseins. Wir brauchen einen neuen Blick und neue Vorstellungskraft.“25
Nach der Beratung von mehr als fünfzig Gemeinden bei der Erstellung eines missionarischen Aktionsplans ist meine Erfahrung genau diese: Der Blick von Gemeinden auf die Realität ist geprägt von organisatorischem Denken. Statt die innere Haltung zu ändern und die Qualität der Arbeit, sind die geplanten Veränderungen zu neunzig Prozent organisatorischer Art. Vielleicht hatte der Wort ‚Plan/Aktion‘ als Teil des Programms seinen Anteil daran. Trotzdem ist es wichtig zu begreifen, dass
„eine Veränderung der formalen Strukturen nicht das Gleiche ist wie eine Veränderung von Gewohnheiten, Kompetenzen und Überzeugungen.“26
In der Offenbarung finden wir das markante Bild des Engels der Gemeinde. Es deutet darauf hin, dass jede Gemeinde eine bestimmte Persönlichkeit hat, die idealerweise erkannt werden sollte, um dann mit ihr zu arbeiten.27
Dahinter steht die Idee, dass wir die Gemeinde kennenlernen sollen, wie wir das mit einem anderen Menschen tun; ihre Stärken und Schwächen erkennen, herausfinden, wo sie empfindlich ist und – nicht zuletzt – wonach sie sich sehnt.
Die Gemeinde zu beschreiben wie einen Menschen hilft dabei, sie als organisches Gebilde zu sehen. Stellen Sie sich Ihre Gemeinde einmal als eine Person vor: Wie würden Sie sie einem anderen Menschen beschreiben? In einer Reihe von Gemeinden habe ich die Leute als Übung gebeten, mir die drei wichtigsten Charakterzüge der Gemeinde zu nennen, mindestens einen positiven und einen negativen.
Viertes Merkmal einer vitalen Gemeinde: Wir wagen Neues und wollen wachsen.
Eine der Gemeinden nannte folgende drei Charakteristika: konservativ, verwurzelt und erschöpft. In der darauf folgenden Diskussion waren wir uns schnell einig, dass Verwurzelung eine gesunde Eigenschaft ist, denn sie gehört zum ureigensten Wesen christlichen Glaubens. Konservativ konnten wir als gute Anbindung an das christliche Erbe bestätigen; aber die Gruppe stellte bald auch fest, dass Jesu Wirken ausgesprochen radikal gewesen war und sie deshalb offen sein mussten für Gottes Aufforderung, die Komfortzone zu verlassen. Es ging dabei besonders um eine notwendige Veränderung dieser ländlichen (und zum großen Teil aus Senioren bestehenden) Gemeinde: Sie musste sich umstellen und Raum schaffen für die neuen Familien in einer großen neuen zur Gemeinde gehörenden Siedlung mit Eigentumswohnungen. Die Erschöpfung schließlich brachte uns zu dem oben bereits behandelten Thema der Tyrannei des Dringlichen. Gemeinsam haben wir nach Möglichkeiten gesucht, aufzutanken, das Tempo zu verlangsamen und im persönlichen Gebet genauso wie im gemeinsamen Gottesdienst aus der Gnade Gottes Kraft zu schöpfen.
Die Gemeinde wie eine Organisation zu behandeln, hätte dazu geführt, dass wir diese wichtigen Charakteristika übersehen hätten, durch die ein unmittelbarer Bezug zum Leben entstand. Es hätte auch die Effektivität eines jeden Versuchs wirklicher Veränderung entschieden eingeschränkt.
Mittel und Ziele verwechseln
‚Ziele‘ und ‚Mittel‘ werden in der Arbeit von Gemeinden sehr häufig miteinander verwechselt. Nehmen wir zum Beispiel die von Gemeindeleitenden immer wieder gestellte Frage „Wie können wir mehr Menschen in die Hauskreise bringen?“ Ein ‚Mittel‘ (Hauskreise) wurde zum ‚Ziel‘. Ich frage in diesem Fall nach, warum Menschen an Hauskreisen teilnehmen sollen. Weil diese Frage vorher nie gestellt wurde, löst sie oft Verwirrung aus. Meistens kommt als Antwort so etwas wie „Es ist gut, wenn Menschen zu einer Kleingruppe gehören“. Auch hier muss wieder nachgefragt werden: „Worin besteht das ‚Gute‘, das Menschen dort entdecken können?“ „Tiefere Beziehungen“ kommt dann als Antwort. „Und warum möchten wir, dass Menschen ‚tiefere Beziehungen‘ haben… ?“ Das führen wir so lange weiter, bis wir dahin kommen, dass Jesus Christus uns dazu berufen hat, liebevolle Gemeinschaft zu sein. Ziel ist also, liebevolle Gemeinschaft zu sein, die Hauskreise sind lediglich das Mittel, um das zu erreichen. Jetzt können wir uns damit befassen, wie wirkungsvoll dieses Mittel zur Erreichung dieses Zieles ist, und welche anderen Mittel eine gute Ergänzung sein könnten.28
Wie in den Merkmalen für vitale Gemeinden genannt, besteht das Ziel darin, als Gemeinschaft zu handeln (nicht als Organisation). Haben wir das einmal herausgearbeitet, können wir ganz kreativ und experimentell nach weiteren Mitteln suchen, die durchaus auch vorläufig sein dürfen. Wenn eine Gemeinde sich auf diese Herangehensweise einlassen kann, dann wird sie auch in der Lage sein, aus der ‚Das haben wir immer so gemacht‘-Mentalität auszubrechen. Denn wenn wir – wie in diesem Beispiel – die Hauskreise zum Ziel machen, dann besteht die Gefahr, dass wir entweder Menschen dazu zwingen, etwas gegen ihren Willen zu tun, oder aber unser Ziel aufgeben müssen. Ist das Ziel aber, liebevolle Gemeinschaft zu sein, dann können Hauskreise ihre Rolle als eines der Mittel zur Erreichung des Ziels spielen. Wir haben unser Ziel also nicht aus den Augen verloren, sondern eine Ausweitung der – potenziellen – Mittel, mit denen wir dieses Ziel erreichen können.
Was für die Hauskreise gilt, muss auch auf andere Bereiche der Gemeindearbeit angewendet werden, eingeschlossen – in besonderer Weise – die neuen Formen gemeindlichen Lebens (Fresh-X-Gemeinden). Der erste Schritt muss sein, die endgültigen und unveränderbaren Ziele festzulegen und an ihnen festzuhalten. ‚Daran festhalten‘ bedeutet auch, das Ziel klar zu artikulieren. Das wiederum gibt uns viel Freiheit kreativ mit den Mitteln umzugehen. Wenn uns die Mittel dem Ziel nicht näher bringen, dann ändern wir nicht etwa das Ziel, sondern die Mittel. Wir müssen das Ziel nicht ändern, wir müssen nur nach anderen Mitteln suchen, um es zu erreichen.
Eine Gemeinde stellte fest, dass es in einer großen, das halbe Gemeindegebiet umfassenden Siedlung kein einziges Gemeindeglied gab. Das sollte sich ändern und man startete eine Gemeindepflanzung inmitten der Siedlung. Einige Jahre später wurde das Projekt beendet, weil kein einziger Mensch den Weg in die Gottesdienstgemeinde gefunden hatte. Ein weiser Entschluss. Dann stand plötzlich ein leeres Gebäude in der Siedlung zur Verfügung und man begann, dort Angebote für junge Menschen, Eltern mit Kleinkindern und Senioren zu machen. Daraus entstand eine Gruppe, die sich einmal in der Woche zum Beten traf und sich gegenseitig unterstützte. Ganz unbemerkt und ungeplant war eine ‚Gemeindepflanzung‘ in der Siedlung entstanden – durch ein Mittel, das sie erst als solches erkannten, als das Ziel bereits erreicht war.29
Von Diözesen kommt in solchen Situationen oft keine Hilfe, weil sie zu sehr als Organisation denken. So hält es eine Reihe von Diözesen für gut, in jeder Gemeinde ein ‚Leitungsteam‘ bestehend aus Pfarrerinnen, Pfarrern und Laien zu haben, die sich die Gemeindeverantwortung teilen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber damit einhergehend werden Strukturen eingeführt, denen sich jede Gemeinde unterzuordnen hat. So wird die Zwangsjacke zum Ziel. Wie viel besser wäre es, wenn das Prinzip der geteilten Verantwortung zum Ziel erklärt würde und dann jede Gemeinde kreativ Mittel für die Umsetzung in ihrem eigenen Kontext suchen könnte. Ganz sicher entstünden dabei originelle Lösungsansätze, auf die die Diözese nicht gekommen wäre, die aber für eine Reihe von Gemeinden gut passen könnten. Für David war die Steinschleuder ein viel besseres Mittel zum Ziel, als es die Rüstung von Saul gewesen wäre.
Entscheidend ist also, das Ziel klar zu formulieren und nicht aus den Augen zu verlieren, aber flexibel, aufrichtig und kreativ nach Mitteln zu suchen, um es zu erreichen. Das Ziel hat Bezug zu einer der drei im vorherigen Kapitel erarbeiteten Dimensionen (‚Hinauf‘, ‚Hinein‘ und ‚Hinaus‘) vitaler Gemeinden und wird die Prioritäten auf hilfreiche Weise verstärken, ja sogar verkörpern.
Gottes Agenda, Gaben und Timing aus dem Blick verlieren
Eine vitale Gemeinde zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie ,herausfindet, was Gott heute will‘.30
In einem solchen Fall sind Ziele und Prioritäten im Einklang mit dem Glauben. Jederzeit im Blick sein muss allerdings die Gefahr, in säkulares Denken abzugleiten. Und es ist auf allen Ebenen in Kirche und Gemeinde nötig, Silodenken durch theologisches Denken oder Denken aus christlicher Perspektive zu ersetzen.
Fünftes Merkmal einer vitalen Gemeinde: Wir handeln als Gemeinschaft.
Eine Diözese entsandte einen neuen Pfarrer in eine Gemeinde, deren Leitungsteam ziemlich gespalten und dysfunktional war. Er sollte es wieder zu einer Einheit formen. Sein erster Schritt bestand daraus, für das Team zu beten. Als Nächstes versuchte er, mit sanften Argumenten zu überzeugen. Beides schien wenig zu bewirken. Dann zog innerhalb weniger Monate ein Teammitglied weg und ein anderes erlebte nach gemeinsamen Einkehrtagen einen Herzenswandel. Was zunächst schien wie eine unlösbare Aufgabe, veränderte sich plötzlich durch den Einfluss der Gnade Gottes. Der neue Pfarrer hat den Prozess unterstützt durch Gebet, Geduld und die Suche nach Gottes Handeln.
Eine Gruppe von Laien in einer Gemeinde machte sich große Sorgen um ihren schwer kranken Pfarrer. Über den Gemeindevorstand ließen sie ihn fragen, ob er nicht aus gesundheitlichen Gründen früher in Rente gehen wolle. Das lehnte er ab mit der Begründung, sich den so entstehenden Verlust an Rentengeld nicht leisten zu können. Die Gruppe überlegte, wie sie damit umgehen könnte, und kam zu dem Schluss, dass sie nichts weiter tun konnte, als den Pfarrer während seiner letzten Jahre im Amt liebevoll zu unterstützen. Das taten sie, obwohl die Gemeinde immer weiter zerfiel. Als der Pfarrer schließlich in Rente ging, kam ein neuer Pfarrer und die Gemeinde fing schnell an zu wachsen. Auf die Frage, warum das so sei, antwortete die Gruppe: „Das liegt an dem neuen Pfarrer.“ Der Pfarrer dagegen antwortete auf dieselbe Frage: „Das liegt an dieser kleinen Gruppe von Gemeindemitgliedern (von denen keiner ein Amt in der Gemeinde hat), die durch ihr Gebet und Handeln wie der Sauerteig im Brot eine Atmosphäre der Liebe geschaffen haben, eine liebevolle Gemeinschaft.“ Er fasste es so zusammen: „Die Gemeinde hat einfach vergessen damit aufzuhören, ihren Pfarrer zu lieben!“
„Wachet und betet!“, so lautet das Gebot Christi. Es öffnet uns und unsere ganze Situation für die Gnade und die Überraschungen Gottes. Deshalb ist sein Joch sanft und seine Last ist leicht. Das sollten noch mehr Gemeinden ausprobieren!
Trägheit
Es gibt noch ein drittes Hindernis auf dem Weg zu einer vitalen Gemeinde: Die Trägheit von Pfarrerinnen, Pfarrern, Laien und ganzen kirchlichen Systemen, die manchmal die Oberhand gewinnt. Es ist so viel leichter, sich mit dem zufriedenzugeben, was schon ist, was vertraut ist, ‚was wir hier schon immer so gemacht haben‘, dass der Weg heraus oder nach vorne geradezu unmöglich scheint. Sowohl physikalisch als auch geistlich gesehen stimmt es, dass man mehr Energie braucht, um einen statischen Gegenstand in Bewegung zu versetzen als einen, der schon in Bewegung ist.
Die Motive von Hauptamtliche und Laien sind dieselben: Wir möchten die Menschen in der Gemeinde nicht ‚verärgern‘, keine ‚Unruhe bringen‘; Jesus allerdings war an diesem Punkt wesentlich weniger zimperlich, als wir es in unserer modernen Zeit sind.
Hier, wie immer und überall, müssen wir zuerst erkennen, wo wir stehen. Sowohl für uns als Einzelne wie auch als Gemeinschaft besteht der wichtigste Schritt zur Überwindung von Problemen darin, sie als solche einzugestehen und beim Namen zu nennen. Haben wir diese Hürde einmal genommen, muss der nächste Schritt darin bestehen, Mitstreiter zu finden. Und ansonsten hilft es zu beten und Ausschau zu halten nach Zeichen der Lebendigkeit und Bewegung, und dort zu ermutigen. Der Weg kann einsam sein und schwer, aber er ist häufig der einzige, der eine Gemeinde aus ihrer Trägheit zum Leben erweckt. Die Dynamik im Herzen unseres Glaubens – der Tod und die Auferstehung – kann hier befreiende Nachricht sein. Denn genau dann, wenn alles besonders dunkel scheint, leuchtet Gottes Gnade umso heller und bringt das Leben dorthin, wo anscheinend der Tod herrscht.
Fazit
Der erste Schritt auf dem Weg zu einer vitalen Gemeinde besteht demnach häufig darin, der Tatsache ins Gesicht zu sehen, wie sehr sie von der Tyrannei des Dringlichen, von der falschen Sicht auf die Dinge oder von reiner Trägheit bestimmt ist. Bezogen auf die Merkmale vitaler Gemeinden, kommt man wahrscheinlich zu dem Punkt, dass Veränderung und Wachstum ihren Preis haben. Das beim Namen zu nennen, führt meistens dazu, dass man am Ende Geschichten erzählen kann von Gottes Gnade und Überraschungen.
Genau dieser Prozess führt uns in eine Beziehung zu Gott in den Dimensionen des ‚Hinauf‘, ‚Hinein‘ und ‚Hinaus‘ des christlichen Lebens und des Lebens überhaupt. In diesem Sinne entspricht das Ziel dem Weg. Wer sich entscheidet, auszubrechen aus den Begrenzungen, der erlebt, wie Menschen und Gemeinden zu ganzheitlichen Menschen und Gemeinschaften werden, in denen sich die Gnade Gottes widerspiegelt und die tiefere Ebenen der Erfüllung entdecken in ihrem Dienst an Gott – einem Dienst, der zutiefst frei macht.
Wenn wir uns auf diesen Weg begeben wollen, dann brauchen wir als Rückhalt die Schätze unseres Erbes. Sie sollen im nächsten Kapitel Thema sein.
Mit Gott in Verbindung treten 2: Wahrnehmen
Am besten können die in diesem Kapitel beschriebenen Hindernisse überwunden werden, wenn die Gemeinde weiß, wie sie Gottes Willen erkennen und verstehen kann. Die ‚Liturgie der Wahrnehmung‘ ist ein gutes Mittel und es ist hilfreich, die Gemeindemitglieder mit ihr vertraut zu machen. Runcorn schlägt unter Bezug auf Mark Yaconelli31 folgende Schritte vor, die gut geeignet sind für Leitungsteams und Besprechungen in der Gemeinde.
– Zu Beginn steht ein einfaches ‚Anfangsritual‘ mit der Bitte um Segen für die Sitzung und einem kurzen Gebet.
– Es folgt eine ‚Beziehungszeit‘, in der jede Person kurz auf die Frage „Wie geht es dir?“ antwortet.
– Nachdem man aufeinander gehört hat, folgt eine Zeit der Stille, in der die Aufmerksamkeit auf Gott und seine Gegenwart gelenkt wird.
– Die Beschäftigung mit den Themen der Sitzung geschieht nun in einem anderen Geist. Entscheidend ist, dass die Gemeinschaft Zeit braucht, um einander und Gott wahrzunehmen, wenn sie erkennen will, wohin der Weg weitergehen soll. Normalerweise ist das ‚Anfangsgebet‘ wie ein christlicher Reflex ohne Einfluss auf das, was in der Besprechung Thema ist. Bei diesem Modell erfolgt die Arbeit an den Themen im Gebet. Eine Pfarrerin erzählt, wie Yaconellis einfaches Schema die Atmosphäre und Effektivität ihrer Gemeindeleitungssitzungen entscheidend verändert hat.32
Für Gruppen von sechs oder weniger Personen ist diese ‚Liturgie‘ außerordentlich hilfreich. Für größere Gruppen muss sie jedoch angepasst werden, denn bei einer Gemeindeleitung mit dreißig Mitgliedern nehmen zwei Minuten pro Person bei der Frage „Wie geht es dir?“ bereits eine ganze Stunde in Anspruch. Manchmal muss deshalb ein Element weggelassen werden. Kreativer ist, diesen Teil der Liturgie in Kleingruppen von je drei Personen durchzuführen.33 Im Laufe der Zeit entstehen so Beziehungen, die über das gemeinsame Arbeiten hinausgehen. Wenn in Kleingruppen gearbeitet wird, muss jemand ‚den Hut aufhaben‘ und signalisieren, wenn die jeweils zwei Minuten um sind, damit der Prozess nicht zu lange dauert.
Trotz der Schwierigkeit bei größeren Gruppen hilft die Praxis einer solchen Übung einer Gruppe dabei, Beziehungen miteinander und zu Gott aufzubauen und auf diese Weise im Blick zu behalten, ‚worum es im Kern geht‘.
Weitere praktische Beispiele finden Sie in Teil 3: Ressourcen, ‚Einleitung‘, S. 175–177, und in ‚Arbeitsmaterial‘, S. 179–181.
18 Matthew Fox, Creation Spirituality: Liberating Gifts for the Peoples of the Earth, HarperSanFrancisco, 1991, S. 74.
19 David Runcorn, Spirituality Workbook, SPCK, 2006.
20 Warren, Vitale Gemeinde, S. 59–64.
21 Eines der (oder besser alle) vier der im Ressourcenteil empfohlenen Bücher zum Thema Mission bringen verschiedene Handlungsmöglichkeiten ins Spiel und können, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg gemeinsam gelesen werden, den Blick einer Gruppe oder Gemeinde verändern.
22 Siehe Stephen Cottrell, Do Nothing to Change Your Life, Church House Publishing, 2009.
23 Näheres hierzu siehe Kapitel 10.
24 Siehe „Ressourcen für Leitende“, „Missionarische Handlungspläne optimal nutzen“, S. 249.
25 Runcorn, The Road to Growth LessTravelled, S. 3.
26 Michael Fullan, Change Forces, The Falmer Press, 1993, S. 49.
27 Warren, Vitale Gemeinde, S. 103 ff. und 143 ff.
28 Zu diesem Thema siehe auch Kapitel 7.
29 Siehe nächster Abschnitt, „Gottes Agenda, Gaben und Timing aus dem Blick verlieren“.
30 Warren, Vitale Gemeinde, S. 41 ff.
31 Mark Yaconelli, Contemplative Youth Ministry, SPCK, 2006; Kapitel 10, ‘The Liturgy of Discernment’. Dort finden Sie dieses Modell genauer beschrieben.
32 In: Runcorn, The Road to Growth Less Travelled, S. 23–24.
33 Wenn eine Gruppe wie die Gemeindeleitung nicht daran gewöhnt ist, in Klein- oder Murmelgruppen zu arbeiten, oder normalerweise eine Gebetsgemeinschaft an den Anfang stellt, dann muss das Modell langsam eingeführt werden. Auch kann es sein, dass der Ansatz auf Einkehrtagen gut funktioniert, nicht aber bei den normalen Sitzungen. Die Teilnehmenden müssen mit einfachen Schritten an die Praxis herangeführt werden. Die Arbeit in Dreier- oder Murmelgruppen könnte zum Beispiel geübt werden, wenn größere Themen besprochen werden müssen oder ein Bericht vorgestellt wurde. Dann können in Kleingruppen wichtige Punkte oder Fragen herausgearbeitet werden. Wenn jede Gruppe nur einen zusammenfassenden Satz in die große Runde gibt, muss dies nicht mehr als zehn Minuten dauern. Als Übung für das Gebet kann die Gemeindeleitung gebeten werden, für all diejenigen in der Gemeinde zu beten, die Leitungsverantwortung haben. Nach einem Eröffnungsgebet oder einer Zeit der Stille könnten die Namen und Aufgabenbereiche genannt werden, für die sie beten wollen. Diese einfachen Schritte können als Vorbereitung auf die komplette Liturgie der Unterscheidung dienen.