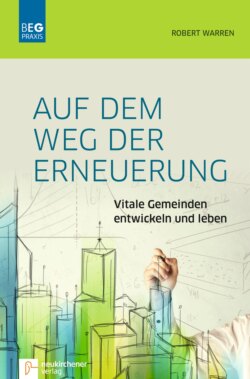Читать книгу Auf dem Weg der Erneuerung - Robert Warren - Страница 13
ОглавлениеKapitel 3 – Reichtum an Ressourcen
Die christliche Kirche hat es nicht leicht in der heutigen Zeit. Der Gottesdienstbesuch in der westlichen Welt geht allgemein zurück, der Altersdurchschnitt steigt, das Geld wird knapper und Pfarrerinnen und Pfarrer sind immer dünner gesät, manche von ihnen müssen 15 Gemeinden gleichzeitig betreuen. Ein Dekanat, das ich kürzlich besuchte, bestand in den 1920er-Jahren aus 29 Gemeinden, die von 23 hauptamtlichen Pfarrern betreut wurden. Heute ist die Zahl der Gemeinden auf 23 gesunken und die Anzahl der hauptamtlichen Pfarrer auf eineinhalb. Schwere Zeiten!
Aber die christliche Kirche hat bis ins 21. Jahrhundert durchgehalten, wenn auch nicht überall und nicht alle institutionellen Ausdrucksformen des Glaubens.
In ihrem Buch Journeying Out erzählt Ann Morisy ihre Geschichte mit einer Delegation russischer Geistlicher, die in der Diözese London zu Besuch waren. Sie begann ihre Ansprache mit der Feststellung, dass sie für eine Organisation arbeitet, die im Jahr 604 gegründet wurde. Der Dolmetscher bat um Wiederholung, so als ob er die Zahl nicht richtig verstanden hätte. Aber die Zahl stimmte – eine Erinnerung daran, dass die Kirche überlebt hat, trotz Krisen und erstaunlicher Höhen und Tiefen. G.K. Chesterton sagt dazu:
„Fünf Mal in der Geschichte Europas drohte die Kirche vor die Hunde zu gehen; jedes Mal waren es am Ende die Hunde, die dran glauben mussten!“34
Seit meiner eigenen Ordination in den Dienst der anglikanischen Kirche 1965 hat die Church of England ihre Liturgie zwei Mal revidiert, nach 400 Jahren ohne eine einzige Veränderung. Sie hat angefangen, Frauen zu ordinieren und wird sie in Kürze auch zu Bischöfinnen weihen. Sie hat Gemeindepflanzungen und FreshX-Gemeinden integriert, ein synodales Entscheidungssystem eingeführt und eine Reihe weiterer signifikanter Änderungen vorgenommen.
Selbstgefälligkeit können wir uns nicht leisten, das ist sicher richtig. Das wäre der eine Faktor, der uns das gleiche Schicksal bescheren könnte wie Chestertons Hunden. Aber wir brauchen auch nicht in Panik zu geraten. Die Kirche hat schon so viele Krisen nationaler und kirchlicher Art überlebt.
Siebtes Merkmal vitaler Gemeinden: Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche.
Zu meiner Ordination benutzte die Kirche noch die Ordinationsliturgie aus dem Prayer Book Ordinal. Ein Satz ist mir all die Jahre im Gedächtnis geblieben, nämlich die Aufforderung, ‚alle Bemühungen auf diesen Weg zu richten‘. Gemeint ist, dass wir uns mit unserem ureigensten Erbe beschäftigen und daraus Schätze und Ressourcen heben sollen, die wir weitergeben können an die uns anvertrauten Menschen. Aber nicht nur Ordinierte sollen sich damit beschäftigen. Es steht jedem offen, zu lesen und zu lernen, um dieses Erbe besser zu begreifen und sowohl in alltägliche Gespräche einbringen zu können als auch in jegliche Aufgabe in der Gemeinde. Die Auseinandersetzung mit dem kirchlichen Erbe hat tatsächlich eine missionarische Dimension, denn unsere Welt sehnt sich nicht nur nach ‚aufregenden‘ Menschen oder ‚aufregenden Gemeinden‘, sondern auch nach ‚Menschen mit Tiefgang‘, deren Reichtum an Wissen aus den Tiefen eines anderen Zeitalters kommt als unserem eigenen. Was wir brauchen, sind ‚tiefgehend aufregende Gemeinden‘.
Reiches Erbe – biblische Wurzeln
Von den frühesten Tagen an errichteten die Patriarchen Altäre entlang ihrer Wege, um die Orte ihrer Gottesbegegnungen zu markieren und immer wieder an diese Momente der Begegnung und Enthüllung erinnert zu werden; die Idee kam wohl von Gott selbst, der Noah den Regenbogen schenkte als regelmäßige Erinnerung an seine Gnade.
Am Berg Sinai bekam Mose Feste und Rituale an die Hand, mit deren Hilfe an die großen Augenblicke der Offenbarung erinnert werden konnte; dort liegen die Wurzeln des Passahfestes (die Passion Christi), des Laubhüttenfestes (Pfingsten) und des Sabbats.
Unter Salomo entstanden Gebäude, insbesondere der Tempel, in denen der Glaube gelehrt werden konnte, und es wurden Erinnerungsfeste etabliert und gefeiert, wie etwa das Passahfest und das Versöhnungsfest.
Das Neue Testament fokussiert sich auf das Herz als den Ort, an dem die Erinnerung ihren Platz hat. So schenkt Jesus uns das Vaterunser, das sowohl Rahmen als auch Muster für unsere Gebete sein soll. Es ist außerdem eine wunderbare Zusammenfassung seiner gesamten Lehre über Gott als Vater und über das kommende Reich Gottes, genauso wie es auf einfache Weise immer wieder daran erinnert, wie ein Leben als Christ für die Jüngerinnen und Jünger Jesu aussehen soll.
Im Zeitalter des Heiligen Geistes soll der Verstand dafür sorgen, dass wir uns an den ‚von den Heiligen überlieferten Glauben‘ halten. Den Jüngerinnen und Jüngern wird versprochen, dass der Geist ihnen sagen wird, was sie brauchen, und ihnen ‚im richtigen Moment‘ Einblicke schenkt. Dieser Phase verdanken wir die wunderbare Erinnerung des Abendmahls (= der Eucharistie): ‚die Erinnerung an Christus, unsern Herrn.‘ Obwohl das Werk des Geistes immer ‚im richtigen Moment‘ erfolgt, hat er das Volk Gottes dazu gebracht, für Schlüsselerinnerungen des Reichtums Gottes bei der ursprünglichen Sprache zu bleiben. Dazu gehören das Amen, Halleluja, Eucharistie und Maranatha (Komm, oh Herr). Außerdem gibt es eine Vielzahl von Texten, die lehren, dass man die Dankbarkeit für die Güte Gottes einüben muss.
Texte zum Thema: Deuteronomium (5. Mose) 8; Matthäus 6,19-21; Lukas 3,21-22; Philipper 4,4-9.
Wir müssen darüber nachdenken, was Kirche und Christen über die Jahrhunderte hinweg aufrechterhalten haben, um es für unser Wohlergehen und das Zeugnis der Kirche zu nutzen.
„Wir müssen uns auf unsere religiöse Tradition einlassen, denn sie ist der Kompass, der uns fähig macht, in dieser Welt unterwegs zu sein.“35
Ein solcher Umgang befreit uns aus unserer ‚Mangel-Haltung‘ zu einer ‚Fülle-Haltung‘, die so offensichtlich ist im Leben und Lehren Jesu. Wir verfügen über reiche Ressourcen zur Erhaltung und Erneuerung der Kirche, aber wir müssen sie als solche wahrnehmen und uns ihrer bedienen für die Zeiten, die auf uns zukommen und die wir noch nicht einschätzen können. Dieses Kapitel soll unsere Aufmerksamkeit auf diese Reichtümer lenken. Alle, die sich in der Kirche engagieren, sollen ermutigt werden, sie zu respektieren, sie wertzuschätzen, damit vertraut zu werden und sich all dessen zu bedienen, von dem wir hier nur einen kleinen Teil behandeln können.
Unser geistliches Erbe
Bei der Suche nach Erneuerung der geistlichen Lebendigkeit von Gemeindemitgliedern und Gemeinden sind wir nicht beschränkt auf die Erfahrungen aus der heutigen Zeit; uns stehen 2000 Jahre Gebet und geistliche Disziplinen zur Verfügung, auf die wir zurückgreifen können. Die monastischen Traditionen kommen aus einer völlig anderen Kultur, und doch ist es genau diese Andersartigkeit, die heute für uns relevant ist und uns Einblicke ermöglicht, die eine auf das ‚Heute‘ beschränkte geistliche Suche sehr seicht wirken lassen.36 Das gilt besonders dort, wo die moderne Suche nach Spiritualität an fehlenden Wurzeln (und manchmal auch an fehlenden Skrupeln) leidet und einfach nur vermarktet, was ‚neu‘ ist. Es ist wunderbar, auf etwas mit Bestand zurückzugreifen, statt sich mit Brandneuem zu begnügen.37 Beispielsweise die Schriften von Juliana von Norwich und dem Heiligen Ignatius von Loyola zeigen den Reichtum in der Begegnung mit Gott und bleiben über die Jahrhunderte hinweg aktuell.
Wenn wir uns mit dem geistlichen Erbe der Vergangenheit befassen, dann begegnen wir Gott wahrscheinlich in der Stille, im Leid und in der Aufopferung – alles keine modernen Merkmale. Sich mit diesen Aspekten der Erkenntnis Gottes zu befassen, wird unser Leben bereichern und den Ausdruck tiefer Menschlichkeit vertiefen, der uns durch die Begegnung mit Gott zuteil geworden ist.
In erster Linie ist es wohl Aufgabe der ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrer, die Ressourcen zu kennen, und zwar nicht auf intellektueller Ebene, sondern als Teil des eigenen geistlichen Lebens. Nur wenn dies der Fall ist, können wir sie auf kreative Weise denen zugänglich machen, für die wir da sind. Natürlich sind Gemeindemitglieder nicht auf das Angebot der lokalen Kirchengemeinde beschränkt. Literatur, Einkehrtage, Konferenzen und geistliche Begleiter sind Ressourcen der Kirche als Ganzer, zu denen alle Zugang haben. Für uns Pfarrerinnen und Pfarrer ist das wichtigste Element unser Gebet und unser geistliches Leben. Zusätzlich ist es hilfreich, sich Unterstützung bei der Beschäftigung mit diesen Reichtümern zu holen, am besten gemeinsam mit anderen aus den Kirchengemeinden vor Ort.
Tatsächlich ist die Kirche, was den zentralen Bereich geistlicher Ressourcen angeht, sehr kapitalkräftig und nicht arm. Aber wir müssen uns darum bemühen, diese Reichtümer auch zu nutzen, nicht nur für uns selbst innerhalb der Kirche, sondern für die gesamte Gesellschaft. Diese Ressourcen sind Nahrung für unsere Erkenntnis Gottes. Wir rufen uns noch einmal Peter Rollins ins Gedächtnis:
„Wir müssen uns auf unsere religiöse Tradition einlassen, denn sie ist der Kompass, der uns fähig macht, in dieser Welt unterwegs zu sein.“38
Kirchengeschichte
Das Chesterton-Zitat über die Kirche, die anscheinend vor die Hunde geht, ist Erinnerung daran, dass ‚wir schon vorher da waren‘. Nicht unsere Generation, aber vorherige Generationen. Und es war auch nicht alles das Gleiche, aber gekämpft hat die Kirche genauso wie heute. Man muss nur an den ersten Angriff der Wikinger denken und wie die Kirche darauf reagierte, dass sie das reiche Kloster Lindisfarne, in der damaligen Zeit das Herz der christlichen Kirche in England, verwüsteten und ihr Erbe zerstörten.39 Die Kirche ging daran weder zugrunde noch gab sie auf. Sie erlebte vielmehr eine unter Anstrengung erkämpfte Auferstehung und überlebte, wenn auch klein und schwach, die militärische Macht ihrer Unterdrücker wie in Deutschland die Bekennende Kirche unter den Nationalsozialisten.
Mein Dienst war von Anfang an wesentlich inspiriert von der frühen Kirche, die in den ersten drei Jahrhunderten unfassbar opferbereit im Namen Jesu Christi all denen diente, die bedürftig waren. De facto übernahm sie mit diesem Engagement das Sozialwesen des gesamten Römischen Reiches. Später hat meine Beschäftigung mit den großen Glaubensbekenntnissen dieser Jahrhunderte mein Denken darüber geformt, wie wir heute Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern Jesu machen können. Es hat tatsächlich dazu geführt, dass ich mit vier weiteren Autoren gemeinsam das Material für die Emmaus-Glaubenskurse entwickelt habe.40 Eine weitere Geschichte erzählt der tiefgreifende Einfluss John Wesleys auf die englische Kultur: die soziale Wirkung des frühen Methodismus in diesem Land.41
Liturgie, Wort und Sakrament
Enorme Reichtümer liegen auch in den Liturgien der Kirche verborgen, manchmal tief vergraben. Die anglikanische Kirche verfügte nicht über einen ‚Katechismus‘ wie ihn einige aus der Reformation hervorgegangene Kirchen haben. Bei ihr ist der Glaube sozusagen in der Liturgie verankert und basiert auf dem Prinzip des ‚lex orandi, lex credendi – Das Gesetz des Glaubens ist das Gesetz des Betens‘. Der große Theologe Karl Barth hat in einem Kommentar zu diesem Prinzip gesagt, dass es „wahrscheinlich das Intelligenteste ist, was je zum Thema Gottesdienst gesagt wurde“. Als Konsequenz aus diesem Prinzip hat die Kirche immer sehr sorgfältig sowohl auf die Struktur ihrer Gottesdienste als auch auf die gesprochenen und gesungenen Worte geachtet.
Erstes Merkmal einer vitalen Gemeinde: Sie bezieht Kraft und Orientierung aus dem Glauben an Jesus Christus.
In der heutigen, mehr informellen Kultur besteht allerdings die Tendenz, Liturgie auf ein Minimum zu beschränken und sich so ihrer Reichtümer zu berauben. Gleichzeitig entstehen immer mehr ‚säkulare Liturgien‘, sichtbar zum Beispiel in den ‚Schreinen‘, die dort auftauchen, wo Menschen gestorben sind, in der Ehrung gefallener Soldaten, ursprünglich ganz spontan eingeführt von den Einwohnern von Royal Wootton Bassett42, und in der Schweigeminute zu Schlüsselmomenten des gesellschaftlichen Lebens. Es gibt eine neue Sehnsucht nach Ritualen, die zum Ausdruck bringen, was uns verbindet.43 Auch der ansteigende Gottesdienstbesuch während der Weihnachtszeit ist vielleicht ein Resultat dieser Suche nach Sinn und Wurzeln.44 Das Christentum hat wunderbare Ressourcen zu bieten, die bei dieser Suche Hilfe, Form und Erfüllung bieten. Es ist so wichtig, diesen Reichtum nicht zu banalisieren.45
Wir müssen uns bewusst machen, dass es ein wichtiges Zusammenspiel von Liturgie und Freiheit gibt. Ist man zu fixiert auf die Durchführung der Liturgie, kann es passieren, dass die Liturgie wichtiger wird als der Eine, den wir damit loben und preisen wollen (ein Beispiel für die Vermischung von ‚Mittel‘ und ‚Ziel‘). Aber auch ein zu lockerer Umgang kann den Gottesdienst in ein zweidimensionales Treffen verwandeln, statt dreidimensionale Begegnung mit Gott zu sein.
In einer informellen Kultur kann es nicht überraschen, dass unser Umgang mit Gottesdiensten entspannter und weniger formal ist. Das ist einerseits gut. Aber uns geht so auch allzu leicht das Staunen, die Ehrfurcht und die übernatürliche Wirklichkeit verloren, die oft Instrument der Gnade sind, nicht zuletzt für diejenigen, die bisher keine Verbindung zum Glauben hatten. Es ist mehr das Gefühl der Gegenwart Gottes als die Relevanz der Sprache, die den Menschen ins Herz spricht. Wege zu finden, mit dem Geheimnis Gottes in Berührung zu kommen, mit dem Wunder seiner Offenbarung und der transzendenten Dimension von Gottesdienst, wird nicht nur den Glauben derer stärken, die bereits auf dem Weg sind, sondern Glauben in denen wecken, die nicht einmal darum wussten, dass er in ihnen schlummert. Das zu verlieren, ist ein Risiko für uns und für sie. Wohlgemerkt, hier soll nicht der traditionelle Gottesdienst über die FreshX-Gemeinden gestellt werden. Die Herausforderung für alle Formen von Gottesdienst (und für Gottesdienstleitende und -teilnehmende gleichermaßen) liegt darin, zu entdecken, wie „die Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes“ (Römer 11,33) bereichert werden kann durch unsere Tradition und gleichzeitig kreative, zeitgemäße Ausdrucksformen findet.
Hier sollten wir die Warnung von David Runcorn beherzigen:
„Unter dem Druck, immer und sofort verfügbar zu sein, meinen wir, wir müssten alles, was veraltet, nicht unmittelbar verständlich oder vermeintlich irrelevant scheint, über Bord werfen. Alles wird bemessen nach seinem Nutzen. Darin liegt die Gefahr, die Vorgaben der uns umgebenen Kultur lediglich zu spiegeln, statt sie herauszufordern. Wir verlieren die Qualität, die unser Zeitalter so dringend braucht – Tiefgang. Ohne Tiefgang werden wir am Ende unsere hart erarbeiteten Reserven an Weisheit und Glauben auf dem Altar der „Relevanz“ opfern und einer ruhelosen, wurzellosen Gesellschaft ruhelose und wurzellose Kirche sein.“46
Zusammengefasst müssen wir den Reichtum der kirchlichen Liturgie und die grundlegende Rolle von Wort und Sakrament als Teil von ihr wertschätzen, ausschöpfen und nutzen, um kirchliches Leben zu bereichern und zu erhalten. Dabei gehen wir zu leicht davon aus, dass Gottesdienstbesucher dies alles verstehen. Tatsache aber ist, dass regelmäßige Gottesdienstbesucher Hilfe brauchen, weil alles zu vertraut ist und sie vergessen haben, worum es eigentlich geht. All jene, die neu sind und das reiche Erbe der Kirche noch nicht gut kennen, brauchen in unserer zwanglosen Kultur Hilfe, um die fundamentale Bedeutung des Wortes ‚Liturgie‘ (‚Dienst des Volkes‘) zu entdecken und in seinen Reichtum einzutauchen.
Menschen
Canon David Watson, de facto Initiator der charismatischen Erneuerungsbewegung in der anglikanischen Kirche und darüber hinaus, zitierte in den 1970er Jahren gerne folgenden Liedvers:
„Im Himmel zu leben mit Heiligen, die wir lieben, ist wunderbares Glücksgefühl; hier unten, tjaaah, mit Heiligen hautnah, das ist wohl eher – anders.“
Wir wissen alle um Freude und Leid von Leben, Arbeit und Beziehungen zu anderen, nicht zuletzt auch im Gemeindekontext. Ein Zitat, das ich schon in anderen Büchern gerne zitiert habe, entspricht hier genau meinen Erfahrungen.
„Eine für unser Leben charakteristische Form der Unaufrichtigkeit, die die Liebe zueinander in Ehe und Gemeinden zerstört, ist unsere Nettigkeit. Weil wir so nett sind, glauben wir, anderen damit helfen zu können, wenn wir bei Meinungsverschiedenheiten niemals unsere wahren Gedanken und Gefühle aussprechen … Wo wir anderer Meinung sind, brauchen wir die direkte Reibung mit dem anderen, nicht das typische ‚Hintenherum‘, das normalerweise beide Seiten bitter macht.“47
Sechstes Merkmal einer vitalen Gemeinde: Wir schaffen Raum für alle.
Wichtig sowohl für Pfarrerinnen und Pfarrer als auch für Laien ist die Anerkennung der Tatsache, dass eine der größten Ressourcen unserer Kirche die Menschen sind. Das muss das Handeln bestimmen und dazu führen, dass sie und ihre Beziehungen gepflegt werden. Die Menschen sind für die Kirche das, was Nahrungsmittel für den Supermarkt und Benzin für Mineralölgesellschaften und Tankstellen sind. Wichtigste (wenn nicht sogar einzige) Aufgabe von Kirche ist deshalb, für ‚qualitativ hochwertige Ware‘ zu sorgen.
Manchmal kommen Menschen wie ein Geschenk vom Himmel, zum Beispiel, wenn jemand neu zur Gemeinde oder zum Glauben kommt und ‚genau das ist, was wir hier gebraucht haben‘. Manchmal wachsen sie über einen langen Zeitraum immer mehr in die eigene Persönlichkeit und ihre Rolle hinein, mit vielen Höhen und Tiefen im Auf und Ab der Gnade in ihrem Leben. Doch jede und jeder (glaubend oder nicht glaubend) ist gemacht nach dem Bild Gottes. Wie leicht vergessen wir, dass uns dieses Wunder an vitaler Ressource – die Menschen - zur Verfügung steht, weil die Anforderungen und Erwartungen eines zu vollen Gemeindeprogramms uns blind machen für eine solche Einsicht.
Aufgabe von Kirche ist, Menschen zum Wachstum zu verhelfen: Sie sollen hineinwachsen in eine immer größere Ähnlichkeit mit der Menschlichkeit Jesu Christi. „Erlösung ist im Wesentlichen die Wiederherstellung der Menschlichkeit im Menschen.“48 Das Höchste, was wir Gemeindemitgliedern geben können, ist, sie als Menschen und ganze Glaubensgemeinschaften zu fördern, und zwar so, dass sie in die Ganzheitlichkeit des Lebens hineinwachsen, die uns durch die Begegnung mit Gott in Jesus Christus gegeben ist; es ist auch der beste Weg, um Glauben auf inkarnatorische Art und Weise zu verkünden. Das ist meine über Jahre gewachsene feste, feste Überzeugung. Kurz gesagt: Gemeinden wachsen dann am besten, wenn sie ihren Schwerpunkt darauf legen, Menschen ganz und gar zum Wachstum ihrer Menschlichkeit zu verhelfen.
Wenn das geschieht, dann wird eine solche Kreativität und sich selbst hingebende Liebe freigesetzt, dass jegliche Aufopferung völlig bedeutungslos wird, verglichen mit der Freude darüber, dass die Worte des heiligen Irenaeus wahr werden. Er hat vor langer Zeit, im 2. Jahrhundert nach Christus, gesagt: „Herrlichkeit Gottes ist ein Mensch, der ganz Mensch ist.“
Natürlich gibt es noch die „große Wolke von Zeugen“, die uns auf unserem Glaubensweg unterstützt, besonders die Heiligen aus längst vergangenen Zeiten. Aus ihren Lebensgeschichten und ihrer Beziehung zu Gott können wir unendlich viel Erkenntnis und Inspiration gewinnen und ein Vorbild in ihnen finden. Für das Zeugnis der Kirche von heute kann es eine große Bereicherung sein, von ihnen zu lernen und über sie nachzudenken. Folgendes Beispiel erzählt von einem eher unbekannten Heiligen:
„Der Heilige Deicolus aus dem siebten Jahrhundert verließ Irland mit St. Columban und gründete eine Abtei in Lure in Frankreich, wo er als Eremit lebte. Gefragt, warum er trotz seines asketischen Lebensstils immer ein Lächeln auf den Lippen trug, antwortete er: Weil niemand mir Gott wegnehmen kann.“49
Zusammengefasst bedeutet das: Menschen sind das größte Kapital der Kirche. Wir müssen, ganz gleich welche Aufgabe wir in der Kirche haben, dieses Kapital wertschätzen, mit Ehrerbietung behandeln und pflegen, damit die Menschen die Fülle des Lebens erfahren, die in Christus möglich geworden ist.50 Dann können wir uns an den Konsequenzen freuen.
Gnade
In einer zweidimensionalen, säkularen Kultur wird die göttliche und spirituelle Dimension des Lebens leicht übersehen, selbst innerhalb der Kirche. Und doch ist die Gnade der Treibstoff, der die Kirche in Bewegung hält.
Üblicherweise kommt die Gnade zu uns durch Wort und Sakrament. Wie bei einer Rundfunksendung kommt es hier darauf an, dass die Übertragung den höchsten Standards entspricht und der Empfänger gut funktioniert. Darum ist die Aufgabe derer, die in der Gemeinde ‚vorne stehen‘, den Gottesdienst ‚zu leiten‘ und nicht einfach ‚zu halten‘. Letzteres ist ein rein funktionaler Vorgang. ‚Gottesdienst leiten‘ dagegen erinnert uns daran, dass es sich um einen geistlichen Dienst handelt, der Nahrung für den Einzelnen ist und der Gemeinschaft in Christus und durch den Heiligen Geist die Begegnung mit Gott ermöglicht.
Aber wir erleben Gnade auch oft genug durch Menschen: menschgewordene Gnade, Gnade mit Haut und Knochen. Eine Berufung zum richtigen Zeitpunkt, ein Wahrgenommen werden, ein Wort der Ermutigung, eine Bestätigung oder die richtige Herausforderung sind Wege, auf denen Gott sich uns gerne zeigt. Genauso gut können das Leid, der Mut, die Vision, der Fleiß oder andere Menschen Hinweis auf die Güte und Gegenwart Gottes sein.
Bei einer Gemeindeberatung fragte ich die Anwesenden, welches Bild ihnen in den Kopf käme, wenn sie an ihre Gemeinde dächten. Wie würden sie folgenden Satz weiterführen „Unsere Gemeinde ist wie …“? Eine der Antworten lautete: „Unsere Gemeinde ist wie eine Schubkarre. Nichts bewegt sich, wenn du nicht schiebst.“ Selbst wenn es oft diesen Eindruck macht: Der Geist Gottes ist am Werk, manchmal an ganz unerwarteten Stellen (und, um ehrlich zu sein, bei unerwarteten Leuten). Wir müssen also aufmerksam sein, um die Gegenwart Gottes genau an diesen Stellen oder in diesen Menschen zu entdecken.
Ganz am Anfang meiner ersten (und einzigen) Pfarrstelle musste die Gemeinde ein Haus kaufen für einen neuen Vikar. Das war in den 1970-er Jahren. Die Gemeindeleitung genehmigte 7000 Pfund; das würde reichen, so dachte man. Wir hatten eine bestimmte Immobilie im Blick und eines Morgens rief mich unser Rechtsanwalt an, ein Gemeindemitglied, das uns in dieser Sache begleitete. Er wollte mir sagen, dass ein höheres Angebot als unseres abgegeben worden war und wir das Haus nicht für 7000 Pfund kaufen könnten. Ihm war aber versichert worden, dass wir es für 8000 Pfund bekämen. Seine Frage: „Sind Sie bereit, diesen zusätzlichen Betrag zu genehmigen?“ Ich bat um eine halbe Stunde Zeit um zu beten und nachzudenken. Meine Knie hatten den Boden kaum berührt, da klingelte es an der Tür. Einigermaßen frustriert stand ich auf und ging zur Tür, innerlich mit Gott hadernd, warum er mich nicht vor diesem Klingeln bewahrt hatte, schließlich wollte ich gerade nach seinem Willen in dieser Angelegenheit fragen. Ich kannte die Frau nicht, die da vor meiner Tür stand, aber ich bat sie einzutreten.
Sie erzählte mir, dass ihr Mann vor sechs Monaten gestorben sei. Obwohl sie nicht in der Gemeinde wohnten und auch nie in den Gottesdienst gingen, hätte er sie kurz vor seinem Tod gebeten, mir nach seinem Tod einen Scheck für die Gemeinde zu bringen. „Es tut mir leid, dass ich erst jetzt komme“, sagte meine Besucherin, „aber irgendetwas hat mich heute Morgen dazu veranlasst, mich jetzt auf den Weg zu machen.“ Es war ein Scheck über 1000 Pfund.
„Ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören.“ (Jesaja 65,24 – Anm. d. Übers.)
Es ist so grundlegend wichtig, niemals zu vergessen, dass wir als Kirche und Gemeinde mit (einem handelnden) Gott arbeiten und nicht für (einen passiven) Gott. Es ist Gott selbst, der sich durch den richtigen Zeitpunkt und durch die richtigen Ereignisse zeigt. Manchmal geht es im Glauben um den Mut, auf Gottes Zeitpunkt und Gottes Handeln zu warten. Meiner Erfahrung nach wird mir dadurch ein Strich durch meine Rechnung im Umgang mit der Situation gemacht, aber das Ergebnis ist um ein Vielfaches reicher und fruchtbarer.
Es ist so wichtig für alle Beteiligten, im eigenen Handeln zu wissen, dass es nicht ‚unsere‘ Kirche ist, sondern schon immer die Kirche Christi war. Er ist der Einzige, der für sie gestorben ist. Er allein kann dafür sorgen, dass sie lebt und lebendig bleibt. Ich spreche immer wieder mit Gemeindeleitungen und versuche sie, wenn möglich, daran zu erinnern, dass sie sich mit Gott beraten und nach seinem Willen suchen, statt dem eigenen Willen zu folgen. Denn so öffnet sich der Kanal der Gnade Gottes.
Schwäche
Schwäche ist eine überraschende Ressource. Doch: Im Kern unseres Glaubens steht die Kreuzigung Jesu Christi – in vollkommener Schwäche –, aus der all unsere Kraft fließt. Wir müssen also nie Angst davor haben, schwach zu sein oder vermeintlich zu scheitern. In seinem Buch True Wilderness, entstanden nach einem kompletten Zusammenbruch, schrieb Harry Williams, dass wir niemals Angst haben müssten vor der Wüste, denn „was ist die Wüste anderes als Ostern in Verkleidung?“. Oder in John Holmes Worten:
„Wir hören oft von dem Geist, der seine Menschen mit Liebe und Freude und Frieden füllt. Seltener begegnet uns der Geist, der Menschen, so wie Jesus, manchmal in die Wüste führt, wo sie ihrer Schwäche, ihrem Schmerz, ihrem Scheitern ins Gesicht schauen können, statt davor davonzulaufen.“51
Heute scheint die Kirche schwach und im Niedergang begriffen. Doch gerade in der Schwachheit sind Gott und ein neuer Anfang zu finden (solange wir die Schwäche zugeben und uns damit an Gott wenden). Bei meiner Beschäftigung mit den Seligpreisungen,52 hat mich ihr Ausgangspunkt besonders bewegt: „Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich.“53 Jesus hatte eine große Affinität zu den Armen, und diese Seligpreisung hat mir gezeigt warum. Wem es gut geht, der ‚hat‘, der denkt er ‚hat es geschafft‘; die Armen aber wissen, dass sie etwas brauchen, das nicht aus ihnen selbst kommt. Die Armen sind offen für die Gnade, so wie es Jesus war, der perfekte Sohn Gottes, der sein Leben offen für und abhängig von der Gnade seines himmlischen Vaters lebte.
Ich hielt einen Vortrag bei einer Konferenz, bei der auch die Religionssoziologin Grace Davie sprach.54 Sie hat den Ausdruck ‚Glauben ohne Zugehörigkeit‘ (‚believing without belonging‘) geprägt. In ihrem Vortrag sprach sie über Dinge, die eine ‚schwache‘ Gemeinde tun kann, eine ‚starke‘ dagegen nicht. Eine starke Gemeinde, so betonte sie, steht fast automatisch auf der Seite der starken, mächtigen und dominanten Gruppen einer Gemeinschaft oder Gesellschaft. Schwache Gemeinden hingegen sind viel besser dazu in der Lage, sich an die Seite derer zu stellen, die schwach, an den Rand gedrängt und ohne Stimme sind, und mit ihnen und für sie zu sprechen. Eine schwache Gemeinde hat die bessere Ausgangsposition dafür, ihren Dienst frei von den Zwängen der Macht zu tun, in Treue gegenüber dem Leben und Dienst Christi.
Eine Gemeinde mit einem relativ typischen Altersdurchschnitt (die meisten über 50, viele schon im Rentenalter) stellte fest, dass in den vergangenen Jahren kaum neue Menschen aus dem lokalen Umfeld zur Gemeinde gestoßen waren. Sie beschloss, ihre allsonntäglichen Abendmahlsgottesdienste durch einen einmal im Monat stattfindenden Familiengottesdienst zu ergänzen.
Die Gottesdienstgemeinde selbst schien sich sehr schnell mit diesem neuen Ansatz anzufreunden, neue Gottesdienstbesucher gab es jedoch nicht.
Plötzlich kamen völlig unerwartet ein paar Teenager aus dem Ort zur Chorprobe. Sie störten sehr, was bei einigen Chorsängern zu Stress führte. Die meisten aber waren freundlich und gingen auf sie zu.
Einige Wochen später tauchten sie zu acht im Abendgottesdienst auf. Sei blieben nicht lange, aber kurze Zeit später klapperte die Kirchentür und sie kamen zurück. Sie saßen ganz still in der Bank und als sie zu einem persönlichen Segen nach vorne gebeten wurden, kamen sie alle. Die Gottesdienstliturgie war aus dem Common Prayer Book von 1662; nicht wirklich ausgerichtet auf Jugendliche des 21. Jahrhunderts. Oder doch? Waren es gerade die Sprache und die fremden Rituale, die ein Gefühl von Geheimnis und Wunder vermittelten, das sie berührte?
Bei der nächsten Chorprobe waren sie wieder da und wollten mehr. Eine Chorsängerin fragte nach: „Was würdet ihr gerne tun?“ Einer der Teenager antwortete: „Können wir einfach eine Kerze anzünden und davor beten?“ Keine Spiele, keine Programme, keine Ausflüge. Nur Gebet.
Netterweise fand sich eine kleine, mutige Gruppe von Gemeindemitgliedern, die sich der Teenager annahm. Sie hatten keinerlei Erfahrung in ‚Jugendarbeit‘ und auch keine konkreten Pläne; aber sie waren offen für die Möglichkeit, dass Gott in dieser beunruhigenden Situation anwesend war.
Ich hörte von dieser Geschichte, kurz nachdem sie angefangen hatte. Wie es weitergehen sollte, wusste in diesem Augenblick keiner. Vielleicht würde sich alles wieder in Wohlgefallen auflösen. Aber es ist so typisch für den Geist Gottes, mit seinem Handeln all unsere gut durchdachten Pläne zu durchkreuzen und uns dazu zu bringen, ihm in unserer Schwachheit zu vertrauen und zu wissen, dass Gott genau dann da sein kann. Wie großartig, dass die Gemeinde die Möglichkeit gesehen und sich für andere getraut hat, ein Ort der Schwäche zu sein. Vielleicht entdecken sie, „Wenn ich schwach bin, so bin ich stark“.55
Manchmal erleben Gemeinden Schwäche durch einen Misserfolg, sei es der Zusammenbruch der Jugendarbeit, ein Schatzmeister, der mit dem Geld wegläuft, die Unmöglichkeit, Kirche und Gemeindehaus gleichermaßen instand zu halten, oder ein langsamer, anscheinend unaufhaltsamer Niedergang. Solche Augenblicke und Zeiten öffnen uns für die Gnade Gottes und können zu wunderbaren Wendepunkten werden. Zu den größten Glaubensaussagen, die mir in meiner Arbeit begegnet sind, gehört, wenn jemand zugibt, dass ‚es nicht funktioniert‘. Genau das öffnet uns für neue Möglichkeiten, die sich vor uns versteckt halten, solange wir vorgeben, dass alles wunderbar läuft.
Fazit
Es ist wichtig festzuhalten, dass aller Reichtum unseres christlichen Erbes nur dann wirkt, wenn er praktisch angewendet wird. Der heilige Augustin nannte es Solviture ambulando – „die Lösung findet, wer unterwegs ist“. Nicht im Nachdenken, sondern in der Umsetzung ins reale Leben wird das Erbe zum Reichtum und zur Ressource. Letztendlich geht es darum, Dinge voranzutreiben und zu tun oder offen zu sein dafür. Im Glauben den nächsten Schritt tun, heißt, in die Gnade Gottes eintreten, die uns auf tausendfache Art und Weise begegnen kann. J. Neville Ward, ein methodistischer Pfarrer, sagt in einem Kommentar zum Rosenkranz: „Jede Erfahrung ist eine Art von Verkündigung.“56
Wie wir uns diesen Reichtum unseres Erbes zunutze machen können, um es für die Kirche zum Segen werden zu lassen und so zur Entwicklung des Reiches Gottes beizutragen, wird im nächsten Kapitel Thema sein.
Mit Gott in Verbindung treten 3: Hören
Teil des großen Reichtums der christlichen Tradition ist die Bibel. In ihr und durch sie spricht Gott heute zu uns. Eine alte Art und Weise, sie zu lesen und zu meditieren, nennt sich Lectio divina (wörtlich übersetzt ‚göttliches Lesen‘ oder ‚Lesen mit Gott‘). Es ist wunderbar dafür geeignet, sowohl Einzelnen als auch Gruppen bei der Beschäftigung mit der Heiligen Schrift dabei zu helfen, statt der lähmenden Diskussionen (häufig der Fall in Bibelkreisen) in ein geistliches Wahrnehmen hineinzukommen. David Foster aus dem Kloster Downside Abbey beschreibt die Methode folgendermaßen:57
Lectio divina ist eine Art des Betens, bei der wir es Gott überlassen, das Gespräch zu beginnen, statt ihn immerfort mit unseren Themen und Sorgen zu überhäufen. Wenn wir uns auf die Lectio divina einlassen, dann lassen wir Gott Zeit und Raum, damit er für uns da sein kann und wir uns ihm hingeben können in grenzenloser Liebe. Sie hilft auch dabei, im Glauben zu wachsen und so zu werden, dass es „der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht“ (Philipper 2,5). Wir verstehen besser, was es bedeutet, so zu leben wie er…
Die traditionelle Form der Lectio divina bestand aus vier Stufen. Die Methode implizierte einen Prozess, der mit dem Aufnehmen der Worte der Schrift durch Augen oder Ohren begann (lesen oder lectio). Dann wurden sie im Stillen mehrfach wiederholt und überdacht (meditatio), bis sie verarbeitet waren und mit einem Gebet (oratio) beantwortet wurden. So wurde eine Gebetsbewegung ausgelöst, die über die Worte hinausging, die an Gott gerichtet waren und die Gott gesprochen hat, und überging in einen freieren und spontanen Augenblick der Anbetung (contemplatio).
Um hören zu können, müssen wir uns einem anderem öffnen und es dem Sprechenden überlassen, Ton und Tagesordnung zu bestimmen. Zuhören setzt uns in Beziehung zu dem, der spricht. Wenn wir einüben, auf die Heilige Schrift zu hören, statt sie einfach nur zu lesen, dann ist dies der beste Weg, um zu lernen, dass Gott durch die menschlichen Verfasser der Bibel spricht. So können wir das Wort Gottes auf eine ganz andere Weise empfangen und uns auf eine völlig neue Sinnebene einlassen. Da Gott mit uns ist und sein Wort an uns richtet, können wir antworten auf das, was wir hören – nicht wie wir auf ein Stück Literatur reagieren, das wir mit unseren Verständnismöglichkeiten erfassen, sondern wie bei einer Begegnung mit Gott im Gebet. Nach und nach, und je mehr wir die persönliche Bedeutung dessen erkennen, was wir als Gottes Wort empfangen, lernen wir, unsere Aufmerksamkeit mehr auf den Sprechenden zu lenken als auf das, was er sagt. So gewinnt Gebet die Dimension der Anbetung Gottes.
Wenn wir diese Methode in einer Gruppe anwenden ist es gut, den Bibeltext (am besten nur ein paar Verse, die alle als Kopie vor sich haben) drei Mal zu lesen. Vor dem ersten Lesen werden die Teilnehmenden eingeladen, auf Worte oder Sätze zu achten, die ihnen ins Auge springen und ihre Aufmerksamkeit wecken. Diese Wörter oder Sätze werden laut ausgesprochen, ohne Zusätze und ohne kommentiert zu werden. Das ist die Phase der lectio.
Vor dem zweiten Lesen wird dazu eingeladen zu hören, was Gott ihnen mit den Versen sagen will, vielleicht in ihren eigenen Worten, vielleicht auch direkt durch die Worte der Schrift. Wer möchte, kann auch dies laut aussprechen, in einem Satz, der ebenfalls unkommentiert bleibt. Das ist die Phase der meditatio.
Vor dem dritten Lesen werden die Leute dazu eingeladen wahrzunehmen, wie sie Gott im Gebet antworten möchten, nachdem sie seine Botschaft verstanden haben. Dies kann, je nach Situation, laut geschehen oder auch in der Stille.
Zum Schluss beten alle in der Stille zu Gott und sagen ihm all das, was sie in seinem Wesen sehen und lieben und wonach sie sich sehnen. Das ist die Phase der contemplatio.
Weitere praktische Beispiele finden Sie in Teil 3: Ressourcen, ‚Einleitung‘, S. 175–177 und in ‚Arbeitsmaterial‘, S. 179–181.
34 G. K. Chesterton, Everlasting Man, Hodder & Stoughton, 1925.
35 Peter Rollins, How (Not) toSpeakofGod, SPCK, 2006, S. 64.
36 Auf die heutige Kultur bezogen finden wir dies z. B. in Taizé und in den Schriften von Abt Christopher Jamieson von Worth Abbey (einem Benediktinerkloster in Südengland – Anm. d. Übers.).
37 Ein fundiertes Werk aus der evangelikalen Tradition, das auch meinen geistlichen Weg ganz entscheidend mit geprägt hat (alle 435 Seiten), ist von Richard Lovelace, Dynamics of Spiritual Life, InterVarsity Press, 1980.
38 Rollins, How (Not) to Speak of God, S. 64.
39 Am 8. Juni 793 griffen die Wikinger die sogenannte Holy Island an, zerstörten das Kloster und töteten die, die darin lebten. Es war der erste Wikingerangriff auf England, dem viele weitere folgten. Das Entsetzen war groß, weil niemand verstand, wie Gott und die Heiligen die Zerstörung einer so heiligen Stätte zulassen konnten. (Anm. d. Übers.)
40 Das Material zu Emmaus. Auf dem Weg des Glaubens ist im Neukirchener/Aussaat-Verlag auf Deutsch erhältlich. (Anm. d. Übers.)
41 Wunderbar nachzulesen in dem großen Werk von J. Wesley Bready, England: Before and After Wesley, Hodder & Stoughton, 1939.
42 Royal Wootton Bassett ist eine kleine Stadt in der Nähe des Militärflughafens RAF Lyneham, zu dem bis 2011 die im Irak- und Afghanistankrieg gefallenen Soldaten rückgeführt wurden. Die Einwohner der Stadt standen jedes Mal Spalier für die Särge. (Anm. d. Übers.)
43 Siehe Ann Morisy, Journeying Out, Morehouse, 2004, und ihre aufschlussreichen Kommentare über angemessene Liturgie (S. 156–164).
44 Siehe Lynda Barley, Christian Roots, Contemporary Spirituality, Church House Publishing, 2006, S. 47–49.
45 Siehe Marva Dawn, Reaching Out Without Dumbing Down, Eerdmans, 1995.
46 Runcorn, The Road to Growth Less Travelled.
47 Roberta Bondi, To Pray and To Love, Burns and Oates, 1991. In: Robert Warren, Vitale Gemeinde, ein Handbuch für die Gemeindeentwicklung, Neukirchener Verlagsgesellschaft, Neukirchen-Vluyn, 2008, 2. Auflage 2013, S. 53.
48 James Philip, Christian Maturity, IVF, 1964. Er sagt weiter: „Das Kennzeichen der größten Heiligen Gottes ist nicht ihr Heiligenschein und eine Ausstrahlung von Unnahbarkeit, sondern ihre Menschlichkeit. Sie waren äußerst menschlich und liebenswert, oft mit einem Augenzwinkern.“
49 The Times, Wednesday 18 January 2012.
50 Siehe Kapitel 5 und 6; siehe auch das Prinzip des Umwegs (principal of obliquity) in Ann Morisys Journeying Out, S. 11 ff.
51 John Holmes, When I Am Weak, Daybreak, 1992. Dieses Buch ist, zusammen mit seinem bei Grove Books erschienenen Buch Vulnerable Evangelism: The Way of Jesus, Grove, 2003, eine hervorragende praktische Ressource für Einzelpersonen und Gemeinden, die schwierige Zeiten der Schwäche erleben und in solchen Zeiten nach Gott suchen.
52 Robert Warren, Living Well, Fount, 1998.
53 Matthäus 5,3.
54 Unter anderem Autorin von Religion in Britain Since 1945, Wiley Blackwell, 1994, und The Sociology of Religion, Sage, 2007.
55 Eine ähnlich, allerdings weiter ausgearbeitete und langfristigere Geschichte erzählt Yaconelli in Contemplative Youth Ministry, S. 128–131.
56 J. Neville Ward, Five for Sorrow, Ten for Joy, Church House Publishing, 2005, S. 3.
57 Das folgende Material basiert auf: David Foster, Reading with God, Continuum, 2005, besonders S. 1–4.