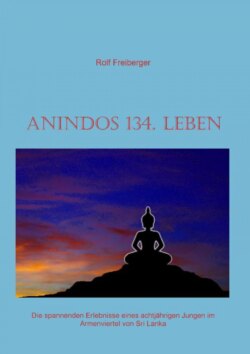Читать книгу Anindos 134. Leben - Rolf Freiberger - Страница 7
Kapitel 1 - Wie die Familie lebt
ОглавлениеWohnung, Schule, schreiben, spielen, nass, kaputt
Anindo Bandanage ist ein achtjähriger Junge. Er wohnt im Armenviertel von Chenkaladi auf der Insel Sri Lanka. Auf Sri Lanka leben hauptsächlich Singhalesen und im Norden eine größere Anzahl Tamilen. Anindo ist Singhalese und er träumt schon lange immer wieder einen vielleicht unerfüllbaren Traum.
Chenkaladi liegt in der Nähe der Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts Batticaloa. Batticaloa heißt auf Singhalesisch „Schlammige Lagune“. Das Armenviertel befindet sich außerhalb des Dorfes Chenkaladi. Über der Ansammlung selbstgebauter Hütten schwebt das durchdringende Parfüm von Armut, eine Duftfahne, in der sich Staub, Urin und Kotgeruch, Müllgestank und Brandgeruch vermengen. Zwischen den Hütten winden sich schmale Rauchfahnen von den Feuerstellen hoch, um sich über den Hütten zu einem Schleier auszubreiten. Der schwache Wind, der manchmal vom Meer herüber weht, verschafft den Bewohnern klare Luft und Erlösung vom Gestank. Die Behausungen der Armen sind ohne eine verbindende Ordnung einfach irgendwo errichtet worden, wo gerade Platz war.
Anindos Familie lebt in einer kleinen aus Abfällen, Ästen und Plastikfolien zusammengebauten Hütte. Zwei nicht verschließbare Öffnungen dienen als Eingang und Fenster. Obwohl die Hütte sehr klein ist, schafft es das Tageslicht nicht, bis in die letzten Winkel zu kriechen. Schutz vor der sengenden Sonne und Regen bietet das Dach aus mehreren Lagen Palmwedeln. Möbel sucht man vergebens, der einzige Luxus sind mit Pflanzen gepolsterte Schlafstellen auf dem Boden. Diese Hütte dient als Wohnung für Anindos Eltern, Oma und Opa, Anindo und seine zwei Schwestern. Beena ist fünf, Ragini drei Jahre alt.
Anindos Eltern sind sehr arm, sie können nicht einmal regelmäßig etwas zu essen kaufen. Für jeden der Familie gibt es am Tag nur eine handvoll Reis. Für die Kinder streuen die Eltern ein paar Kristalle Zucker darauf, weil es ihnen sonst nicht schmeckt und sie nicht genug essen. Den Reis kocht die Mutter in einem verbeulten Metalltopf über einem offenen Feuer.
Die Hütte besitzt weder Strom noch Wasser. Wasser muss sich die Familie wie alle anderen Armen in Kanistern aus dem Dorf holen. Dort gibt es einen alten Trinkwasser-Brunnen mit einem verrosteten Handschwengel. Von lautem Quietschen begleitet lässt sich der Schwengel nach widerwilligem Auf- und Abbewegen dazu herab erst ein paar Tropfen und dann ein unregelmäßiges Rinnsal herzugeben. Die Pumpe spuckt eine leicht trübe nach Salz schmeckende Brühe aus. Das Wasser muss immer abgekocht werden, bevor man es trinken kann, es ist nicht keimfrei. Das Wasserholen erledigt meistens Anindos Mutter. Es bereitet ihr große Mühe, die schweren Kanister die weite Strecke zu tragen.
Wasser zum Waschen gibt es im Armenviertel nicht. Die Menschen gehen mehrmals in der Woche zu einer nahe gelegenen Wasserstelle an einem kleinen Fluss, hier können sie sich reinigen. Ein Stück daneben waschen sie ihre wenige Wäsche.
Tagsüber sitzt die Familie vor ihrer Hütte, die unerträgliche Hitze des Tages und die Enge zwingen sie nach draußen. Ihr Leben ist eintönig und anstrengend, aber die Familie erträgt ihr Schicksal, denn sie glaubt an eine Wiedergeburt nach ihrem Tode. Es kann ein Leben als Affe, Schlange, als Hungergeist oder auch wieder als Mensch sein, je nachdem, wie man vorher gelebt hat. Niemand weiß es. Ihr Gott heißt Buddha, was soviel bedeutet wie „der Erwachte“. Zu ihm beten alle jeden Tag für ein besseres nächstes Leben. Führt man ein gutes Leben, wird das nächste besser. Vielleicht ist Anindos Leben das fünfte oder zweihundertvierundsechzigste, das kann niemand sagen. Auch Anindo weiß es nicht und hat für sich beschlossen, es ist das einhundertvierunddreißigste.
Anindos schmaler Körper ist von schlechter Ernährung gezeichnet. Seinen Kopf bedeckt schwarzes leicht gelocktes Haar, das bis zu den Schultern reicht. Seine großen dunklen Augen blicken lebhaft umher und funkeln im Licht wie zwei polierte schwarze Glaskugeln. Das hagere Gesicht trägt oft die Spuren des Spielens in Form von getrocknetem Lehm. Obwohl er nicht sehr muskulös ist, bewegt Anindo sich schnell und kraftvoll. Das Besondere an diesem kindlichen Gesicht, das nicht oft gewaschen wird, ist die Lebensfreude, die es ausstrahlt. Beim Lachen bilden sich um die Nasenflügel kleine verschmitzte Falten und seine schneeweißen Zähne blitzen durch den leicht geöffneten Mund. Ein strahlender Kontrast zu der goldbraunen Farbe seiner Haut. Über einem zum Lendenschurz gebundenen Tuch trägt er ein zerrissenes viel zu großes T-Shirt mit dem Aufdruck Hard Rock Cafe Las Vegas. Ein Tourist schenkte es ihm letztes Jahr, als Anindo ihn im Dorf angebettelt hatte.
Seine Mutter ist eine kleine zierliche Frau. Wenn man sie ansieht, hat man das Gefühl, in das Gesicht einer gütigen Fee zu blicken. Ihre langen schwarzen Haare flechtet sie zu einem kräftigen Zopf zusammen. Meistens legt sie ihn über die rechte Schulter nach vorne und er ist so lang, dass sein Ende bei jedem Schritt über ihre Oberschenkel pendelt. Anindos Mutter trägt ein dunkelrotes Wickelkleid mit goldenen Rändern entlang der Schultern und dem seitlichen Abschluss. Alle Frauen hier tragen solch ein Wickelkleid, das man Sari nennt, und jede wickelt es mit ihrer eigenen speziellen Technik. So sieht selbst bei gleichem Sari-Stoff jede Frau individuell aus. Wenn Anindos Mutter in ihrem kunstvoll gewickelten Sari durch das Dorf schreitet, spürt sie, wie ihr die Blicke der Bewunderung folgen. Sie lächelt still in sich hinein und genießt diesen Moment der unausgesprochenen Anerkennung.
Anindos Mutter hat von ihrer Mutter und die von ihrer die Technik der Batik erlernt. Das sind Bilder auf Stoff, die durch ihre besondere Herstellung ein unverwechselbares Aussehen erhalten. Die Bilder verkauft die Mutter an Touristen, denen das sehr gut gefällt. Manchmal arbeitet sie die ganze Nacht hindurch bei Kerzenschein, weil sie bis zum nächsten Morgen ein Wunschmotiv fertig stellen muss. Großmutter hilft ihr häufig bei der Arbeit.
Anindos Vater ist ein schweigsamer, geduldiger Mann, der seine Frau und drei Kinder innig liebt. Er ist sehr unglücklich darüber, dass er ihnen kein besseres Leben bieten kann. Für einfache Menschen gibt es aber hier so gut wie keine Arbeit. Man hilft sich untereinander und es gibt dafür dann mal einen Laib Brot oder Gemüse, selten mal ein Huhn. In der Hauptstadt Batticaloa gibt es einige reiche Leute in großen weißen Villen mit Swimmingpool, bei denen wenige Menschen aus Chenkaladi arbeiten. Die Reichen wollen aber kein Personal, das nicht lesen und schreiben kann. So gelingt es nur Wenigen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Vater geht jeden Tag ins Dorf, um vielleicht eine kleine Gelegenheitsarbeit zu bekommen.
Anindos Vater ist trotz seiner Armut in Chenkaladi und Umgebung ein berühmter Mann. Immer wenn Besucher kommen, fragen sie: „Wo wohnt der Wundermensch?“ Vaters linke Hand trägt einen sechsten Finger neben dem kleinen. Da das jeder sehen will, lässt er sich ein kleines Trinkgeld dafür geben. Touristen lassen sich mit ihm fotografieren und bedanken sich mit einem besonders großzügigen Trinkgeld. Es kommen aber zu wenige, davon leben könnte die Familie nicht.
Weder Vater noch Mutter, erst recht nicht die Großeltern können schreiben oder lesen. Die nächste Schule ist vor ungefähr 20 Jahren in Batticaloa gebaut worden, da waren sie schon zu alt dafür. Es gibt kaum Schulen in der Nähe der kleinen Dörfer und die Lehrer unterrichten lieber in den Großstädten, weil sie da mehr verdienen. Anindos Eltern sind viel zu arm, um ihre Kinder unterrichten zu lassen, selbst wenn es hier eine Schule gäbe. Sehnsüchtig wünscht sich Anindo, trotzdem einmal eine Schule besuchen zu können. Er ist jetzt schon acht Jahre alt und verbringt fast den ganzen Tag mit Betteln. Das Geld, das ihm mitfühlende Menschen schenken, gibt er seinen Eltern, um Reis zu kaufen. Etwas von dem Erbettelten hält er jeden Abend zurück und spart es, um irgendwann davon eine Schule bezahlen zu können. Er legt das Geld in eine Plastiktüte, die er einem kleinen Erdloch in der Höhle anvertraut. Seine Eltern könnten das Geld zwar gut gebrauchen, aber sie denken auch an Anindos Zukunft und freuen sich, dass er so beständig sein Ziel verfolgt. Nur manchmal, wenn das Geld so gar nicht reicht, muss Anindo mit seinem Ersparten aushelfen. Das rückt seinen Traum weiter in die Zukunft, er macht es jedoch gerne, denn seine Familie ist wichtiger als alle seine Wünsche.
So vergeht jeder Tag wie der vorherige und es bleibt ihm nur sehr wenig Zeit zum Spielen. Spielzeuge kennen Anindo und seine Freunde nicht. Sie denken sich selber irgendwelche Spiele aus. Manchmal stellen sie sich vor, ein bestimmtes Tier zu sein, etwa ein Krokodil oder ein Elefant. Sie versuchen dann, sich genauso zu benehmen, wie das ausgedachte Tier. Manchmal erfinden sie Geschichten und spielen sie anderen Kindern vor. Sie sind inzwischen gute Schauspieler und die Kinder, die zusehen, strahlen vor Begeisterung.
Wenn Anindo nach einem Betteltag wieder die alte Plastiktüte, die er wie einen Schatz hütet, aus dem Erdloch hervorkramt und Geld hinein gibt, muss er daran denken, dass ein großer Teil des Geldes leider nicht mehr da ist. Und das kam so.
Eines Nachts gab es einen riesigen Tumult im Dorf, man hörte Menschen vor Angst schreiend aufgeschreckt herumlaufen. Einige wilde Elefanten hatten das Dorf überfallen und das Wenige, das die Bewohner besaßen, zerstört. Auch die Hütte von Anindo war nicht mehr da. Man sah nur noch die Reste des Mülls, aus dem sie mal zusammengebaut wurde. Die Familie stand verzweifelt vor dem, was mal ihr Zuhause war und konnte nicht glauben, dass jetzt alles kaputt war.
Der Großvater erinnerte sich daran, dass es in der Nähe des Ortes noch eine alte Höhle gab. Hier könnte die Familie erst mal Unterschlupf finden. Sie suchten in dem Schutthaufen ihrer Hütte nach brauchbaren Gegenständen wie Geschirr und Töpfen und jeder nahm soviel auf, wie er tragen konnte. Dann machten sie sich auf den Weg. Die Höhle war geräumig und bot Schutz vor der heißen Sonne. Aus Ritzen in den Wänden drang Wasser in die Höhle und der Boden war an einigen Stellen nass. Sie suchten sich eine trockene Stelle in der Nähe des Eingangs, wo noch viel Licht hereinfiel und legten ihr mitgebrachtes Hab und Gut dort ab.
Anindo und seine zwei Schwestern untersuchten erst einmal jeden Winkel der Höhle genauestens. Der hintere dunkle Teil machte sie besonders neugierig. Dieser Teil der Höhle war von einem heftigen Geflatter erfüllt, das die Kinder am Anfang ziemlich beunruhigt hat. Manchmal spürten sie einen ungewohnten Luftzug um sich herum, der sie mächtig erschreckte. Sie rannten dann schnell nach vorne zum Licht. Sie fühlten sich aber immer wieder von dem dunklen Geheimnis angezogen und versuchten, das eigenartige Geräusch zu ergründen. Die Höhle war der Lebensraum von Hunderten Fledermäusen. Nachts haben sie die Höhle in Schwärmen verlassen, um Insekten zu erbeuten und zu fressen.
Sobald sich die Familie in der Höhle eingerichtet hatte, begann der Vater, die zerstörte Hütte aus den übrig gebliebenen Resten so gut es ging, wieder aufzubauen. Anindo half dabei fleißig mit. Mit seinem Vater lief er immer wieder in den Wald, um Äste für das Hüttendach zu suchen. Auch Palmwedel für die Abdeckung des Daches mussten sie besorgen. Anindos Vater musste dazu auf die Palmen klettern und die großen Blätter abschneiden. Anindo hat dabei von seinem Vater gelernt, wie man an dem glatten Stamm entlang läuft. Sie haben sich dazu ein paar junge Palmen mit einem nicht zu dicken Stamm ausgesucht, den Anindo mit seinen kleinen Armen umfassen kann. Er hat den Stamm mit beiden Armen fest umklammert und versucht, die Füße dagegen zu stemmen. Das war am Anfang sehr anstrengend und schwierig. Sobald er einen Fuß gelöst hat, ist der andere wieder herunter gerutscht. So sehr er sich auch bemühte, er kam einfach nicht höher. Nach etlichen Versuchen gelang es Anindo dann endlich durch entsprechende Fußstellung und den richtigen Abstand zwischen Armen und Füßen, das erste kleine Stück zu erklimmen. Von den vielen Versuchen hatte er einen riesigen Muskelkater und ziemlich abgeschürfte Arme. So nach und nach klappte es aber immer besser.
Leider konnte Anindo in dieser Zeit nicht mehr betteln gehen und er musste einen großen Betrag seiner jahrelangen Ersparnisse zum Kauf von Reis hergeben. Nach vier Wochen harter Arbeit stand wieder so etwas wie eine Hütte da. Sie war jetzt noch ärmlicher als vorher, die zerstörten Teile hat Anindos Vater nur notdürftig flicken können. Einige Gegenstände waren überhaupt nicht mehr zu gebrauchen.
Die Familie zog wieder in die Hütte ein, Anindo ging jeden Tag zum Betteln ins Dorf, der Vater versuchte, etwas von der wenigen Arbeit zu bekommen, für die man Geld bekam, und die Mutter kümmerte sich um die Großeltern und die kleinen Mädchen.
Wenn Anindo abends müde auf dem mit Palmwedeln bedeckten Boden darauf wartet, dass er einschläft, versucht er sich vorzustellen, wie es wäre, wenn er zur Schule ginge. Manchmal träumt Anindo davon und im Traum kann er lesen und schreiben. Er wünscht sich jeden Abend, der Traum würde ihn wieder besuchen. Wenn er kommt, ist Anindo sehr glücklich. Er geht dann fröhlich ins Dorf und bettelt wieder um ein paar Rupies, so heißt das Geld hier. Er legt jeden Abend wieder etwas davon in die Plastiktüte und weiß, eines Tages wird sein großer Traum wahr. Er wird zur Schule gehen.