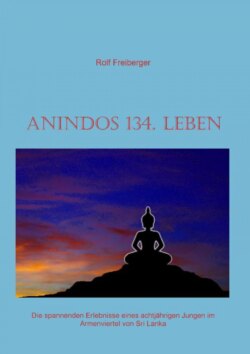Читать книгу Anindos 134. Leben - Rolf Freiberger - Страница 9
Kapitel 3 - Anindos Vater bekommt endlich Arbeit
ОглавлениеHunderte, Platz, stören, spüren, richtig, übel
Es ist Dienstag, der 21. September 2002. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag anders verläuft als die Tage vorher. Aber dieser Tag wird das Leben von Anindos Familie drastisch verändern.
Anindos Nacht war unruhig und er fühlt sich beim Aufwachen elend. Immer wieder wurde er von schlechten Träumen geplagt. Sie waren so real, dass er davon mehrere Male aufgewacht war. Am Ende erschreckten ihn die Träume so sehr, dass er gar nicht mehr einschlafen wollte. Die Dämonen, denen er im Traum begegnet ist, haben seinen kleinen Körper immer wieder ergriffen, geschlagen und umhergeworfen. Er fühlt sich am Morgen völlig ermattet und spürt noch die Schmerzen der Nacht. Der Schmerz und die Angst sind ihm auf den Magen geschlagen. Ihm ist derartig übel, dass er nichts essen kann. Obwohl Anindo nicht die geringste Lust verspürt aufzustehen, siegt sein Verantwortungsgefühl und er macht sich auf den Weg ins Dorf, um seine tägliche Arbeit, das Betteln zu verrichten. Missmutig stapft er los, immer noch die schrecklichen Bilder der Nacht im Kopf. Auf dem Weg trifft er sich wie immer mit Ramesh. Er erzählt Ramesh von den schrecklichen Träumen und dass er sich heute niedergeschlagen und lustlos fühlt. „Anindo, Träume sind wie Gespenster. Sie kommen, niemand weiß woher, und plötzlich sind sie wieder verschwunden. In der Vorstellung leben sie aber noch eine Weile fort und wir halten sie für die Wirklichkeit. Sie erinnern uns an Dinge, die wir erlebt haben, schöne und auch solche, vor denen wir uns fürchten. Wovor fürchtest du dich, Anindo?“, fragt Ramesh.
Anindo schaut verwundert. Diese Erklärung überrascht ihn und Ramesh hat ihm klar gemacht, dass er sich vor etwas fürchtet. Noch nie ist ihm ein solcher Gedanke gekommen und jetzt fühlt er sich fast ertappt. Er blickt Ramesh staunend an. „Ramesh ist zwar zwei Jahre älter als ich“, denkt er, aber er kommt mir sehr erfahren vor. „Ich weiß es nicht, Ramesh.“ „Jeder Mensch fürchtet sich vor etwas.“ antwortet Ramesh. „Aber ich weiß es doch nicht“, entgegnet ihm Anindo wieder. „Hast du vielleicht Angst vor Krankheit oder davor, jemanden aus deiner Familie zu verlieren? Waren es die Totengeister, die dich gequält haben?“
Anindo denkt an seine Eltern, die er über alles liebt, an seine kleinen niedlichen Schwestern und an Opa und Oma, die ihm soviel Zeit opfern. Er erinnert sich an die schönen Geschichten, die sein Großvater erzählen kann. Manche hat er sich sicher schon 100-mal erzählen lassen. Bei dem Gedanken wird er plötzlich richtig traurig. Ihm wird nun bewusst, dass Großvater eigentlich schon sehr alt und schwach ist. Großvater sprach mehrere Male mit einem rätselhaftem Gesichtsausdruck: „Ich bin am Ende einer langen Reise. Von dieser Reise werde ich nicht zurückkommen. Ich spüre, das Ziel ist bald erreicht.“ „Solche Bemerkungen haben meine Eltern nicht beunruhigt, auch mich nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es auch nicht verstanden“, erklärt Anindo nachdenklich. „Dein Großvater bereitet sich auf den bevorstehenden Tod vor“, entgegnet Ramesh. „Ihr dürft ihn dabei nicht stören, sonst stirbt er mit schlechten Gedanken und wird vielleicht als Tier wiedergeboren.“
Anindo ist jetzt klar, wovor er sich fürchtet und die Totengeister wollten ihn ermahnen, Abschied von Großvater zu nehmen. Ramesh sieht Anindos bedrücktes Gesicht und tröstet ihn mit den Worten: „Anindo, du musst nicht traurig sein. Wir alle sind auf einer Reise, die irgendwann zu Ende ist. Für jedes neu entstehende Leben muss ein altes vergehen. Denke an das schwere Leben, das Buddha für deinen Großvater ausgewählt hat. Im nächsten Leben wird er es besser haben. Buddha liebt alle seine Geschöpfe und dein Großvater kommt ihm mit jedem Tod ein kleines Stückchen näher.“
Das beruhigt Anindo erst einmal nicht, aber er wird deutlich ruhiger und die Traumbilder verschwimmen in seinem Gedächtnis. Am Ende des Tages werden sie verschwunden sein. Anindo weiß, wenn er nach Hause kommt, wird er Großvater ganz fest in den Arm nehmen und ihm sagen, wie sehr er ihn liebt.
Sie sind jetzt im Dorf angekommen und stehen auf dem großen Platz, auf dem mittwochs und samstags Marktstände mit Gemüse, Fleisch, Fisch und vielen Leckereien stehen. An den Markttagen gehen sie von Stand zu Stand und bekommen manchmal ein Stück Obst oder Süßes zugesteckt.
Heute ist der Platz voll mit Menschen, es müssen Hunderte sein, die wild durcheinander reden. Die Jungen nähern sich ihnen und nehmen Gesprächsfetzen wahr, bei denen immer wieder das Wort Arbeit fällt. Vor dem einzigen Restaurant im Dorf sind einige Tische aufgebaut, hinter denen wichtig aussehende Männer sitzen. Davor stehen Männer aus dem Dorf und der größeren Umgebung und werden von den wichtigen Personen hinter den Tischen ausgefragt. Neben dem Restauranteingang hängt ein Pappschild, auf dem die Buchstaben W-O-R-K stehen. Natürlich haben Ramesh und Anindo keine Ahnung, was das bedeutet. Sie fragen einen der Männer, die in langen Schlangen vor den Tischen warten. „Work ist Englisch und bedeutet Arbeit“, antwortet der. „Aber ich sehe hier nichts, das gearbeitet werden könnte“, sagt Anindo. „Dummer Junge, die Arbeit ist natürlich nicht auf dem Marktplatz.“ Anindo lässt nicht locker. „Und wo ist sie dann?“ „Ich weiß es nicht genau, es soll in Indien sein, in einem Hafen. Und jetzt verschwinde, ich muss mich konzentrieren.“
Plötzlich steht einer der Männer hinter den Tischen auf und verschwindet im Restaurant. Anindo läuft sofort hinterher und hofft, ihn drinnen zu treffen. Der Mann steht an der Theke und trinkt einen Tee. Er redet jetzt schon seit vier Stunden und genehmigt sich eine Pause. Immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. „Was können Sie?“ „Sind sie gesund?“ „Was haben sie bis jetzt gemacht?“ Und die Antworten: „Ich kann kräftig zupacken.“ „Ich war noch nie krank, mein Vater ist schon 79 Jahre alt.“ „Ich habe meinen Nachbarn beim Bau und der Reparatur ihrer Häuser geholfen.“
Anindo spricht ihn an: „Kann man bei Ihnen für Geld arbeiten, will er wissen?“ Der Mann sieht ihn verwundert an. „Was will der Knirps denn von mir?“, denkt er sich. „Junge, bist du nicht noch etwas jung für Arbeit? Wie alt bist du eigentlich?“ „Ich bin acht Jahre und ich suche die Arbeit nicht für mich. Mein Vater braucht unbedingt eine Arbeit. Wir sind arm und können uns nichts zu Essen kaufen.“ „Was kann denn dein Vater?“, will der Mann wissen? „Mein Vater kann alles, was man von ihm verlangt. Er ist kräftig und schlau.“ „Hmmh, das hört sich ja interessant an. Schicke deinen Vater hier vorbei. Er soll sich an Tisch 14 anstellen und mir deinen Namen sagen. Wie heißt du?“ „Ich heiße Anindo Bandanage.“ „Gut Anindo, lauf zu deinem Vater und sage ihm, er soll sich beeilen.“
Anindo weiß vor Glück kaum, was er denken soll. Heute kann er nicht betteln. Er eilt mit fliehenden Schritten nach Hause. Ramesh bleibt im Dorf und bettelt, wie er es immer tut.
Zuhause angekommen stürzen die Wörter über das Erlebte aus Anindos Mund. Es dauert eine Weile, bis die Familie versteht, wovon Anindo spricht. Der Vater zieht seine besten Sachen an und läuft sofort los. Es ist schon dunkel, als er zurückkehrt. Er macht ein entspanntes freudiges Gesicht. Niemand spricht, aber jeder spürt die Anspannung bei dem Gedanken, ob Vater Arbeit bekommen hat. Anindos Vater geht auf Mutter zu, umarmt sie liebevoll, dann geht er zu seinen drei Kindern und küsst sie auf die Wange. „Ich habe Arbeit. Mindestens für sechs Monate. Ich werde euch dafür aber verlassen müssen. Die Arbeit ist in Indien, im Hafen von Chennai. Dort soll ein neues Hafenbecken gebaut werden. Den Auftrag führt eine große Baufirma aus Kandy aus. Buddha war gnädig zu mir, als er mir den sechsten Finger an meiner rechten Hand gab. Deswegen haben sie mich genommen. Der Beamte hinter dem Tisch sagte außerdem, dass die Bitte Anindos seine Auswahl unterstützte.“ Die Familie kniet nieder und bedankt sich bei Buddha für seine göttliche Unterstützung. Heute Nacht werden sie alle nicht schlafen können. Sie sind zu aufgeregt.
Bevor Anindo sich zum Schlafen legt, geht er in den hinteren dunkleren Teil der Hütte, wo seine Großeltern auf dem Boden kauern. Er geht zu Großvater, schließt ihn fest in seine dünnen Kinderärmchen, legt seinen Kopf an Großvaters Wange und flüstert: „Opa, ich liebe dich und werde dich immer lieben und niemals vergessen.“ Der Großvater ist von diesen Worten sehr gerührt. Sie machen das Ende seiner Reise leichter.
Am nächsten Morgen packt Vater einige wenige Kleidungsstücke und persönliche Dinge zusammen. Der wichtigste Gegenstand ist ein verknittertes ausgeblichenes Foto von seiner Familie. Ein Amerikaner, der seine Hand mit den sechs Fingern sehen wollte, hat das Foto mit einer Polaroid-Kamera gemacht. Dem Vater wird beim Anblick des Fotos das Herz schwer und er drückt das Bild an seine Brust, bevor er es in seinem Reisebeutel verstaut. In zwei Tagen kommt ein Autobus aus Kandy und holt ihn ab. Vorher muss er noch mit seiner Frau zur Bank nach Batticaloa, um ein Konto zu eröffnen, damit er seiner Familie Geld aus Indien schicken kann. Es ist das erste Konto in seinem Leben.