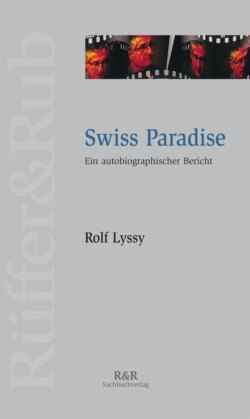Читать книгу Swiss Paradise - Rolf Lyssy - Страница 7
Оглавление3
Das erste Gespräch mit Dr. B. und dessen Assistentin Dr. N. verlief nicht besonders ergiebig. Beide wiederholten nachdrücklich, was ich nicht hören wollte. Ich reagierte verärgert und behauptete, ich würde keinesfalls an einer Depression leiden, ich hätte lediglich ein Problem, wenn auch ein schwerwiegendes: Der Film, den ich in diesem Jahre realisieren wollte, war gestorben. Und jetzt stand ich da, ohne Arbeit und ohne Geld. Meine ganzen Ersparnisse, das Regiehonorar für den Fernsehfilm Ein klarer Fall, den ich im Sommer 1994 inszeniert hatte, eingeschlossen, hatte ich für die Drehbucharbeit zu »Swiss Paradise« eingesetzt und aufgebraucht. Fahrlässig, blauäugig, stur: Ich war in eine schlimme Falle getappt. Wie ein Fischer, der einen dicken Fisch an der Angel hat und im Kampf um die fette Beute keinen Moment daran denkt, daß die Leine reißen und er alles verlieren könnte. Ich hatte eine elementare Regel in den Wind geschlagen, nämlich die, daß es beim Filmemachen zugeht wie in einer großen Lotterie, wo man die Chance zu gewinnen nur steigern kann, wenn man sich rechtzeitig und immer mit mehreren Losen eindeckt. Ich aber war überzeugt gewesen, mit zwei populären und zugkräftigen Hauptdarstellern, Viktor Giacobbo und Walo Lüönd, und einem exotisch-reizvollen Drehort in den USA den alles übertreffenden Joker in der Hand zu haben. Und jetzt saß ich vor den beiden Ärzten und wußte, der vielversprechende Joker hatte sich längst in eine peinliche Niete verwandelt.
Dr. B. zeigte sich sehr verständnisvoll, wiederholte ungerührt seine Diagnose und fügte an, daß die Depression mit Sicherheit vorbeigehen würde, er könne nur nicht sagen, wann. Mit einigen Wochen müsse ich aber schon rechnen. Ich blieb stumm und in meinem Kopf jagten sich die Gedanken. Einige Wochen? Ich hatte mit einigen Tagen gerechnet, schlimmstenfalls zwei Wochen. Aber mehrere Wochen? Das konnte heißen, vier, fünf, sechs Wochen und mehr. Ein unerträglicher Gedanke. Länger als zwei Wochen in dieser Umgebung, mit den Irren… Das würde ich nicht aushalten, nie, unmöglich.
Ich starrte schweigend vor mich hin. Dr. N. sprach eindringlich auf mich ein, daß ich mich umgehend melden solle, wenn mich wieder Suizidphantasien bedrängen würden. Ich nickte gedankenverloren und blieb weiterhin stumm. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich hatte zwei Tage zuvor, bei meinem Eintritt, auf ihre Frage, ob ich Selbstmordgedanken hätte, zu Protokoll gegeben, ja, ich dächte daran. Kann man einem das denn verdenken? Dr. B. informierte mich über die Therapieangebote.
Neben den Gesprächstherapien, die zwei- bis dreimal in der Woche vorgesehen waren, gab es Ergotherapie, Bewegungstherapie, Musiktherapie und Physiotherapie. Die letzte interessierte mich am ehesten, Massage war immer gut. Die anderen Angebote konnten mir jedoch gestohlen bleiben. Speziell die Ergotherapie. Nur schon der Gedanke an irgendwelches Basteln, das ich schon in der Schule gehaßt hatte, rief in mir den blanken Horror hervor. War man hier wirklich der Ansicht, daß sich meine abgrundtiefe Verzweiflung in Luft auflösen würde, wenn ich mit irgendwelchem Werkzeug Karton, Papier oder Holz bearbeitete? Dr. B. schlug vor, daß ich mit der Therapeutin wenigstens reden sollte. Unverbindlich, ohne Zwang, nur um mehr über diese Therapie zu erfahren, mit der man nur die besten Erfahrungen mache. Okay, reden kostete nichts. Ich wußte jetzt schon, daß alle Mühe vergebens sein würde, aber ich wollte der Dame mindestens die Gelegenheit geben, mich über ihre Methode zu informieren. Und ich wollte jetzt mit Dr. B. und Dr. N. keine Grundsatzdiskussion über die verschiedenen Therapien führen. Es reichte mir, daß ich mit Chemie eingedeckt wurde. Dreimal täglich, morgens, mittags, abends, eine Pille. Ich hatte mich dagegen gewehrt, gab aber schließlich den Widerstand auf. Den wissenschaftlich abgestützten Argumenten der erfahrenen Psychomediziner hatte ich wenig entgegenzusetzen. Sicher hätte ich mich weigern können, die Medikamente zu schlucken, kein Mensch konnte mich dazu zwingen. Aber Unsicherheit und Angst waren zu groß. Was würde mich erwarten, wenn ich die Therapie verweigerte? Eine noch schlimmere Höllenfahrt, an deren Ende die totale Verblödung wartete? Mittlerweile wußte ich, daß auch die Ärzte den einzuschlagenden Weg nicht präzise kannten. Therapie mit Psychopharmaka sei nichts anderes als trial and error, hatte mir Dr. K. wenige Tage zuvor gesagt, als ich mich wieder einmal über die ausbleibende Wirkung der Tabletten beklagte. Die Reihe der ausprobierten Produkte war zwischenzeitlich immer länger geworden: von den ›Notfallpillen‹ Xanax und Stilnox über das gängige Seropram zum allgemein bekannten und beliebten Fluctine bis zu den schweren Geschützen Anafranil, Tolvon und Nefadar.
Dr. B. mahnte mich, meinen inneren Widerstand gegen die Krankheit aufzugeben. Er mache sich große Sorgen, denn ich sei völlig verkrampft und versuche pausenlos, gegen meinen Zustand anzukämpfen, anstatt mich einfach gehenzulassen. Mich gehenlassen! Das hieß doch nichts anderes, als nur noch dasitzen und vor mich hin starren, so, wie ich das bei einigen Patienten auf der Abteilung gesehen hatte. Sie saßen im Korridor, im Gemeinschaftsraum oder auf der Terrasse, kaum ansprechbar, gefangen in sich selbst und in Gedanken, die nur sie verstanden. Wenn überhaupt. Bedauernswerte Kreaturen.
Eine Frau beschäftigte sich stundenlang nur mit ihren Fingernägeln. Immer wieder von neuem begutachtete sie mit Akribie jeden einzelnen Finger, starrte die Nägel beschwörend an, zerrte an den Nagelhäutchen, rieb sie mit einem Tuch sorgfältig ab und wenn sie alle kontrolliert hatte, fing sie wieder von vorne an. Zuerst die linke, dann die rechte Hand. Sie hatte sehr schöne Hände. Mir fiel dabei zu meinem Schrecken auf, daß ich seit einiger Zeit ebenfalls bei jeder sich bietenden Gelegenheit meine Fingernägel begutachtete. Was hatte das zu bedeuten? Gehört wiederholtes Betrachten der Fingernägel zu den Symptomen einer Depression? Es sah ganz so aus, als sei ich nicht mehr Herr über mich. Entglitt ich mir selber? Seit längerem fühlte ich mich zudem völlig hin- und hergerissen zwischen übertriebener Beachtung meines Körpers und totaler Gleichgültigkeit. Das wöchentliche Körpertraining hatte ich aufgegeben. Dafür irritierten mich kleinste Veränderungen, wie offene Stellen der Schleimhaut im Mund oder ein hartnäckiger Fußpilz. Das konnte alles nur eine Folge der Medikamente sein, davon war ich überzeugt. Es sah ganz so aus, als ob mein Körper immer weniger Abwehrstoffe mobilisierte. Hinzu kam eine Veränderung der Sehschärfe. Meine Brille, die ich tagsüber trug, mußte ich von einem Tag auf den andern mit der Brille, die ich üblicherweise nur am Schreibtisch benötigte, austauschen. In meinem Kopf hatte sich offensichtlich nicht nur mein Gehirn, sondern auch die Mechanik meiner Augenfunktionen verschoben. Das würde sich alles wieder einpendeln, wenn ich die Medikamente nicht mehr benötigte, hatte man mir zugesichert. Würde ich die jemals nicht mehr benötigen? Und wann würde das sein?
Dr. N. meinte, ich solle mich einfach entspannen, mir Zeit nehmen. Ich reagierte gereizt und sagte, ich könne doch nicht einfach den ganzen Tag dasitzen und zum Fenster rausschauen. Genau das solle ich tun, erwiderte sie. Schauen Sie zum Fenster hinaus, genießen Sie die Aussicht, einfach so. Genießen? Ich konnte doch schon längst nichts mehr genießen. Was sollte dieser absurde Ratschlag? Der Blick aus meinem Fenster auf die wunderschöne Gartenanlage, die Bäume dahinter, den Hügel mit dem Weideland für ein knappes Dutzend Schafe und, weiter entfernt, auf den See, von dem ein kleiner Teil zwischen den Bäumen zu sehen war, konnte nichts in meiner Seele bewirken. Die Vorstellung, mich dem schwarzen Loch in meinem Kopf auszuliefern, nur noch dazusitzen, gedankenlos, hirnlos, rief eine unbeschreibliche Angst in mir hervor. Ich würde mich an diesen Zustand gewöhnen, davon war ich überzeugt, und nie mehr zurückfinden in die sogenannte Normalität. Ich würde nur noch dahinvegetieren. Nein, das konnte, das wollte ich nicht. Offenbar war noch ein letzter Rest von Wille in mir vorhanden, dagegen anzukämpfen. Nur wogegen? Und Hoffnung? Nein, Hoffnung keine. Leider nicht.
Ich fühlte mich kraftlos, müde und verzweifelt. Dr. B. und Dr. N. verabschiedeten sich. Ich blieb apathisch im Zimmer zurück, ging zum Fenster und blickte hinaus. Eine dicke, ältere Frau schlurfte durch den Garten und reklamierte laut vor sich hin. Sie verschwand aus meinem Blickfeld. Ich konnte ihr nicht folgen, denn dazu hätte ich das Fenster öffnen müssen. Aber der eine Flügel war fest verschlossen und der andere in Kippstellung fixiert. Lebenserhaltende Maßnahmen. Ich war wütend über diese Einschränkung meiner Bewegungsfreiheit. War ich nicht schon genug Gefangener meiner selbst? Jetzt hatte ich das Gefühl, auch noch Gefangener der Klinik zu sein, obwohl die Zimmertüre nicht abgeschlossen war und ich jederzeit ein- und ausgehen konnte. Wie lange würde ich das wohl noch aushalten? Dieses Abgeschnittensein von allem, ein Ausgestoßener, wertlos, hilflos. Von mir aus hätte man die Verriegelung entfernen können. Doch keinem der Patienten war zu trauen, auch wenn sie sich noch so normal verhielten. Dazu gehörte nun auch ich. Patient Lyssy, Abteilung F2, Besuchszeit von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr täglich, auch am Wochenende. Ich legte mich aufs Bett und starrte zur Decke.