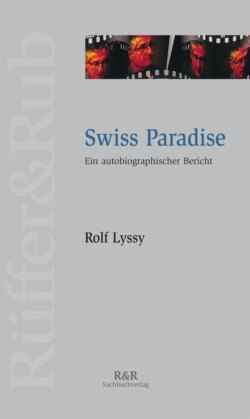Читать книгу Swiss Paradise - Rolf Lyssy - Страница 8
Оглавление4
Dr. B. hatte mir zugestanden, daß ich die Station tagsüber jederzeit verlassen könne, allerdings mußte ich dem Pflegepersonal mitteilen, wann ich wieder zurücksein würde. Er empfahl mir jedoch, nur nach Hause zu gehen, wenn ich Dringendes zu erledigen hätte. Hatte ich. Das Dringende bestand, außer dem Leeren des Briefkastens, im Abhören des Telephonbeantworters.
Freunde erkundigten sich besorgt nach meinem Befinden. Die einen versprachen wieder anzurufen, die anderen baten um Rückruf. Und genau das machte mir zu schaffen. Seit Beginn der Krise bemühten sich Freunde, jeder auf seine Art, zu helfen, mir Ratschläge zu geben, Trost zuzusprechen, Mut zu machen. Erfolglos. Ich war desensibilisiert für jede Art von Zuspruch, hatte keine Kraft und keinen Willen, um irgendwie zu reagieren. Und das allerschlimmste: Ich realisierte ihre Besorgtheit und manchmal auch ihre tiefe Hilflosigkeit, wenn sie merkten, daß ihre Versuche zu helfen nicht fruchteten. Daraus resultierte ein quälendes Schuldgefühl, das sich vom Kopf bis in die äußersten Nervenenden meiner Glieder ausbreitete. Ich fühlte mich schuldig, weil ich meine Freunde enttäuschte. So sagte mir Verena G., eine enge, langjährige Freundin, nach einem gemeinsamen Abendessen verzweifelt, sie wolle mich wieder so erleben wie früher, und sie meinte damit, lebensfroh, humorvoll, mitfühlend, mitteilsam. Und in ihrer Stimme lag fast auch so etwas wie unterdrückte Wut. Nicht gegen mich gerichtet, sondern gegen das Unfaßbare, das mich eisern umklammert hielt. Ich blieb ihr die Antwort schuldig. Was sollte ich denn sagen? Daß wohl nichts daraus würde? Daß ich nie mehr der sein würde, der ich mal war? Der Schmerz und die Angst, die solche Gedanken in mir auslösten, waren unbeschreiblich. Ich war wie gelähmt. Gelähmt, obwohl ich mich bewegen konnte, gelähmt im Kopf und in der Seele.
Jürg holte mich regelmäßig Sonntagnachmittags zu Hause ab und dann fuhren wir für ein, zwei Stunden in unser Stammcafé im Seefeldquartier. Manchmal war auch Adrian M., ein gemeinsamer Freund, mit dabei. Er hatte mir Dr. B. empfohlen. Ohne sein Drängen wäre ich kaum in die Klinik eingetreten. Das Vertrauen zu einem Freund ist von unschätzbarem Wert. Das spürte ich jetzt, in dieser abgrundtiefen Vertrauenskrise, die ein Teil der Depression war, ganz besonders. Ich war dankbar für das Zusammensein, mir aber gleichzeitig jede Sekunde bewußt, wie weit ich von allem, was mit Normalität, mit Alltag zu tun hatte, und dazu gehörte auch ein entspanntes Gespräch mit Freunden, entfernt war. Nur schon, bis ich mich zu einem Entscheid durchgerungen hatte, was ich zu trinken bestellen sollte: Espresso oder Cappuccino, nein, lieber Tee, ist gesünder, oder doch ein Mineralwasser, ja, ein Mineralwasser, das sprudelt so lebendig, halt, noch einmal nachdenken, vielleicht täten mir Vitamine gut, ein Orangensaft, aber den hatte ich doch schon am Morgen… oder eine heiße Schokolade…? Hätte Jürg nicht einfach kurzentschlossen für uns beide je einen Milchkaffee bestellt, ich wäre in meiner unbeschreiblichen Verunsicherung buchstäblich eingegangen. Er nahm auf meinen Zustand, dessen Tragweite ihm als Psychoanalytiker mehr als geläufig war, keine falsche Rücksicht. Er berichtete unbeschwert von seinem Alltag, wie die Woche verlaufen war, wie er mit seinem neuen Buchmanuskript vorankam. Aber ich konnte nicht mithalten, hatte das Gefühl, das Gedächtnis verloren zu haben. Aus lauter Verlegenheit und Scham stammelte ich dann jeweils irgendwas vor mich hin. Einerseits war ich erleichtert, wenn das Gespräch beendet war und ich mich verabschieden konnte. Anderseits schmerzte mich jedesmal die Trennung, besonders von Menschen, die mir lieb waren. Ich fühlte mich allein gelassen, verstossen, mir selber ausgeliefert. Was für ein Irrsinn. Hatte mich die Depression zu dem gemacht, als das ich mich jetzt empfand: ein durch und durch verzweifeltes, von Schuldgefühlen geplagtes, nur noch negativ empfindendes, hilfloses Monster? Nein, so wollte ich nicht mehr weiterleben. Im Wäscheschrank versteckt lag die kleine automatische Pistole mit Munition, die wir vor bald fünfundzwanzig Jahren für die Dreharbeiten zu meinem zweiten Spielfilm Konfrontation gekauft hatten. Es handelte sich um die Waffe, mit der die Hauptfigur einen Mord beging. Nicht irgendeine Figur, nicht irgendein Mord.
Ein politisches Attentat für die einen, ein gemeines, kaltblütiges Verbrechen für die anderen. Der 27jährige Rabbinersohn David Frankfurter, aus Vinkovci, einer Stadt im Norden Kroatiens, hatte am 4. Februar 1936 in Davos den Landesgruppenleiter der NSDAP in der Schweiz, Wilhelm Gustloff, in dessen Wohnung erschossen. Es war das erste Attentat im Ausland gegen einen Repräsentanten des Naziregimes seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Frankfurter hatte in Bern Medizin studiert und das Überhandnehmen faschistischer und antisemitischer Aktivitäten in der Schweiz mit zunehmender Besorgnis registriert. Dazu kam, daß er seit seiner Kindheit an einer chronischen Knochenmarkerkrankung litt, die immer wieder operative Eingriffe nötig machte, und er infolge der ständig wiederkehrenden Schmerzen heftigen Stimmungsschwankungen unterworfen war. In dieser psychisch angeschlagenen Verfassung beschloß er, sich umzubringen, aber nicht ohne einen prominenten Naziführer mit in den Tod zu nehmen. Er wollte seine Tat als einen Protestakt gegen das, was in Deutschland mit den Juden geschah, verstanden haben. So kam es zum Mord in Davos. Nachdem Frankfurter den ersten Teil seines Planes ausgeführt hatte, war er jedoch nicht in der Lage, die Waffe auch gegen sich zu richten, und stellte sich der Polizei. Im Dezember des gleichen Jahres fand sein aufsehenerregender Prozeß in Chur statt, an dem das nazistische Deutschland durch einen prominenten Zivilkläger und eine große Schar parteigesteuerter Zeitungsleute unübersehbar vertreten war. Frankfurter wurde zu achtzehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Tat fand im In- und Ausland große Beachtung, und viele solidarisierten sich mit ihm. Für sie war das Attentat ein Signal, ein Aufschrei gegen die Greueltaten der Nazis in Deutschland. Ein Akt des Widerstandes, durch den sich auch die Frage nach der Legitimation des Tyrannenmords stellte. Frankfurter wurde kurz nach Kriegsende durch die Bündner Kantonsregierung begnadigt.
Was Steven Spielberg in seinem eindrucksvollen Film Schindler’s List als Epilog in einem Friedhof in Israel zeigte, nämlich den Wechsel von den fiktiven Figuren zu den echten Überlebenden, hatte ich, als Epilog in meinem Film, bereits zwanzig Jahre früher vorweggenommen. In einer langsamen Überblendung verwandelte sich das Gesicht des Schauspielers Peter Bollag in das vierzig Jahre ältere Gesicht des authentischen David Frankfurter, der in den letzten Minuten des Films noch persönlich einiges über sein Leben und seine damalige Tat erzählte.
*
Jetzt saß ich in meinem Arbeitszimmer. Plötzlich wurde für mich die kleine automatische Pistole, mit welcher im Film Frankfurter Gustloff niedergestreckt hatte, zu einem Symbol für Unabhängigkeit und Freiheit oder, vielleicht besser, für Erlösung. Ich mußte sie nur mit scharfer Munition laden und die befand sich in einer Metallkassette. Durchziehen, an die Schläfe setzen und abdrücken. Linke oder rechte Schläfe? Ich hatte von Selbstmordkandidaten gelesen, die sich in die Schläfe geschossen und trotzdem überlebt hatten. Blind und hirngeschädigt für den Rest ihres Lebens. Wäre die Stirn sicherer? In der Mitte, zwischen die Augen, etwas oberhalb der Nasenwurzel. Ich wußte es nicht. Oder Herzschuß? Das mußte doch todsicher sein. Oder doch nicht? Was, wenn ich das Herz nicht treffen würde? Die Schmerzen, die Panik, die Angst und auch die Scham, wenn ich halbtot überleben würde, für immer gezeichnet, möglicherweise behindert, abhängig von fremder Hilfe, vielleicht sogar im Koma. Nur noch ein vegetierender Körper an Schläuchen. Jetzt vegetierte ich auch, aber ich konnte mich wenigstens bewegen und selbständig ernähren. War das schon der ganze Unterschied? Ich ließ schließlich die Pistole dort, wo ich sie seit eh und je versteckt hielt, ohne daß jemand davon wußte, zuhinterst im Wäscheschrank, unter Kissenbezügen, die nicht mehr gebraucht wurden.
Die makabren Phantasien ließen in ihrer Intensität keineswegs nach. Im Gegenteil, alle möglichen Arten eines ›unheimlich starken Abgangs‹ gingen mir täglich durch den Kopf. Die Pulsadern aufschneiden, vergiften, vergasen, aufhängen, ersäufen, Kurt nachahmen und vor den Zug springen. Und es gab noch eine Variante: mit dem Auto einen Unfall vortäuschen. Am besten eine Schnellstraße, ich würde den Wagen auf gut 140 km/h beschleunigen, im richtigen Moment ungebremst frontal in einen Baum rasen. Das würde mit Sicherheit tödlich sein und unter der Rubrik ›unerklärliche Verkehrsunfälle‹ irgendwann zu den Akten gelegt werden. Wie seinerzeit der erfolgreiche, landesweit beliebte Radrennfahrer Hugo Koblet, Idol meiner frühen Jugend, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere tödlich verunglückte, als er mit seinem Sportwagen in einen Baum raste. Gewollt, ungewollt? Das blieb für immer sein Geheimnis.
Dabei hatte es mich schon vor knapp einem Monat ungewollt beinahe erwischt. Ich hing zu Hause an einer Klimmstange, die in einem Türrahmen montiert war, mit den Knien eingehakt, Kopf nach unten. Eine Entspannungsübung, mit der ich seit vielen Jahren mein häusliches Turnprogramm abschloß. Ich hatte die Augen geschlossen und spürte das angenehme Pochen des Blutes in den Schläfen. Und dann, ich wußte nicht, wie mir geschah, stürzte ich im freien Fall zu Boden und schlug mit dem Gesicht ungebremst auf die hölzerne Türschwelle. Für wenige Sekunden mußte ich das Bewußtsein verloren haben. Als ich die Augen öffnete, meinte ich zuerst zu träumen. Ich lag nackt am Boden, in einer großen Blutlache. Voller Schrecken realisierte ich, daß ich alles andere als träumte. Die Stange hatte sich gelöst. Ich tastete in panischer Angst meinen Kopf ab und dachte an einen Schädelbruch. Der Kopf schien jedoch unverletzt zu sein. Aber woher kam diese Unmenge Blut? Ich griff zur Nase und merkte, daß dort nicht mehr alles so war, wie es hätte sein sollen. Langsam stand ich auf, wankte benommen ins Badezimmer und schaute in den Spiegel. Der Nasenrücken war aufgeschlagen, ich sah einzelne Knochensplitter herausragen und das Blut lief unaufhörlich aus der klaffenden Wunde und den Nasenlöchern. Ich wurde ganz ruhig und merkte, daß ich erstaunlicherweise keine Schmerzen verspürte. Ich stopfte Watte in die Nasenlöcher, wusch mir das Blut vom Körper und fuhr mit einem Taxi in die Notfallklinik. Ein Arzt diagnostizierte eine massive Zertrümmerung des Nasenbeins, bei der auch die Schleimhäute in Mitleidenschaft gezogen worden waren, und meinte, das sei zweifellos ein Fall für die Wiederherstellungschirurgie. Inzwischen war Dominique eingetroffen, die ich, bevor ich in die Klinik gefahren war, angerufen hatte, um zu sagen, daß ich nicht zu unserem geplanten Treffen kommen könne, ich sei auf dem Weg ins Krankenhaus. Sie saß neben der Liege und schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf. Am späten Nachmittag wurde ich unter Vollnarkose operiert. Als ich Stunden später erwachte, sah ich als erstes Dominique neben meinem Bett. Irgendwann hielt sie mir einen Spiegel vors Gesicht: Meine Nase war eingegipst, verpflastert und die Haut unter den Augen dunkelblau verfärbt. Ich sah aus wie das auferstandene Phantom der Oper. Fünf Tage später wurde ich entlassen. Helen, meine Cousine, holte mich ab und brachte mich nach Hause. Sie hatte für die nächsten Tage vorsorglich Essen eingekauft. Ich war froh, denn ich hatte absolut kein Bedürfnis, verunstaltet wie ich war, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Erst jetzt im nachhinein wurde mir die ganze Tragweite des Unfalls bewußt. Das war doch ganz offensichtlich ein Wink mit dem Zaunpfahl gewesen. Nach dem psychischen Absturz war ich auch noch physisch auf die Nase gefallen. Ich hätte mir genausogut das Genick brechen können. Das hätte auch nach einem gewöhnlichen Unfall, so wie ich ihn geplant hatte, ausgesehen. Was für ein Schutzengel hatte da die Hand im Spiel gehabt? Durfte ich ein zweites Mal das Schicksal herausfordern? Die zwei Wochen, in denen ich durch den Gips und die Pflaster verunstaltet in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt war, vergingen zwar schnell. Aber zu meiner negativen Stimmung gesellte sich jetzt noch die bange Frage, wie sehr sich wohl mein Aussehen durch die operierte Nase verändert haben würde.
Unvorhergesehene Begegnungen versuchte ich schon seit längerem zu vermeiden. Sah ich unterwegs einen Bekannten, dann wechselte ich die Straßenseite oder versteckte mich hinter einem Baum, einer Hausecke oder verschwand in einem Geschäft, auch wenn ich gar nicht die Absicht hatte, etwas zu kaufen. Ich wollte absolut keine Kommunikation. Sie war für mich jedesmal mühsam und peinvoll. Antwortete ich auf die Frage nach meinem Befinden mit »nicht gut« oder gar mit »schlecht«, hatte das logischerweise weitere Fragen und schließlich gutgemeinte Ratschläge zur Folge, und das war mir unerträglich. Gleichzeitig wollte ich nicht abweisend oder unfreundlich sein. Die einen zeigten sich besorgt, versprachen anzurufen, und ich hoffte insgeheim, sie würden es nicht tun. Andere nahmen mir das Versprechen ab, mich bei ihnen zu melden, und ich wußte im selben Moment, daß ich ihren Wunsch nicht erfüllen würde. In der Zeit mit der Gipsmaske verkraftete ich darum paradoxerweise eine Begegnung leichter, denn die Unterhaltung drehte sich nur um mein sichtbares Problem, um Unfallhergang und Operation. Gutgemeinte Ratschläge waren unnötig, die Nase würde ja automatisch heilen, es war nur eine Frage der Zeit. Verletzungen am Körper sind sichtbar, greifbar, meßbar und damit erkenn- und behandelbar. Aber eine verletzte Seele? Es gab Momente, da hatte ich den absurden Wunsch, nur noch Körper zu sein, losgelöst von Geist und Seele, die mir eine unerträglich gewordene Realität vermittelten. Losgelöst von dem, was mich beinahe um den Verstand brachte, dem Wahrnehmen einer Umgebung, an der ich nicht teilnehmen konnte. Da war es doch besser, das Denken gleich abzuschalten, die Seele außer Betrieb zu setzen und den Körper seinem Schicksal zu überlassen. Vegetieren ohne Bewußtsein, warum nicht? Das konnte doch nicht schlimmer sein als das, was ich jetzt erlebte. Und mein Gedächtnis? Hätte ich dann überhaupt noch eines? Es ließ mich jetzt schon beinahe vollumfänglich im Stich. Nein, es war absurd, sich Unmögliches herbeizuwünschen. Ich konnte weder aus meiner Haut noch aus meinem Geist und schon gar nicht aus meiner Seele. Ich konnte mich nicht wegdividieren. Ich war ich, und was immer geschehen würde, ich mußte es durchstehen, durchleben. Ich mußte? Ja, ich mußte, solange in mir auch nur der kleinste Funke von Lebenswille glimmte. Die Alternative war, Maßnahmen zur endgültigen Verabschiedung zu treffen und dementsprechend zu handeln. Es war die einzige Alternative. Es gab nur entweder oder, und nichts dazwischen.
Nach zwei Wochen wurde der Gips entfernt. Der Professor hielt mir einen Spiegel vors Gesicht. Erleichtert stellte ich fest, daß sich die ursprüngliche Form meiner Nase eher zum Vorteil verändert hatte. Die angeborene Krümmung des Nasenrückens war nicht mehr so stark. Wenig fehlte, und meine markant jüdisch gebogene Nase hätte einem ebenso markant griechisch-römischen Profil Platz gemacht. Da hatte offensichtlich ein Chirurg bewiesen, daß er sein Handwerk virtuos beherrscht. Ich war froh, keinen bleibenden Schaden davongetragen zu haben.
Wurde dadurch meine Stimmung besser? Schöpfte ich neue Hoffnung? Gab mir dieses Glück im Unglück neuen Auftrieb? Nein. Im Gegenteil, der sogenannte Grübelzwang, wie dieses unaufhörliche Rotieren der Gedanken bezeichnet wird, hatte an Intensität zugenommen. Und es war offensichtlich, daß die Medikamente, die ich bis jetzt bekommen hatte, keine Wirkung zeigten. Ich begann mich zu fragen, ob ich einen Versuch mit dem vielgepriesenen Johanniskraut wagen sollte. Doch Pfingsten kam dazwischen und der unerträgliche Gedanke, alleine in der großen Wohnung das verlängerte Wochenende zu verbringen, hatte mich in die Klinik gebracht.