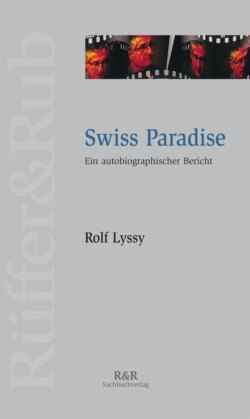Читать книгу Swiss Paradise - Rolf Lyssy - Страница 9
Оглавление5
Die Ergotherapeutin gab sich alle Mühe, mich von der Notwendigkeit ihrer Behandlung zu überzeugen. Sie saß mir gegenüber in meinem Zimmer und redete auf mich ein. In Gedanken war ich ganz woanders. Die Eingangsuntersuchung zwei Tage zuvor hatte gezeigt, daß ich gegenüber meinem normalen Gewicht sechs Kilo leichter geworden war. Davon abgesehen war ich nach Auskunft des Klinikarztes offensichtlich gesund. Das Abklopfen der verschiedenen Reflexzonen, das Tasten nach versteckten Schwellungen der Lymphknoten, das Überprüfen von Blutdruck, der Beweglichkeit der Gelenke, Lungenfunktion und die Kontrolle, ob ein Leistenbruch vorhanden sein könnte – in meinem Alter nicht außergewöhnlich – zeigten nichts Anormales. Mein Körper schien intakt zu sein. Aber sechs Kilo weniger, das bedeutete Untergewicht. War ja auch kein Wunder. In den letzten drei Monaten hatte ich nicht mehr richtig gegessen. Zum Kochen hatte ich keine Lust gehabt. Seit Ausbruch der Depression schien ich mein ganzes Kochwissen praktisch vergessen zu haben. War das ein weiteres Zeichen für einen Gedächtnisschaden? Längst konnte ich nur mit Mühe rekonstruieren, was ich am Tag zuvor gemacht hatte. Das waren die Momente, in denen ich mir sagte, ist ja im Grunde egal, bald werde ich mich definitiv verabschieden und dann spielt es keine Rolle mehr, ob meine Erinnerung noch funktioniert oder nicht.
Jedenfalls war es eine Erleichterung, in der Klinik essen zu können. Montags wurde die neue Speisekarte aufgehängt und so konnte man sich über die Mittag- und Abendmenüs der Woche informieren. In einem mannshohen zweitürigen Metallkasten wurden die Tellergerichte von einem kräftigen großgewachsenen Schwarzen mit Rastafrisur jeweils mittags und abends auf die Station gefahren. Die Mahlzeiten waren meistens zufriedenstellend zubereitet, aber die Essenszeiten waren unmöglich. Um halb zwölf wurde das Mittagessen serviert und um halb sechs das Abendessen. Ich war es gewohnt, abends zwischen sieben und acht Uhr zu essen, mittags aß ich nie. Wegen meines Gewichtsproblems beschloß ich, auch am Mittag eine Mahlzeit zu mir zu nehmen. Panikartig stopfte ich jeweils das Essen in mich hinein, als ob es eine Rolle gespielt hätte, wie schwer ich bei meiner Himmelfahrt sein würde. Die Widersprüchlichkeit meines Verhaltens war mir nicht bewußt. Ich aß, um wieder zu Kräften zu kommen, um zu leben, und gleichzeitig war ich unglücklich, gefrustet, gestreßt, verkrampft, durch und durch sauer, wegen der unmöglichen Essenszeiten, manchmal wegen des Essens selbst, wegen der Umgebung, wegen der Tatsache, daß ich hilflos und ohnmächtig meinem Schicksal ausgeliefert war. In den ersten zwei, drei Wochen aß ich in meinem Zimmer, ich wollte niemanden sehen. Später gesellte ich mich im Eßraum zu den anderen Patienten, allerdings ohne viele Worte zu wechseln. Eigentlich keine. Dabei spielten sich pantomimische Szenen ab. Außer einem leisen »En Guete« und den Eßgeräuschen war nichts zu hören. Was mich nicht hinderte, meine Mitpatienten verstohlen zu beobachten. Mir gegenüber saß ein junger Mann, mit eingebundenen Händen und Armen, der seine Finger kaum bewegen und nur mit größter Mühe essen konnte. Er hatte Verbrennungen dritten Grades erlitten und die Haut an seinen Armen und Händen war transplantiert. Die Folge einer Explosion des Außenbordmotors auf einem Boot, hatte man mir gesagt. War das etwa ein mißlungener Suizidversuch gewesen? Vielleicht. Warum sonst war er hier auf dieser Abteilung für Himmelfahrtskandidaten? Ich wagte nicht zu fragen. Sein Gesicht hatte mehrere gravierende Verbrennungsnarben und die Ohrmuscheln waren teilweise plastisch nachmodelliert. Ich dankte insgeheim dem Schicksal für die unsichtbar verheilte Nasenverletzung. Lieber zehn Knochenbrüche als eine Verbrennung dritten Grades. Solche Schmerzen mußten unerträglich sein. Verbrennen würde ich mich nie.
Am Tisch nebenan saßen zwei Frauen, Zimmergenossinnen, und sprachen kein Wort miteinander. Jede stocherte apathisch im Essen herum. Die eine ließ den halbvollen Teller schließlich stehen und stierte wortlos vor sich hin. Ich fragte mich, ob ihr Verhalten wohl auf die Wirkung der Medikamente zurückzuführen war? Würde ich irgendwann auch mal so dahinvegetieren? Bekam sie die gleichen Tabletten wie ich? Und wenn ja, in welcher Dosis? Die Dosis macht das Gift, der Satz von Paracelsus fiel mir ein. War ich etwa schon vergiftet, ohne es zu wissen? Wenn ich im Stationszimmer jeweils morgens und abends meine Tabletten holte, lagen dort in den länglichen vierfach unterteilten (morgens/mittags/abends/nachts) Kunststoffschälchen die Portionen der Patienten. Die einen mußten weniger, andere mehr schlucken als ich. Das ging von einer bis zehn, zum Teil verschiedenen Pillen, pro Person, pro Tag. Ich lag mit vier im guten Mittelfeld. Aber vielleicht waren ja vier auch schon zuviel? Ich hatte mit Dr. B. bereits mehrmals über die Dosis gestritten, aber man kann sich nicht für Chemie entscheiden und dann verlangen, daß die Dosis so niedrig angesetzt wird, daß die Wirkung ausbleibt.
Die Ergotherapeutin erkannte, daß ich mit meinen Gedanken ganz woanders war, was sie aber nicht sonderlich beeindruckte. Sie wiederholte geduldig ihr Angebot. Zweimal in der Woche, morgens anderthalb Stunden zusammen arbeiten, ohne Zwang, ohne Druck, was immer mir zusagen würde. Mit Holz, Papier, Karton oder auch mit Gips, Ton oder Plastilin. Dabei könne ich jederzeit auch über meine Probleme reden. Ich weiß nicht, was sie noch alles hätte aufzählen können: Stoff, Gummi, Polyester, Metall, Wasser, Beton, Schleim oder Scheiße – es interessierte mich keinen Deut. Ich hatte null Bock, irgendwelche Materialien zu bearbeiten. Und zu reden hatte ich auch nichts mit ihr. Über was sollte ich denn reden? Sollte ich ihr meine Filmographie erzählen? Das würde sie mit Sicherheit zu Tode langweilen. Sollte ich ihr über Hoffnungen, Enttäuschungen, Verletzungen, Krisen in meinen früheren Beziehungen berichten? Über die Trennung von meiner Frau? Dann würde sie denken, aha, klassischer Fall einer Depression, deren Ursache offensichtlich in einer narzißtischen Kränkung liegt. Über dieses Thema hatte ich doch längst eingehend mit Dr. K. und dann, nach dem Eintritt in die Klinik, mit Dr. B. und seiner Assistentin Dr. N. gesprochen. Auch eine der Damen vom Pflegepersonal war höchst interessiert gewesen zu erfahren, wie ich bis jetzt mit meinem Leben fertig- oder eben nicht fertig geworden war. Die wenigen Gespräche, zu denen sie mich nachgerade zwingen mußte, bestanden zur Hauptsache aus einem zusammenhanglosen Gestammel meinerseits. Und das, weil ich ganz und gar kein Bedürfnis verspürte, immer wieder Unbewältigtes und Schmerzvolles aus dem Trüben meiner Vergangenheit hervorzuholen. Die Gespräche mit den Ärzten reichten mir vollauf. Im Grunde genommen hatte ich absolut keine Lust zu reden. Mit niemandem, ich wollte schweigen. Und jetzt sollte ich mich einer weiteren fremden Person anvertrauen, ihr Vertrauen schenken? Ich hatte ja zu mir selber seit Monaten alles Vertrauen verloren. Wie konnte ich ihr etwas geben, was ich selber nicht besaß? Immer wieder schielte ich auf ihre Füße, die in anthroposophisch geformten Gesundheitssandalen steckten. Es war nicht zum Aushalten. Warum sie nicht einfach rausschmeißen? Eine innere Stimme, die zeitweise das Chaos meiner zwanghaften Grübeleien durchbrach, sagte, Rolf, sei doch nicht so aggressiv, sie meint es gut, sie will dir helfen, sie kennt sich aus auf diesem Gebiet. Schenk ihr etwas Vertrauen. Du mußt dich ja nicht für ewig verpflichten, wenn es dir nicht mehr paßt, kannst du jederzeit aufhören. Es wird dir mit Sicherheit nicht schaden. Das sagte die Stimme. Meine Stimmung dagegen hätte mich am liebsten auf den Boden kotzen lassen. Das jedoch wollte ich mir und der Therapeutin, die mich mit forschendem Blick unentwegt musterte, nicht antun. Hin- und hergeschüttelt zwischen einem immer schlechter werdenden Gewissen ihr gegenüber, den Ärzten und dem Pflegepersonal, die das natürlich alles rapportiert bekommen würden, und dem Gefühl einer abgrundlosen Hilflosigkeit, sagte ich ihr schließlich mit stockenden Worten, daß ich an ihrer Therapie nicht interessiert sei. Sie verzichtete auf weitere Überzeugungsarbeit, verabschiedete sich, freundlich, aber kurz, sagte noch: »Wenn Sie Ihre Meinung ändern, melden Sie sich ungeniert beim Pflegepersonal«, und schloß die Tür hinter sich. Kaum war sie draußen, öffnete ich die Türe wieder. Bei geschlossener Türe hielt ich es nur in der Nacht aus, wenn ich schlief. Ich spürte ein schwaches Gefühl von Befriedigung. Ich hatte gewonnen. Keine Ergotherapie. Die Physiotherapie reichte mir vollauf. Da konnte ich mich hinlegen und zwei kräftige deutsche Frauenhände massierten meinen Rücken. Und das jeweils eine gute Dreiviertelstunde. Aber auch diese Kneterei war nach meinem Empfinden lediglich ein angenehmer, entspannender Zeitvertreib. Ich fragte mich, ob alle diese Therapien zu guter Letzt nur dazu da waren, die Zeit zu vertreiben? Das bedeutete doch nichts anderes, als daß weder die Chemie noch die Psychiatrie mir helfen konnten. Ein quälendes Angstgefühl machte sich bemerkbar und ließ mein Herz schneller schlagen. Ich wußte, ich war mir selber überlassen und gleichzeitig spürte ich, das konnte nicht gutgehen. Wie soll man sich denn selber helfen, wenn kein Antrieb, kein Wille, keine Hoffnung mehr vorhanden sind?