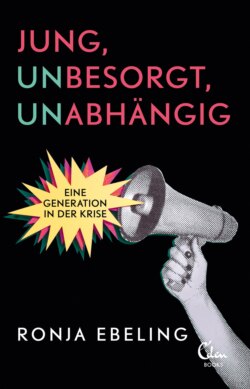Читать книгу Jung, besorgt, abhängig - Ronja Ebeling - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwei Tickets, ein Konzert
ОглавлениеDer Soziologe Aladin El-Mafaalani erklärt die Gründe dafür in einem anschaulichen Bild.22 Stell dir eine Konzerthalle vor. Zu Beginn des Konzerts stehen die Menschen noch ganz normal vor der Bühne, und sie können abhängig von ihrer Körpergröße gut oder weniger gut auf die Bühne blicken. Früher haben die Menschen durchmischt einen Real-, einen Hauptschulabschluss oder Abitur gemacht und konnten damit gut oder weniger gut weitermachen. Einige gingen an die Universität, andere machten eine Ausbildung. Mein Vater zum Beispiel hat nach seinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Anschließend konnte er sich ein Studium nur finanzieren, weil er es neben dem Vollzeitjob an einer Abendschule gemacht hat. Ein Auslandssemester, wie es heute als selbstverständlich gilt, wäre gar nicht möglich gewesen. Sich den Zugang zu Bildung erst mal zu erarbeiten, war damals schon anstrengend.
Heute können viele junge Menschen die Anforderungen, die in der Schule und später von Firmen an sie gestellt werden, aus eigener Kraft gar nicht mehr erfüllen. Ganz gleich wie sehr sie sich anstrengen. Diese Anforderungen verstärken häufig nur die sich immer weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich. An dieser Stelle beginnen die Menschen auf dem Konzert sich auf Zehenspitzen zu stellen. Kleine Menschen oder jene, die einen schlechteren Platz haben, können dadurch weniger sehen. In Deutschland machen mittlerweile rund fünfzig Prozent der Menschen Abitur oder Fachabitur. Dementsprechend viele nehmen ein Studium auf. Im nächsten Schritt werden einige Menschen in der Konzerthalle von anderen auf die Schultern genommen. Dadurch können einige gar nicht mehr auf die Bühne gucken. Wenn ich ehrlich bin, saß auch ich bei diesem Bildungskonzert auf den Schultern meiner Eltern. Seit ich mit Mya befreundet bin, weiß ich, dass ich unter anderem ihr die Sicht genommen habe.
Ich war eine durchschnittlich gute Schülerin, aber hätte mein Abitur wegen meiner mangelnden Mathematikkenntnisse wohl eigentlich nicht geschafft. Unter meinen Klausuren stand allzu oft »ungenügend«. Letztlich habe ich mein Abitur nur, weil meine Eltern die finanzielle Möglichkeit hatten, mich zu zahlreichen Nachhilfeinstituten zu schicken. Dafür legten sie über die Jahre wohl echt viel Geld auf den Tisch. Am Ende des Schuljahrs brachte ich dadurch immerhin eine ausreichende Leistung in Mathe auf dem Zeugnis zustande und wurde eine Runde weitergelassen. Sicherlich war es auch ein Vorteil, dass ich deutsch und blond bin. Lehrkräfte sahen eine Identifikationsfigur in mir. Einmal sagte eine Lehrkraft bei der Notenvergabe auf dem Flur zu mir: »Ach, Ronja, du erinnerst mich immer an meine eigene Jugend. Ich war genau wie du!« Eine andere meinte zu mir, dass sie im Gefühl habe, dass ich mal irgendwas mit Sprache machen werde, weshalb sie mir einen Punkt mehr gab.
Mya schaute mich mit leerem Blick an, als ich ihr das erzählte. »So was hätte niemals jemand zu mir gesagt. Ich musste mir immer nur anhören, wie komisch es sei, dass mein Vorname mit Y geschrieben wird. Wie anders das sei, wie ungewohnt. Damit hat sich niemand identifiziert.«
Früher war mir nicht bewusst, dass ich auf meinem Bildungsweg von dem rassistischen System in Deutschland profitiert hatte. Wenn Lehrkräfte mich bevorzugten, habe ich den Pluspunkt gern eingesteckt. Wahrscheinlich tue ich es heute noch immer, ohne es direkt zu merken, denn die Berufswelt funktioniert schließlich nicht anders. Es wird Zeit, dass sich mehr Menschen dieses unverdiente Privileg eingestehen. Das ist unangenehm, und es löst ein beklemmendes Gefühl aus, aber es ist notwendig. Bei Myas Familie war es nämlich anders. Wir beide waren zwar auf demselben Konzert, aber hatten offensichtlich unterschiedliche Tickets erhalten.
Zurecht war Mya wütend darüber. Ihre Stimme klang belegt, als sie sagte: »Mein Bruder war auch schlecht in Mathe. Am Anfang hat ihm der Staat noch die Nachhilfe finanziert. Als seine Noten nicht besser wurden, haben sie uns die Leistung gestrichen, und er musste am Ende auf die Hauptschule wechseln. Damit war sein Schicksal klar.«
Laut dem Berufsbildungsbericht wird in vielen Ausbildungsberufen ein höherer Schulabschluss erwartet – obwohl Deutschland in vielen Bereichen einen akuten Mangel an Nachwuchskräften hat.23 Das ist absurd. Ein Mensch mit Hauptschulabschluss muss heute wesentlich mehr Bewerbungen schreiben als frühere Generationen. Die Anforderungen, die gestellt werden, sind umfassender und größer. Zudem scheinen Hauptschüler*innen einen neongrellen Zettel auf der Stirn kleben zu haben, auf dem ausschließlich schlechte Merkmale wie Antriebslosigkeit und Orientierungslosigkeit stehen. »Schublade auf, zack, rein, Schublade zu«, meinte Mya dazu. Mit großem Glück bekäme ihr Bruder vielleicht eine Anstellung in einem geringqualifizierten Beruf, zum Beispiel als Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, sagte sie, also in der Bäckerei oder Fleischerei. Er säße gerade an den Bewerbungen.
Laut dem Job-Futuromat von der Agentur für Arbeit sind aber bereits fünfzig Prozent der Kernaufgaben in diesem Beruf schon heute automatisierbar. In der Klempnerei sind es sogar siebzig Prozent, in der Fachgruppe für Fahrzeuglackierung über achtzig Prozent.24 Und dann? Die Wirtschaft arbeitet auf Hochtouren daran, verschiedene Arbeitsprozesse branchenübergreifend zu digitalisieren und zu automatisieren. Das hat ohne Frage auch Vorteile, zum Beispiel, dass schwerkörperliche Aufgaben nicht mehr so häufig von Menschen ausgeführt werden müssen. Bis wir das allerdings geschafft haben, sind wir auf junge Menschen angewiesen, die diese Berufe heute noch erlernen, obwohl es sie in einem Jahrzehnt womöglich in dieser Form nicht mehr geben wird. Diese Menschen dienen als Lückenbüßer. Während sich die Industrie feiert, weil sie mit kleinen Robotern spielen kann, fallen jene jungen Angestellten, die so froh waren, überhaupt eine Ausbildungsstelle gefunden zu haben, dann durch das Raster des Systems.
»Es wird immer gesagt, die Digitalisierung zerstöre doch keine Arbeitsplätze, sie verschiebe sie nur«, sagte Mya und verdrehte die Augen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine Berechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB): In einer bis 2035 voll digitalisierten Arbeitswelt könnten in Deutschland demnach fast 1,5 Millionen Jobs wegfallen. Es würden aber auch ähnlich viele Arbeitsplätze neu entstehen, heißt es so schön. So werden zum Beispiel Fachkräfte in der IT oder im allgemeinen Ingenieurwesen heute schon händeringend gesucht.25
»Ronny, jetzt mal ganz ehrlich: Werden die zahlreichen Umschulungen und Weiterbildungen von der Agentur für Arbeit dann aus einem Klempner einen IT-Experten machen? Oder aus einer Bäckereifachverkäuferin eine Ingenieurin?«, fragte Mya mich mit großen Augen und griff über den Tisch nach meiner Hand, als hinge die Zukunft von meiner Antwort ab. Sie machte sich Sorgen um ihren kleinen Bruder.
»Ich … ich denke, das wird in den wenigsten Fällen wirklich passieren«, gestand ich ehrlich und drückte ihre Hand.
Es ist nicht so, dass die heute jüngeren Generationen die Ersten sind, deren Berufe durch den Fortschritt der Digitalisierung gefährdet sind. Das ist bereits vielen älteren Arbeitnehmer*innen passiert, die nun die letzten Jahre bis zur Rente zählen. Daraus sollten wir lernen und die Digitalisierung tatsächlich zu einer Chance für alle machen – auch für Menschen in gering qualifizierten Berufen. Die jungen Menschen, die heute noch eine Ausbildung in zukünftig größtenteils automatisierten Berufen machen, gleichen in unserer Gesellschaft oft Laborratten, die auf den letzten Metern der Digitalisierung ausgeschlachtet werden. Sie dienen nur noch zur Überbrückung. Das hört sich brutal an, zumal sie von diesem Experiment oft gar nichts wissen. Dafür hätten sie nämlich bei dem Bildungskonzert einen besseren Platz haben müssen, womit wir wieder am Anfang wären.
Auf der Terrasse vor dem mexikanischen Restaurant war es kalt geworden. Die Weinflasche war leer. Mya hielt noch immer meine Hand. »Was soll bei diesem Ellbogenkampf der Wohlhabenden der nächste Schritt sein, wenn schon heute so viele auf die Schultern der Eltern klettern?«, fragte sie leise. Ihre Augen waren plötzlich glasig vom Wein, von der Angst. Wir hatten zu viel getrunken. Ich hatte keine gute Antwort auf ihre Frage, sondern schaute sie einfach nur an. Wohl wissend, dass ich zu den Privilegierten, zu den Profitierenden gehörte.
»Keine Ahnung«, sagte ich fast lautlos.