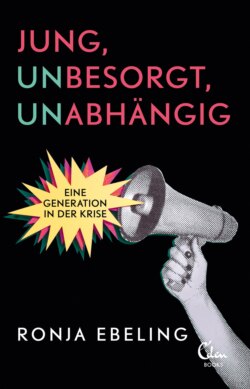Читать книгу Jung, besorgt, abhängig - Ronja Ebeling - Страница 5
ОглавлениеIch war 14 Jahre alt, als ich entschied, dass ich von nun an mein eigenes Geld verdienen wollte. Laut der Deutschen Bahn war ich ab diesem Zeitpunkt nämlich kein Kind mehr. Wenn ich mit meiner Freundin Pia nach Krefeld fahren wollte, um dort durch die kleinen Läden in der Nähe des Bahnhofs zu stöbern, kostete das plötzlich ein Vermögen. Pia und ich verbrachten regelmäßig unsere Nachmittage in den schlauchförmigen Shops, probierten High Heels an und kauften am Ende doch die gefälschten Converse-Verschnitte für zehn Euro. Zu Hause bemalte ich die lilafarbenen Schnürschuhe mit Edding und zog bunte Schnürsenkel durch die Ösen. Meine Eltern sahen es irgendwann nicht mehr ein, mir dafür Geld in die Hand zu drücken.
»Ihr müsst ja nicht ständig nach Krefeld fahren«, sagte meine Mutter und betonte, dass unsere katholische Kleinstadt ja auch ein paar schöne Läden habe. Sie stopfte gerade im Hauswirtschaftsraum die Waschmaschine voll, als ich sie nach Geld für das Bahnticket fragte.
»Hier? Hier gibt’s nur Kerzengeschäfte oder Klamottenläden für Omas!« Ich verzog das Gesicht.
»Die Sachen aus den Oma-Läden halten wenigstens! Die Sohle von deinen komischen Schuhen ist schon wieder durch. Können die nicht mal in die Tonne?« Sie zeigte auf das Loch in meinen Fake-Converse, die vor dem Schuhschrank lagen.
»Sicher nicht!«, rief ich, schnappte die Schuhe und schlüpfte hinein. Die viel zu langen, neonpinken Schnürsenkel wickelte ich mir mehrfach um den Knöchel. »Dann suche ich mir jetzt eben ’nen Job!«
Mama schmunzelte. »Du bist 14, da findest du keinen Job …«
»Du hast doch keine Ahnung, ich regle das schon«, antwortete ich ihr selbstsicher. Schließlich war ich laut der Deutschen Bahn jetzt erwachsen, da würde ich doch wohl auch einen Job finden!
An diesem Tag setzte ich mich mit dem typischen Trotz eines Teenagers auf mein grünes Holländerfahrrad namens Anton und fuhr in die Innenstadt unserer Kleinstadt. »Bitte nicht Prospekte austeilen oder so einen Mist!«, rief mir meine Mutter noch hinterher. Sie hatte Angst, dass das am Ende an ihr hängen bleiben würde. In unserem Wohngebiet liefen ständig irgendwelche Eltern in Regenjacken mit Zeitungswagen durch die Gegend und schmissen bunte Prospekte in die Briefkästen. »Mein Sohn hat heute ein Fußballspiel«, erklärten sie dabei und winkten fröhlich. Meine Mutter hatte dafür kein Verständnis. »Niemals teile ich für euch Zeitung aus, damit das klar ist! Sucht euch andere Jobs«, sagte sie meinem Bruder Robin und mir jedes Mal, wenn sie diese Eltern sah.
Das mit der Jobsuche war allerdings gar nicht so einfach. Ich fragte in der ganzen Stadt nach Arbeit: im Blumengeschäft, in der Bäckerei, in Cafés, in Restaurants, in Hotels. Die meisten schüttelten lediglich den Kopf, nur hier und da schrieb jemand meine Kontaktdaten auf, um sie an die Geschäftsleitung weiterzugeben. »Ich mache wirklich alles! Ich bin total motiviert!«, bettelte ich. Enttäuscht, dass ich nicht direkt eine Zusage bekommen hatte, fuhr ich nach ein paar Stunden wieder nach Hause.
Die Arbeitswelt hatte ich mir anders vorgestellt. Meine Mutter versuchte, mich mit den Worten zu trösten, dass ich in meinem Leben noch genug arbeiten würde, aber das wollte ich nicht hören. »Toll …«, brummte ich nur. Es nervte mich, dass ich meine Eltern ständig nach Geld fragen musste. Mit 14 wollte ich diese Abhängigkeit nicht mehr. Ich wollte möglichst schnell erwachsen werden.
Während ich auf dem Sofa saß und schmollte, klingelte das Telefon. Meine Mutter nahm ab. Als sie wieder auflegte, drehte sie sich überrascht zu mir um und sagte: »Du kannst morgen um achtzehn Uhr in die Fleischerei zum Probeputzen.« Ich weiß noch genau, wie sie mich in diesem Augenblick musterte, gespannt auf meine Reaktion. Ein Test.
Ich starrte sie ungläubig an. Dann jubelte ich los. »Mega! Ha, ich hab’s doch gesagt!«
Von da an sortierte ich in der Fleischerei zweimal die Woche nach Ladenschluss die Wurst im Kühlraum, schrubbte das eingetrocknete Blut aus den Lagerwannen und machte den Fleischwolf sauber. Ich polierte die Glastheke, wischte den Boden, brachte den Müll raus. Dafür bekam ich fünf Euro die Stunde und war ziemlich stolz darauf.
Dieses Gefühl änderte sich erst, als ich in der Schule mal zufällig neben einem Mädchen aus der Parallelklasse saß. Meine Tischnachbarin trug einen perfekt zurückgekämmten Ballettdutt, während mein unordentlicher Zopf von meinem letzten Experiment mit einer orangefarbenen Schaumtönung aus der Drogerie fleckig leuchtete. »Findest du es nicht eklig, da zu putzen?«, fragte das Mädchen mich. Ich guckte sie irritiert an und spürte gleichzeitig, wie mein Stolz einen tiefen Kratzer bekam. Ratsch.
Dabei mochte ich den Job in der Fleischerei: Die Frauen, die dort mit mir arbeiteten, waren wirklich nett. Ich durfte beim Putzen Musik hören. Ich verdiente mein eigenes Geld. Die Dinge, die ich mir kaufte, bekamen dadurch einen anderen Wert.
Als mir meine Mitschülerin diese Frage stellte, begann ich allerdings zu ahnen, dass es verschiedene Arten von Berufen gab. Es gibt Berufe, die einen schlechten, und solche, die einen guten Ruf haben. Es gibt Berufe, um die man beneidet wird, und andere, für die man bemitleidet wird. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob der Job die ihn ausübende Person erfüllt oder nicht. Berufe bringen einen Stempel mit sich.
Der Versuch von Politik und Wirtschaft, eher negativ bewerteten Berufen durch eine andere Bezeichnung einen neuen Anstrich und damit mehr gesellschaftliche Wertschätzung zu verleihen, ist in den meisten Fällen leider nicht gelungen. Von einem Facility Manager ist eigentlich nur in der offiziellen Stellenausschreibung die Rede. Das gesellschaftliche Bild von Hausmeister*innen hingegen ist geblieben, genauso wie das der Person, die nach Ladenschluss in der Fleischerei putzt.
Nach einem Jahr erhielt ich die Möglichkeit, am Wochenende zusätzlich im Service eines Hotelbetriebs im Nachbardorf zu arbeiten. Woche für Woche fuhr ich mit dem Bus dorthin und saß dabei ganz aufrecht, damit meine Bluse nicht verknitterte. Das Arbeitsklima im Hotel war wesentlich schlechter als das in der Fleischerei, der Job machte weniger Spaß. Dort bekam ich ebenfalls fünf Euro die Stunde. Das Trinkgeld haben sich die Hauptkellner*innen eingesteckt, ohne es mit den Leuten in der Küche oder mir zu teilen. Auf der Arbeit durfte ich nur Leitungswasser trinken. Wenn ich mir mal einen kleinen Schluck Apfelsaft einschenkte, gab es Ärger. Einmal machte mich meine Chefin darauf aufmerksam, dass sich mein BH durch die weiße Bluse abzeichnete. Sie stellte mich dafür vor einen Spiegel im Flur und zeigte mit dem Finger auf meinen kaum vorhandenen Brustansatz. »Sehen Sie das?« Reflexartig hob ich meine Hände, erschrocken darüber, dass jemand meine Brüste wahrnahm. Bisher hatte ich gedacht, sie würden niemandem auffallen. »Sie ziehen damit die Missgunst von Ehepartnerinnen auf sich, wenn der männliche Gast Sie deswegen anlächelt«, erklärte meine Vorgesetzte mir. Ich verstand die Welt nicht mehr und wollte einfach nur aus dieser peinlichen Situation fliehen. Ein anderes Mal drohte meine Chefin damit, »mir in die Fresse zu schlagen«, sollte ich die Türklingel überhören. Als ich sie daraufhin wie ein Auto anstarrte und mir nicht sicher war, ob ich sie auch wirklich richtig verstanden hatte, korrigierte sie sich scheinheilig: »Nein, nein, dann haue ich Ihnen auf die Finger!«
»Das hat sie gesagt?«, fragte meine Freundin Pia schockiert. Es war große Pause, wir wanderten über den Schulhof.
»Ja, ich hab mich mega erschrocken. Die Frau ist so komisch, das macht echt keinen Spaß. Neulich habe ich das Spielzeug ihrer Kinder sortieren müssen, als keine Gäste da waren«, erzählte ich.
Pia zuckte mit den Schultern: »Na ja, aber ist entspannter als Putzen, oder?«
Ich überlegte, während ich meinen großen Zeh durch das Loch in meinen gefälschten Converse-Schnürern bohrte. Meine Mutter hatte sie am Vortag in den Müll geworfen, aber ich hatte sie schreiend wieder rausgeholt. »Mhm«, machte ich nur. Ich war irritiert. Die Arbeit im Hotel brachte das gleiche Geld, machte aber im Vergleich zum Putzen in der Fleischerei weniger Spaß. Trotzdem wurde sie insgesamt besser bewertet. In den Augen der anderen war der Hoteljob eine Art Upgrade. Irgendwie komisch, dachte ich mir. Damals verstand ich das Bewertungssystem, den Wert und die Rolle von Arbeit in unserer Gesellschaft noch nicht.
Wenn ich heute auf einer privaten Party bin, zwischen Weißwein und Bier hin und her wechsle und weiß, dass ich davon am nächsten Tag Kopfschmerzen haben werde, fange ich gern Gespräche mit Fremden an. Ich will in ihre Welt eintauchen und ihre verrücktesten Geschichten hören. Leider dauert es bei diesen Gesprächen normalerweise nicht lange, bis die andere Person mir folgende Frage stellt: »Was machst du eigentlich?«
Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Ich mache vieles und an manchen Tagen auch gar nichts. Ich balanciere gern auf Bordsteinkanten und esse gern Reiswaffeln mit Leberwurst. Ich höre beim Fahrradfahren laut Musik und erschrecke mich manchmal, wenn ein Auto nah an mir vorbeifährt. Mich nervt es, wenn andere sagen, dass es gefährlich sei, auf dem Fahrrad Kopfhörer zu tragen. Das ist mir egal. Meinen Kaffee trinke ich schwarz und kippe jedes Mal einen Schuss kaltes Leitungswasser rein, weil ich zu ungeduldig bin, darauf zu warten, dass er etwas abgekühlt ist. Am Sonntag mag ich mein Frühstücksei wachsweich, mit viel Salz. Ich telefoniere fast jeden Tag mit meiner Mutter, an manchen sogar zweimal. Ja, all diese Dinge tue ich regelmäßig, und trotzdem ist relativ klar, dass die Person auf der Party mit ihrer Frage auf etwas ganz anderes abzielt. Sie möchte wissen, was ich beruflich mache.
Obwohl ich meine Arbeit in der Medienbranche liebe, bekomme ich bei dieser Frage Bauchschmerzen. Sie suggeriert, dass mein Beruf mich definiert. Und das möchte ich nicht.
Für die meisten Menschen in Deutschland ist die Erwerbsarbeit die Grundlage ihrer Existenz. Zusätzlich bietet sie Wertschätzung, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und gibt das Gefühl dazuzugehören. Ein gewisses Pensum an Arbeit soll sogar psychischen Erkrankungen vorbeugen können. So geben viele Menschen in Umfragen an, dass sie selbst dann noch einen kleinen Nebenjob ausüben würden, wenn sie eigentlich finanziell abgesichert wären.1 Arbeit gibt uns Beschäftigung. Und die braucht der Mensch.
Arbeit definiert aber auch auf eine komische Art und Weise unseren Platz in der Gesellschaft. Sie kann uns belasten und krank machen. Sie kann uns beherrschen und in Maschinen verwandeln. Verlieren wir unsere Arbeit, kommt oft auch ein großer Teil unserer gesellschaftlichen Identität ins Wanken. Es gibt viele Gründe dafür, warum hierfür besonders junge Menschen gefährdet sind. So habe ich es zum Beispiel auch erlebt, als ich am Ende meiner journalistischen Ausbildung beschloss, das Übernahmeangebot meiner damaligen Redaktion nicht anzunehmen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich wusste, wie es danach weitergehen würde. Während dieser Monate wurde durch die Frage, was ich eigentlich so mache oder als Nächstes machen wollte, jedes noch so lockere Gespräch zu einem Kraftakt. Die Frage wurde mir in dem Verlag gestellt, wo ich tätig war, von meiner Familie und von Freund*innen. Das war anstrengend. Denn es erfordert viel Energie, sich von Zukunftsfragen und Zukunftsängsten nicht lähmen zu lassen. Offen zuzugeben, dass man keinen Plan hat. Und das in einer Gesellschaft, in der man immer einen Plan haben und ganz genau wissen sollte, wo man hinwill im Leben.
In dieser Zeit nervten mich Gespräche, die sich um Arbeit drehten, ganz besonders. Wenn ich auf einer Parkbank saß und mich von den Unterhaltungen vorbeilaufender Menschen berieseln lassen wollte, musste ich leider oft feststellen, dass der Großteil der Spaziergänger*innen über die Arbeit sprach. Es ging um einen nervenden Teamkollegen, die biestige Chefin oder Projekte, die den Erzählenden den Schlaf raubten. »Das ist echt anstrengend«, beschwerten sie sich. Einige sagten auch: »Ich halte das nicht mehr lange aus, ich werde kündigen!« Ich saß dann auf meiner Bank, aß ein Franzbrötchen und hätte am liebsten mit vollem Mund hinterhergerufen: »Machst du eh nicht!«
Es ist wahr, Arbeit bestimmt unser Leben. Dabei wünschen sich viele eigentlich eine Pause: Jede*r Zweite würde gern ein Sabbatical machen, also zeitweise etwas Abstand vom Job gewinnen. Der Großteil gibt dabei an, dass er oder sie endlich Zeit für sich selbst und die eigenen Interessen haben möchte.2 Das leuchtet ein. Bei einer Woche, die aus 35 bis 40 Stunden Erwerbsarbeit plus Überstunden und unbezahlter Care-Arbeit besteht, bleibt nicht mehr viel Zeit für die eigenen Bedürfnisse. Dabei zeigte 2019 eine Studie von Forschenden der britischen Universitäten Cambridge und Salford, dass eigentlich acht Stunden Erwerbsarbeit pro Woche ausreichen würden, um die positive Wirkung von Erwerbsarbeit auf unsere Psyche zu erzeugen: Der Mensch fühlt sich gebraucht, ist beschäftigt, kann sich selbst verwirklichen und bekommt Anerkennung. In der restlichen Zeit kann er sich auf seine eigenen Bedürfnisse konzentrieren, sich in kulturellen Bereichen weiterbilden und sich um seine Mitmenschen kümmern.3 Diese Überlegung ist für viele eine bloße Wunschvorstellung. In der Realität sind wir weit davon entfernt.
Die Wahrheit ist nämlich, dass nur sehr privilegierte Menschen privat nach Möglichkeiten suchen können, um Zeit für sich selbst freizuschaufeln: durch eine Putzhilfe oder externe Kinderbetreuungsangebote zum Beispiel. Oder einfach dadurch, dass die Arbeitsstunden reduziert werden, weil unterm Strich genug verdient wird. Die gesellschaftliche Mehrheit ist jedoch im System gefangen und muss wöchentlich viele Stunden arbeiten, um sich das eigene Leben finanzieren zu können. Einige haben sogar mehrere Jobs.
In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich die Zahl der Nebenjobber*innen laut der Bundesagentur für Arbeit hierzulande verdreifacht. Mehr als drei Millionen Menschen üben neben dem Hauptberuf noch einen weiteren Job aus. Laut den Forschenden tue der Großteil das, weil das Einkommen aus einem Job nicht mehr ausreiche.4 Es gibt aber auch einige, die einen Zweitjob haben, obwohl ihr Hauptjob sie ausreichend über Wasser hält. Das habe ich auch jahrelang gemacht.
Während ich kurzzeitig studierte, arbeitete ich parallel im Friseursalon an der Rezeption, in einer Kinderkochschule und schrieb für ein Onlinemagazin. Ach ja, und Babysitting habe ich damals auch noch gemacht.
»Warum machst du das alles?«, hatte mich einmal meine Freundin Clara aus der Uni gefragt. Es war Freitagabend, wir saßen in ihrer Küche, und sie schnippelte Brokkoli, ihr Hauptnahrungsmittel. In ihren Augen wäre es leichter gewesen, einfach in einem Job die Stunden hochzuschrauben, statt in so vielen unterschiedlichen Betrieben zu arbeiten.
»Das wäre sowohl langweiliger als auch anstrengender für mich«, erklärte ich ihr. Ich konnte mir nicht vorstellen, jeden Tag mit kleinen Kindern in der Küche zu stehen, aber auch nicht, nur noch im Friseursalon der Hamburger High Society den Hintern hinterherzutragen. »Ich finde den Mix ganz gut. Außerdem mache ich mich so weniger abhängig.«
Sie guckte mich fragend an.
»Na ja, sollte mir ein Job nicht mehr gefallen, fällt es mir viel leichter zu gehen, weil ich nicht auf ihn angewiesen bin. So habe ich mehrere Standbeine«, erklärte ich meine Strategie.
In meinem Umfeld beobachte ich oft, dass viele einen Job machen, der sie eigentlich schon längst nicht mehr fordert oder erfüllt. Aber die Befürchtung, keine andere Option zu haben, lähmt sie. Manchmal ist es auch Bequemlichkeit. Das will ich nicht. Heute arbeite ich in der Medienbranche und möchte nach wie vor immer die Möglichkeit haben, aus freien Stücken den aktuellen Job an den Nagel zu hängen, wenn ich mich nach etwas anderem sehne oder es sich einfach nicht mehr richtig anfühlt.
Sich nicht von dem Einkommen aus einem einzigen Job abhängig machen zu wollen, würden manche als Bindungsangst betiteln. Das wird meiner Generation ja eh gern nachgesagt.
»Mit einem Arbeitsvertrag gehen doch beide Parteien eine Bindung ein«, versucht mir auch mein Vater ständig zu erklären. Viele aus seiner Generation haben jahrzehntelang für ein und denselben Betrieb gearbeitet. Mittlerweile ist das wegen befristeter Verträge aber anders.
»Dieses Papier ist oft nichts weiter als ein einseitiges Versprechen«, erwidere ich in diesen Gesprächen stets kritisch. Es ist keine Beziehung auf Augenhöhe, wie ich sie mir wünsche. Vielmehr versuchen Arbeitnehmer*innen, es ihren Arbeitgeber*innen in allem recht zu machen: Sie leisten Überstunden bis spät in die Nacht, stellen ihre persönlichen Bedürfnisse hinten an, verleugnen oft ihre eigene Meinung, um ja nicht negativ aufzufallen, und verlieren damit übrigens auch einen entscheidenden Teil ihrer Motivation. Und das alles nur, weil sie entfristet oder nicht gekickt werden wollen. Weil sie wissen, dass sie abhängig sind, und sich sorgen, ihre Rechnungen in Zukunft nicht mehr bezahlen zu können. Die Angst, den Job zu verlieren, ist für viele Menschen ein ständiger Begleiter. Auch für die jungen – nur wird sie uns oft abgesprochen.