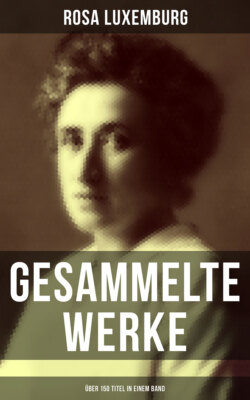Читать книгу Gesammelte Werke (Über 150 Titel in einem Band) - Rosa Luxemburg - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Zu Anfang, als die Zahl der Gläubigen noch klein war, war eine eigentliche Geistlichkeit gar nicht vorhanden. In jeder Stadt sammelten sich die Gläubigen, bildeten eine selbständige religiöse Gemeinde und wählten jedesmal einen der Brüder aus ihrer Mitte, der den Gottesdienst leitete und die religiösen Handlungen ausführte. Jeder Gläubige konnte damals Bischof oder Presbyter werden, es waren dies zeitlich begrenzte Ämter, die keine Macht vergaben außer der, mit der die Gemeinde sie freiwillig ausstattete, und sie waren völlig unbezahlt. In dem Maße jedoch, wie die Zahl der Bekenner wuchs und die Gemeinden immer größer und reicher wurden, wurden die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten und das Abhalten der Gottesdienste zu einer Beschäftigung, die viel Zeit und völlige Hingabe erforderte. Da einzelne christliche Brüder mit diesen Aufgaben neben ihrem privaten Beruf nicht mehr fertigwerden konnten, begann man also, Gemeindemitglieder für geistliche Ämter als ausschließliche Tätigkeit zu wählen. So kommt es, daß solche Beamte schon dafür, daß sie sich den Angelegenheiten der Kirche und der Gemeinde widmeten, irgendeinen Lohn erhalten mußten, der ihnen zum Leben genügte. So entstand innerhalb der christlichen Gemeinde eine neue Schicht: aus der Menge der Gläubigen sonderte sich der besondere Stand der kirchlichen Beamten ab – die Geistlichkeit. Neben der Ungleichheit zwischen Reichen und Armen entstand eine neue Ungleichheit zwischen Geistlichkeit und Volk. Obwohl sie anfangs aus ihnen gleichberechtigten Bekennern zur zeitweiligen Vertretung der Gemeinde im kirchlichen Dienst gewählt waren, erhoben sich die Geistlichen bald zu einer Kaste, die über dem Volk stand. Je mehr christliche Gemeinden in allen Städten des großen römischen Reiches entstanden, desto stärker fühlten die von Regierung und Andersgläubigen verfolgten Christen das Bedürfnis, sich untereinander zusammenzuschließen, um ihre Kräfte zu vergrößern. Die verstreuten Gemeinden beginnen, sich zu einer Kirche auf dem ganzen Reichsgebiet zu vereinigen, aber das ist schon jetzt hauptsächlich ein Zusammenschluß nicht des Volkes, sondern der Geistlichkeit. Im 4. Jahrhundert nach Christus beginnen die Geistlichen der einzelnen Gemeinden, regelmäßig auf Konzilen zusammenzukommen; das erste derartige Konzil fand 325 in Nicäa statt. Dadurch wurde der enge Zusammenschluß der Geistlichen zu einem vom Volk abgesonderten Stand vollendet. Gleichzeitig waren auf den Konzilen natürlich die Bischöfe der mächtigsten und reichsten Gemeinden führend unter den Geistlichen, und deshalb stand der Bischof der christlichen Gemeinde der Stadt Rom bald an der Spitze der ganzen Christenheit, als Haupt der Kirche, als Papst. So entstand die ganze Hierarchie der Geistlichkeit, die sich immer mehr vom Volk absonderte und sich immer höher über es erhob. Gleichzeitig änderte sich auch das ökonomische Verhältnis zwischen Volk und Geistlichkeit. Früher war alles, was reiche Kirchenmitglieder der Gemeinschaft opferten, als Fonds für das arme Volk betrachtet worden. Dann begann man, aus eben diesem Fonds einen immer größeren Teil dafür abzuzweigen, die Geistlichkeit zu bezahlen und die Bedürfnisse der Kirche zu bestreiten. Als Anfang des 4. Jahrhunderts das Christentum in Rom zur herrschenden, d.h. zur einzigen vom Staat anerkannten und unterstützten Religion ausgerufen wurde und die Christenverfolgungen aufhörten, fanden die Gottesdienste nicht mehr in unterirdischen Höhlen oder bescheidenen Kammern statt, sondern man begann, immer prächtigere Kirchen zu bauen. Die Ausgaben dafür verminderten den Fonds für die Armen immer mehr. Schon im 5. Jahrhundert nach Christus wurden die Einkünfte der Kirche in vier gleiche Teile aufgeteilt, von denen einen der Bischof erhielt, einen die übrige niedere Geistlichkeit, einer für Bau und Erhaltung der Kirchen abging und nur ein vierter für die Unterstützung des armen Volkes verwendet wurde. Das ganze christliche Armenvolk erhielt zusammen jetzt nur noch so viel wie der Bischof allein. Und mit der Zeit hörte man überhaupt auf, einen bestimmten Teil für die Armen bereitzustellen. Je reicher und mächtiger die Geistlichkeit wurde, desto mehr verlor das Volk der Gläubigen jede Kontrolle über Besitz und Einkünfte der Kirche. Die Bischöfe verteilten so viel an die Armen, wie es ihnen gefiel. Das Volk erhielt schon damals Almosen von seiner Geistlichkeit.
Aber das ist noch nicht das Ende. Waren anfangs alle Gaben der Gläubigen für die christliche Allgemeinheit freiwillig, so begann die Geistlichkeit mit der Zeit, besonders, seit die Religion Staatsreligion geworden war, zwangsweise Gaben zu fordern, und das von allen Gläubigen, begüterten und unbegüterten. Im 6. Jahrhundert wurde von der Geistlichkeit eine besondere Kirchenabgabe eingeführt: der Zehnte (d.h. die zehnte Kornähre, das zehnte Stück Vieh usw.). Diese Abgabe fiel als neue Last auf die Schultern des Volkes und wurde später im Mittelalter eine Gottesgeißel für die armen, durch Fronarbeit ausgepreßten Bauern. Mit dem Zehnten wurde jeder Zollbreit Land, jedes Gut belegt, und der Fronbauer mußte ihn im blutigen Schweiße seines Angesichts für die Herren abarbeiten. Jetzt erhielt das arme Volk nicht nur keine Hilfe und Unterstützung von der Kirche, sondern im Gegenteil, die Kirche verband sich mit den anderen Ausbeutern und Schindern des Volkes: mit Fürsten, Landadel und Wucherern.
Als im Mittelalter das arbeitende Volk durch die Fron in immer größere Not fiel, bereicherte sich die Geistlichkeit immer mehr. Außer den Einkünften aus dem Zehnten und anderen Abgaben und Zahlungen erhielt die Kirche zu jener Zeit riesige Schenkungen und Vermächtnisse von frommen Reichen oder reichen Wüstlingen beiderlei Geschlechts, die sich durch reichliches Vermächtnis an die Kirche in ihrer letzten Stunde von ihrem sündigen Leben loskaufen wollten. Geld, Häuser, ganze Dörfer samt Fronbauern, einzelne Renten und Arbeitsleistungen, die zum Land gehörten, wurden der Kirche geschenkt und vermacht. So sammelten sich in den Händen der Geistlichkeit riesige Reichtümer an. Und jetzt hörte der Klerus schon auf, Verwalter des ihm anvertrauten Besitzes der Kirche, d.h. der Gemeinde der Gläubigen und zumindest der armen Brüder zu sein. Im 12. Jahrhundert verkündete die Geistlichkeit schon offen und stellte es als scheinbar aus den Worten der heiligen Schrift herleitbares Recht dar, daß aller Reichtum der Kirche nicht Eigentum der Gemeinschaft der Gläubigen sei, sondern privates Eigentum der Geistlichkeit und vor allem ihres Oberhauptes, des Papstes. Geistliche Ämter waren somit der beste Weg, große Einkünfte und Reichtümer zu erwerben, und jeder Geistliche, der über den Besitz der Kirche wie über sein Eigentum verfügte, stattete seine Verwandten, Kinder und Enkel mit vollen Händen aus. Da die Kirchengüter sich dadurch beträchtlich verminderten und in den Händen der Familien der Geistlichen zusammenschmolzen, befahlen die Päpste also in ihrer Sorge, den Reichtum im Ganzen zu erhalten, und indem sie sich zu obersten Eigentümern des ganzen Kirchenbesitzes erklärten, der Geistlichkeit den Zölibat, d. h. die Frauenlosigkeit, um zu verhindern, daß der Besitz durch Vererben gemindert wurde. Der Zölibat wurde ursprünglich schon im 11. Jahrhundert eingeführt, aber wegen des großen Starrsinns der Priester allgemein erst Ende des 13. Jahrhunderts angenommen. Damit die Kirche auch nicht den geringsten Teil des Reichtums aus den Händen ließe, gab Papst Bonifatius VIII. 1227 einen Erlaß heraus, der jeglichem Geistlichen untersagte, ohne Erlaubnis des Papstes weltlichen Menschen Schenkungen aus seinen Einkünften zu machen.
So häufte die Kirche in ihren Händen unermeßliche Reichtümer an, besonders Grundbesitz. In allen christlichen Ländern wurde die Geistlichkeit zum größten Grundbesitzer. Gewöhnlich besaß sie den dritten Teil der ganzen Ländereien im Staate, manchmal noch mehr. Nicht nur auf allen Königs-, Fürsten- und Adelsgütern mußte also das Landvolk außer seiner Fronarbeit den Zehnten für die Geistlichkeit abarbeiten, auch auf den ganzen riesigen Flächen der Kirchengüter arbeiteten Millionen von Bauern und Hunderttausende von Handwerkern unmittelbar für die Bischöfe, Erzbischöfe, Domherren, Pröbste und Klöster. Unter den Fronausbeutern des Volkes war im Mittelalter, zur Zeit des Feudalismus, die Kirche der mächtigste Herr und Ausbeuter. Zum Beispiel besaß die Geistlichkeit in Frankreich vor der Großen Revolution, also gegen Ende des 18. Jahrhunderts, ein Fünftel des ganzen Bodens in Frankreich, aus dem sie ein jährliches Einkommen von ungefähr 100 Millionen Franken einstrich.
Die aus den Privatgütern eingenommenen Zehnten betrugen 23 Millionen. Davon wurden 2.800 Prälaten und Obervikare, 5.600 Äbte und Priore, 60.000 Pröbste und Vikare und in Klöstern 24.000 Mönche und 36.000 Nonnen ernährt und unterhalten. Dieses ganze Heer des Klerus war völlig frei von Abgaben und vom Kriegsdienst und gab nur in Jahren allgemeinen Unglücks wie Krieg, Mißernten, Seuchen, eine „freiwillige Abgabe“ an die Staatskasse, die jedoch niemals 16 Millionen Franken überstieg.
Die so begüterte Geistlichkeit bildete mit dem Fronadel zusammen einen Stand, der über das arme Volk herrschte und von seinem Blut und Schweiß lebte. Höhere Kirchenämter wurden als die einträglichsten immer dem Adel gegeben und in adeligen Familien gehalten. Auch deshalb hielt die Geistlichkeit zur Zeit der Fronarbeit überall mit dem Adel zusammen, unterstützte seine Herrschaft, zog zusammen mit dem Adel dem Volk das Fell über die Ohren und brachte es dazu, Not und Erniedrigung in Demut, ohne Murren und Widerspenstigkeit zu ertragen. Die Geistlichkeit war auch der erklärte Feind des Stadt- und Landvolkes, als dieses sich schließlich erhob, um in der Revolution die Fronausbeutung abzuschaffen und die Menschenrechte zu erringen. Allerdings gab es auch innerhalb der Kirchenhierarchie zwei Klassen: die höhere Geistlichkeit raffte den ganzen Reichtum an sich, der Masse der Landpfarrer aber gab man arme Pfarreien, die zum Beispiel in Frankreich jährliche Einkünfte von 500 bis 2.000 Franken einbrachten. Diese benachteiligte niedere Klasse des Klerus erhob sich auch gegen den höheren Klerus, und in der Großen Revolution, die im Jahre 1789 ausbrach, verbündete sie sich mit dem kämpfenden Volk gegen die Herrschaft des weltlichen und geistlichen Adels.