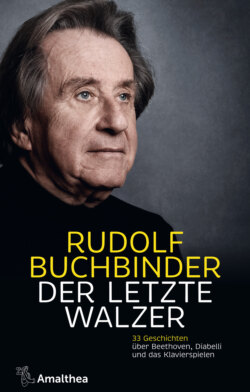Читать книгу Der letzte Walzer - Rudolf Buchbinder - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVariation Nr. 4
Wanderung durch Wien
1973, in den Berliner Teldec-Studios, war mir klar, dass ich neben den Beethoven-Variationen auch die 50 Variationen einspielen musste, die Anton Diabelli bei den großen Komponisten seiner Zeit – vorwiegend aus Österreich – in Auftrag gegeben und unter dem öffentlichkeitswirksamen Titel »Vaterländischer Künstlerverein« zusammengefasst hatte. Für mich sind die 50 Diabelli-Variationen in mehrfacher Hinsicht ein Schlüssel für die 33 Beethoven-Variationen. Zum einen, weil sie Beethovens herausragende Position unter Beweis stellen, zum anderen, weil sie eine Art Wanderung durch die Wiener Musiklandschaft der 1810er- und 1820er-Jahre darstellen. Sie lassen uns das Umfeld, in dem Beethoven sich bewegt hat, besser verstehen. Letztlich ist jede Walzer-Variation die musikalische Visitenkarte eines mehr oder weniger bekannten Tonsetzers der Beethoven-Zeit. Was mich bis heute besonders fasziniert, sind die Querverbindungen unter den Komponisten, die sich zum großen Teil natürlich kannten, die voneinander gelernt und sich miteinander ausgetauscht haben. 50 Persönlichkeiten, die das Musikleben Wiens erheblich beeinflusst, ja bestimmt haben.
Im Zentrum steht vielleicht der große Carl Czerny, der nicht nur eine Variation, sondern auch eine Coda zum Variationsband beigesteuert hat. Czerny wurde mit zehn Jahren Schüler Beethovens, spielte unter anderem die Wiener Erstaufführung des fünften Klavierkonzertes und schrieb später das Buch Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven’schen Klavierwerke und die unglaublich lesenswerten Erinnerungen an Beethoven. Beide Schriften haben einen so großen Eindruck auf mich gemacht, dass ich ihnen später noch ein eigenes Kapitel in diesem Buch widmen werde. Czerny ist so etwas wie ein Bindeglied zwischen den einzelnen Generationen der Diabelli-Komponisten. Er unterrichtete den jungen Franz Liszt und wurde selbst nicht nur von Beethoven, sondern auch von Johann Nepomuk Hummel unterrichtet, der ebenfalls eine der 50 Diabelli-Variationen beisteuerte.
Es lohnt sich, ein wenig bei Hummel zu verweilen, dessen Variation sehr viel über die Entwicklung der Musik in Wien erzählt. Hummel war Nachfolger von Joseph Haydn als Hofkapellmeister beim Fürsten Esterházy, verließ Eisenstadt allerdings im Streit. Zurück in Wien wurde Beethoven einer seiner besten Freunde, und 1819, also kurz bevor die Diabelli-Variationen im Druck erschienen, ging er als Hofkapellmeister nach Weimar, wo er 1837 starb.
Als ich die Diabelli-Variationen zum ersten Mal aufgenommen habe, stolperte ich über einen Text des Musikwissenschaftlers Ludwig Finscher, den ich damals in gekürzter Form auch für das Booklet verwenden durfte. Finscher vergleicht Hummels Diabelli-Variation mit Beethovens 12. Variation. Bei beiden beobachtet er die gleiche kompositorische Herangehensweise. Am Anfang steht ein Auftaktornament, auf das eine ländlerhafte Melodienwendung folgt. Finscher erklärt, warum Hummel (der für die Ausbildung zahlreicher Musiker in Wien und für den musikalischen Stil der Stadt mitverantwortlich war) zwar eine passable Variation erfand, aber eben nicht Beethovens Innovationsgeist erreichte. Auch auf die Gefahr hin, hier etwas musikwissenschaftlich zu werden, zitiere ich kurz Finschers Gedanken:
»Während Hummel diesen Einfall […] ganz am formalen Rahmen des Themas entlang komponiert, wenn auch harmonisch reich abgestuft und satztechnisch durchaus einfallsreich, zieht Beethoven aus der Isolierung des Motivs die musikalische Konsequenz, indem er in äußerst konzentrierter, zugleich aber den Gestus des Improvisatorischen in sich aufnehmender Arbeit das Motiv melodisch und harmonisch entwickelt, steigert, reduziert, ständig verwandelt, die Variation in der Variation also gleichsam potenziert und so einen ganz asymmetrisch gegliederten Satz von 46 Takten entfaltet, der mit dem Variationsthema konsequent nichts mehr gemein hat als das Kernmotiv, das seinerseits schon durch Variation gewonnen worden war.«
Um es kurz zu sagen: Während Diabellis Motiv Beethoven angeregt hat, die Variation an sich vollkommen neu zu erfinden, ja das Ursprungsthema durch verschiedene Variations-Durchläufe quasi aufzulösen, beschränkte Hummel sich darauf, das Thema genau bis an die Grenze des damals Üblichen zu führen. Das ist, was für mich die wahre Größe Beethovens ausmacht: Während fast alle 50 Komponisten, die Diabelli beauftragt hatte, sich mehr oder weniger in der üblichen kompositorischen Konvention aufhielten, hatte Beethoven keine Hemmungen, genau diese zu sprengen – nur dadurch konnte er wahres Neuland betreten.
Einen Gegenpol zu Hummels Variation stellt jene von Ignaz Moscheles dar, für mich einer der spannendsten der 50 Komponisten, der heute leider weitgehend vergessen ist. Moscheles kam aus Prag nach Wien, hat bei Georg Albrechtsberger und Antonio Salieri studiert und später seinen besten Freund, den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, unterrichtet. Moscheles’ Idol aber blieb zeitlebens Ludwig van Beethoven. Und das hört man seiner Variation auch an – ein simples Allegretto, das nicht angeben will, sondern durch sein Selbstbewusstsein überzeugt.
Wir sehen innerhalb der 50 Diabelli-Variationen drei Generationen des Wiener Musiklebens. Eine Flamme, die von Hummel über Czerny bis zum damals noch weitgehend unbekannten Franz Liszt weitergegeben wurde. Johann Nepomuk Hummel war, ebenso wie Antonio Salieri, Lehrer von Carl Czerny. Der wiederum nahm den jungen Liszt als Lehrer unter seine Fittiche und lag – davon darf man ausgehen – Diabelli sicherlich in den Ohren, auch den erst elfjährigen Schüler mit einer Variation zu beauftragen, um ihn in den erlauchten Kreis der großen Künstler aufzunehmen. Es verwundert deshalb nicht, dass Liszt seinem Lehrer Czerny später seine 12 Études d’exécution transcendante widmete.
Der junge Liszt war in Wien zum ersten Mal bei einem Konzert des Baron von Braun in Erscheinung getreten. Sein Vater erkannte das Talent des Sohnes früh und förderte es mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Adam Liszt hatte einen Großteil seines Hab und Guts verkauft, um Franz eine musikalische Ausbildung in Wien zu ermöglichen. Anfänglich wurde er dabei von seinem Dienstherrn Fürst Esterházy unterstützt. Doch bereits bevor die Diabelli-Variationen in Wien veröffentlicht wurden, gab Esterházy seine Unterstützung auf, und Vater und Sohn Liszt zogen nach Paris weiter, wo Franz in den Salons der französischen Hauptstadt endgültig der Durchbruch als »petit Litz« gelang.
In der Variation, die Liszt zu den Diabelli-Variationen beigesteuert hat, ist bereits viel seiner virtuosen Anlagen zu erkennen. Seine Variation in c-Moll setzt auf ungestüme Effekte, auf rasante Akkordbrechungen und das andauernde Übergreifen der Hände. Manchmal lässt mich diese, ja man könnte sagen »Angeber-Variation«, schmunzeln, wenn ich daran denke, wie auch der alte Franz Liszt in den Pariser Salons noch mit seinen Klavierkunststücken für Begeisterung sorgte. Franz Liszt ist für mich einer der größten Musiker, und wohl kaum jemand hat so viel für Beethoven getan wie er, allein durch seine Klavierbearbeitungen der Symphonien. Aber auch seine Ausgabe der Beethoven-Sonaten ist von unschätzbarem Wert. Unter anderem, weil er die originalen Fingersätze notiert hat. Ich ziehe die Liszt-Ausgabe der Klavierwerke Beethovens oft zurate, um Gewissheit über Details der Interpretation zu bekommen. Und es ist ein wunderschöner musikhistorischer Zufall, dass Franz Liszt durch die Diabelli-Variationen bereits mit elf Jahren im Beethoven-Kosmos auftritt.
Am Ende dieses Rundgangs durch das musikalische Wien des frühen 19. Jahrhunderts ist vielleicht noch ein kurzer Blick auf Franz Xaver Wolfgang Mozart aufschlussreich. Der Sohn des großen Mozart wird oft unterschätzt und hat, wie ich finde, eine durchaus anständige Variation zum Diabelli-Kanon beigetragen. Er gehörte neben dem Komponisten Gottfried Rieger übrigens zu den zwei Tonsetzern, die Diabelli vorsichtshalber zwei Variationen geschickt haben (aus denen der Verleger treffsicher die gelungenere für den Druck auswählte). Natürlich gelang es Franz Xaver Mozart nie, aus dem Schatten seines Vaters herauszutreten. Was mich immer wieder sehr berührt, ist der Nachruf von Franz Grillparzer (der ja auch anlässlich Beethovens Tod eine Gedenkrede verfasst hatte). Zum Tode Franz Xaver Mozarts schrieb Grillparzer: »Du warst die trauernde Zypresse an Deines Vaters Monument. Wovon so viele einzig leben, was Stolz und Wahn so gerne hört, des Vaters Name war es eben, was Deiner Tatkraft Keim gestört. Begabt, um höher aufzuragen, hielt ein Gedanke Deinen Flug: ›Was würde wohl mein Vater sagen.‹«
Worte, die mich auch deshalb ergreifen, weil sie verstehen lassen, wie unendlich schwer es gewesen sein muss, im Schatten eines Giganten wie Mozart gestanden zu haben.
Wenn ich die Diabelli-Variationen der 50 vornehmlich Wiener Komponisten spiele, ist das für mich immer auch ein kleiner Spaziergang durch das musikalische Wien, der sich – wenn man ehrlich ist – nicht immer zu ganz hohen Höhen aufschwingt, dafür aber Traditionen, Verbindungen, Schüler- und Lehrerverhältnisse, Konventionen und ihre Brüche aufzeigt. Die 50 Diabelli-Variationen sind ein Seismograf der Wiener Kulturlandschaft, aus ihnen lässt sich viel ablesen über Generationen, über Entwicklungen und die musikalische Stimmung, die in Wien geherrscht haben muss.
Ich will nicht verleugnen, dass eine Aufführung aller 50 Variationen hintereinander sowohl für den Interpreten als auch für das Publikum etwas ermüdend sein kann. Aber irgendwann passiert etwas Wunderbares: Es erklingt dieses unglaublich melancholische Sehnsuchtslied, eine Variation, die alle anderen überflügelt – die langsame c-Moll-Variation von Franz Schubert. Und weil sie so viel größer ist als alle anderen Variationen, sei ihr in diesem Buch später ein eigenes Kapitel gewidmet.