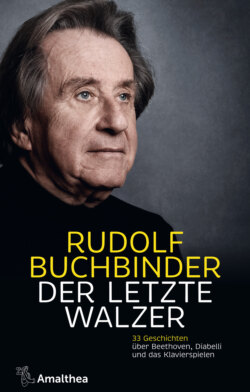Читать книгу Der letzte Walzer - Rudolf Buchbinder - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVariation Nr. 2
Für Elise und für Profis
Auf die Frage, wer Beethoven war, gibt es für mich keine klare Antwort: Beethoven war so vieles. Vor allen Dingen war er ein Kind seiner Zeit. Einer Zeit, die sich im andauernden Wandel befand. Ein Zustand, der mir als Kind der Nachkriegszeit unvorstellbar ist. Ich habe nur eine Staatsform kennengelernt, zum Glück war es die Demokratie. Auch meine Welt hat sich verändert, aber nie wurde sie derart aus den Angeln gehoben und infrage gestellt wie jene Welt, die Beethoven umgab.
Er wuchs in Bonn auf, wo die Kölner Kurfürsten Maximilian Friedrich und Max Franz eine aufgeklärte und liberale Politik betrieben, und ging 1792 nach Wien, das mit 250 000 Einwohnern durchaus schon eine Weltstadt war. Hier wurde der moderate Kaiser Leopold II. gerade von seinem Sohn Franz II. beerbt, der die humanistischen Reformen des Vaters schnell kassierte. Beethoven erlebte, wie Napoleon mit dem Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durch Europa tobte, er unterstützte den Franzosen als Hoffnungsträger des Humanismus, bis der sich am 2. Dezember 1804 selbst zum Kaiser krönte, und Beethoven – so das Wort, das man ihm in den Mund legt – angeblich erkannte, dass Napoleon auch nur einer sei »wie alle anderen«. Beethoven erlebte die Schlacht von Austerlitz, komponierte mit Wellingtons Sieg eine Art akustische Kriegsbeschreibung vom Untergang Napoleons bei Waterloo (bei der Uraufführung wirkten übrigens viele Komponisten der Diabelli-Variationen mit), er erlebte das Ende der alten europäischen Ordnung und die Neuordnung Europas beim Wiener Kongress, für den Österreichs Außenminister Metternich umgerechnet eine Milliarde Euro ausgab, um die Gäste aus aller Welt zu unterhalten. Das damalige Kulturangebot wurde unter anderem vom Walzerkönig Johann Strauß gestaltet, aber auch Beethoven gab in dieser Zeit drei erfolgreiche sogenannte Akademien und wurde zum Ehrenbürger Wiens ernannt.
All die existenziellen Umbrüche, die Beethoven erlebte, beeinflussten natürlich auch seine Musik. Am besten ist seine Zerrissenheit vielleicht am Titel der dritten Symphonie abzulesen, die Beethoven Bonaparte nannte, was er aber nach der eigenhändigen Kaiserkrönung Napoleons wieder zurücknahm.
Doch nicht nur die Zeitläufte bestimmen den Klang eines Komponisten, sondern auch dessen jeweilige Auftraggeber. Beethoven lebte von musikbegeisterten Zeitgenossen wie Graf Ferdinand von Waldstein, der ihn in Bonn unterstützte und 1792 seine Reise nach Wien finanzierte. Dort nahmen sich dann unter anderem Joseph von Lobkowitz und Karl von Lichnowsky seiner an. Das neue Bürgertum und der Adel waren die aufsteigende Klasse und verlangten – anders als zuvor die Kirche – Musik, die auffiel, die größer, radikaler und provokanter war als alles zuvor. Dennoch schrieb Beethoven natürlich auch für amtierende Machthaber und Könige, unter ihnen Zar Alexander I., Preußen-König Friedrich Wilhelm II., der König von Schweden und Erzherzog Rudolph. Zuweilen war aber auch die Liebe sein Auftraggeber, und er komponierte für Damen, die sein Herz gewonnen hatten, oder für musikalische Dilettanten, die sich in den Wiener Salons ein Stelldichein gaben. Außerdem spielte Beethoven regelmäßig auf den damals beliebten Klavierduellen, bei denen er andere Pianisten durch seinen Einfallsreichtum und seine technischen Qualitäten quasi von der Bühne fegte. All diese verschiedenen Auftraggeber bestimmten ebenfalls die Vielfalt seiner Kompositionen.
Um die Bedeutung der Diabelli-Variationen zu verstehen und sich über Beethovens kompositorische Breite klar zu werden, über sein transzendentes musikalisches Denken ebenso wie über seine Bodenständigkeit, sei mir ein kurzer Exkurs in eine vollkommen andere Beethoven-Welt erlaubt. Ist es nicht amüsant, dass eines der weltweit bekanntesten Klavierstücke Beethovens nicht op. 57, die Apassionata, oder op. 106, die Hammerklaviersonate, nicht seine Klaviersonate Nr. 32, op. 111, und auch nicht die Diabelli-Variationen sind, sondern ein knapp dreiminütiges Gelegenheitswerk, das nicht einmal eine Opus-Zahl trägt? Der Klavier-Gassenhauer Für Elise! Während Beethovens Spätwerk, seine komplexen Streichquartette ebenso wie seine Klavierwerke, es weit über seinen Tod hinaus (manche bis heute) schwer hatten, begleitet ein Stück wie Für Elise unseren profanen Alltag. Es läuft sogar in den Warteschleifen unserer Telefonanlagen, wird auf kleine, kitschige Spieluhren gepresst und in jedem Souvenirladen (selbst in den Beethoven-Museen in Wien) feilgeboten. Da ich ein begeisterter Cineast bin, finde ich es spannend, dass ausgerechnet Für Elise Filmgeschichte geschrieben hat, obwohl ihm jede Eigenschaft üblicher Filmmusik abgeht. In Rosemaries Baby von Roman Polański wird es in der Nachbarwohnung geübt und erklingt als nervige und gespenstische Vorahnung, in Lizenz zum Töten begleitet Für Elise sogar eine Liebesszene von James Bond (was heute betrachtet fast schon unfreiwillig komisch wirkt), und wenn der geniale österreichische Schauspieler Christoph Waltz als typischer Nazi in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds auftritt, erklingt ebenfalls Für Elise – dieses Mal als ironischer Kommentar deutscher Hochkultur, die so gar nicht zum Nationalsozialismus zu passen scheint. Was Christoph Waltz freilich nicht davon abhält, bereits in den ersten Minuten versteckte Juden ausfindig zu machen und zu erschießen.
Was ich sagen will: Es ist dieses – im Vergleich zu den Diabelli-Variationen – nun wirklich nicht geniale Gelegenheitswerk, das überall zitiert wird, wenn Beethoven gemeint ist. Da hält höchstens das Anfangsmotiv der fünften Symphonie oder Beethovens neunte Symphonie mit, der Stanley Kubrick in Uhrwerk Orange ein Denkmal gesetzt hat. Chuck Berry hat Beethoven einen eigenen Rock’n’Roll-Song komponiert, die Beatles (ebenfalls Beethoven-Liebhaber) ließen auf einer ihrer Platten die Mondscheinsonate rückwärtslaufen. Es besteht also kein Zweifel, dass Beethoven in der Rock- und Popkultur als Idol aufgenommen wurde. Nur das Spätwerk, zu dem auch die Diabelli-Variationen gehören, hat es bis heute nicht in die Populärkultur geschafft. Immerhin hat sich Thomas Mann ausführlich mit dem op. 111 auseinandergesetzt. Aber ein Film, der sich mit den Diabelli-Variationen beschäftigt, ist zumindest mir nicht bekannt. Das verwundert natürlich auch nicht, denn sie sind viel zu komplex, zu tief und ungreifbar. Alles andere als eine populäre Oberfläche, und genau darin liegt wohl auch ihr eigentlicher Wert.
Beethovens Mut, sich in dieser Komposition eine Freiheit von allen Zwängen zu nehmen, ist in seiner Radikalität noch heute äußerst modern. In den Diabelli-Variationen folgt er keinem Zeitgeist, befriedigt keinen Repräsentationsanspruch eines adeligen Gönners oder eines politischen Herrschers und zielt auch nicht darauf ab, möglichst oft in den Wiener Salons gespielt zu werden – dafür sind die Variationen schlicht zu kompliziert.
Ich finde es wichtig, die Diabelli-Variationen aus diesem Grundgedanken heraus zu verstehen. Musikhistoriker fragen sich, warum Beethoven sich ausgerechnet von einem eher simplen Walzer wie dem von Anton Diabelli zu einem der komplexesten Werke inspirieren ließ. Meine Antwort ist: Vielleicht weil Diabellis Vorlage ihn in keine Richtung drängte, weil die Einfachheit des Themas (Beethoven nannte es despektierlich einen »Schusterfleck«) ihm alle Freiheiten gab, weil der Walzer, den Diabelli ihm schickte, nicht gesellschaftlich, musikhistorisch oder irgendwie anders konnotiert war. Beethoven entwickelte offenkundig Spaß daran, Diabellis Material zu nehmen und es auf seine Möglichkeiten hin zu untersuchen. Dabei wurde er von keiner Verpflichtung getrieben, allein von den Möglichkeiten, die ihm die Noten und seine Fantasie boten.
Natürlich hätte Beethoven dem Verleger Anton Diabelli – so wie alle anderen Komponisten – einfach nur eine Variation schicken können, um mehr wurde auch er nicht gebeten. Stattdessen arbeitete er in unregelmäßigen Abständen vier Jahre lang an diesem Thema. Eine derartig lange Arbeitsphase ist nicht einmal lukrativ, und ich bin sicher, dass Beethoven geahnt haben wird, dass es die Variationen auch beim Publikum schwer haben würden. Ich gehe davon aus, dass Beethoven die wirklich wichtigen Werke seiner späten Phase hauptsächlich für sich allein geschrieben hat. Weil er sie schreiben musste.
Das wirklich Faszinierende an den Diabelli-Variationen ist, dass sie gleichsam alles sind und nichts Konkretes wollen. Sie sind in erster Linie Beethovens Beschäftigung mit dem, wofür er steht, sie sind Musik über die Musik. Zuweilen konkret über die musikalische Vergangenheit (Beethoven nimmt Bachs Goldberg-Variationen auf, zitiert Haydn, Mozarts Don Giovanni und immer auch sich selbst), aber auch über die Gegenwart und die Zukunft der Musik. Beethoven war so visionär, dass die Diabelli-Variationen erst 30 Jahre nach Drucklegung und weit nach Beethovens Tod durch Hans von Bülow uraufgeführt wurden. Beethoven hat sich in den Diabelli-Variationen von der Welt und von ihren Erwartungen befreit. Er wollte nicht mehr für irgendwelche Elises schreiben, sondern für Profis – oder mehr noch: für sich selbst und die Nachwelt.
Es wäre genauso absurd, Beethoven nur auf sein Spätwerk zu reduzieren, wie es absurd wäre, ihn nur mit Für Elise in Verbindung zu bringen. Beethoven war – und das macht ihn so besonders – vielfältig, ein Kind seiner Zeit, das aber immer wieder die Konventionen seiner Zeit gesprengt hat, vollkommen neues Terrain betrat und eine Welt erschuf, die für uns heute noch ein spannendes, emotionales und visionäres Rätsel ist.