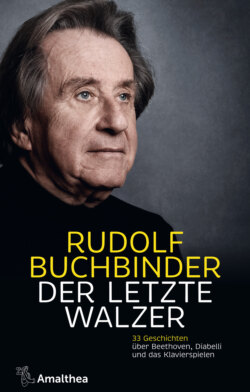Читать книгу Der letzte Walzer - Rudolf Buchbinder - Страница 9
ОглавлениеVariation Nr. 3
Das Marketing-Genie
Man mag darüber lamentieren, dass Marketing, Public Relations, Branding oder Öffentlichkeits-Strategien eine so große Rolle im modernen Musikbetrieb spielen – früher trug all das noch den schönen Namen »Werbung«. Aber Fotoshootings, Interviews und TV-Auftritte gehören längst zum Geschäft, und alles braucht – so sagen es PR-Experten – eine Story, ein Narrativ, einen PR-Plan. Nur so könne man Bach, Brahms oder eben Beethoven verkaufen. Wer die Geschichte der Diabelli-Variationen kennt und sich mit der schillernden Figur Anton Diabellis auseinandersetzt, weiß allerdings, dass all das überhaupt nicht neu ist. Im Gegenteil: Einige unserer Klassik-Marketing-Strategen könnten selbst heute noch einiges von Anton Diabelli lernen.
Schon sein Name ist ein großer Marketing-Clou, der in diesem Fall von seinem Vater erfunden wurde. Der hieß eigentlich Nikolaus Demon, stammte aus dem oberösterreichischen Aurolzmünster im Innkreis und beschloss, um seine Karriere als Musiker zu beflügeln und der italienischen Mode gerecht zu werden, sich in Diabelli umzubenennen. Ein Umstand, der seinem Sohn später sicherlich geholfen hat. Der fiel zunächst als vorzüglicher Gitarrist auf. Wäre es nach seinen Eltern gegangen, hätte Anton Diabelli die Priesterlaufbahn eingeschlagen. Der Grundstein dafür war bereits gelegt, als er das Zisterzienserkloster Raitenhaslach besuchte. Doch nachdem es 1803 säkularisiert wurde, entschloss Diabelli sich gegen eine Priesterkarriere und suchte sein Glück als Komponist in Wien. Hier arbeitete er zunächst als Aushilfe in einem Druckhaus, komponierte und gründete später selbst einen Verlag, um seine eigenen Werke zu veröffentlichen. Dann schloss er sich mit dem Verleger Peter Cappi zusammen und schrieb – man kann es nicht anders nennen – Verlagsgeschichte.
Um Aufmerksamkeit auf seinen jungen Verlag zu lenken, kam Diabelli auf die geniale Idee, 50 bedeutende Komponisten in einem Sammelband zu vereinen. Er ließ sie Variationen auf einen Walzer schreiben, den er komponiert hatte. Das war in zweifacher Hinsicht geschickt, denn Diabelli vereinte zwei Modeerscheinungen: den Walzer, der in den Ballsälen Wiens getanzt wurde, und die Kunst der Variation, die sich in den bürgerlichen Salons und Wohnstuben großer Beliebtheit erfreute. Dazu muss man wissen, dass ein Büchlein mit Klavier-Variationen zur Zeit Beethovens ungefähr dem entsprach, was später die Schallplatte oder eine CD war und was heute ein Musik-Stream ist: eine Möglichkeit, die Musik großer Künstler in die eigene Wohnung zu holen.
Dass die Stars der Wiener Musikszene Diabelli jeweils eine Variation geschickt haben, war bereits die halbe Miete für den Erfolg seines Projektes. Als dann auch Beethoven – der damals wohl bekannteste und erfolgreichste Komponist Europas – zusagte, Variationen über das Walzer-Thema des Verlegers zu komponieren, schien der Erfolg seines Druckwerkes garantiert.
Doch als Diabelli Beethovens Variationen in den Händen hielt, muss er geschluckt haben. Ihm muss sofort klar geworden sein, dass es sich bei diesem Werk um schier unspielbare Musik handelte. Um Noten, die nicht dazu gedacht waren, die Salons zu erobern oder auf der Straße gepfiffen zu werden. Beethoven hatte dem Verleger intellektuelle Kopf-Musik geliefert, einen in Noten gegossenen Diskurs über die Philosophie und die Geschichte der Musik, über die Grenzen der Harmonie hinaus – und eine vollkommene Neuerfindung der Variation.
Wie sollte der Verleger ein derart unspielbares Machwerk, das sich an einen exklusiven Zirkel intellektueller Musiker richtete und nicht an den musikalischen Mainstream, verkaufen? Am 16. Juni 1823 setzte Diabelli eine Anzeige in die Wiener Zeitung, in der sich sein Marketing-Genie offenbarte. Er pries Beethovens Variationen als einen einzigen Höhepunkt der Musikgeschichte an:
»Wir bieten hier der Welt keine Variationen der gewöhnlichen Art dar, sondern ein großes und wichtiges Meisterwerk, würdig, den unvergänglichen Schöpfungen der alten Classiker angereiht zu werden, und so, wie es nur Beethoven, der größte jetzt lebende Repräsentant wahrer Kunst, einzig und allein liefern kann.«
Diabelli verkaufte die unspielbaren Beethoven-Variationen als gigantischen Superlativ. Er tat so, als wären die Variationen eine Herausforderung für »brillante Spieler« und stellte Beethoven in eine Reihe mit den größten musikalischen Meistern aller Zeiten: »Die herrlichen Fugen […] werden die brillanten Spieler überraschen, und überhaupt alle diese Veränderungen durch die Neuheit der Ideen, Sorgfalt der Ausarbeitung und Schönheit der kunstreichsten Transitionen diesem Werke einen Platz neben Seb. Bachs bekannten Meisterstücken ähnlicher Art anweisen.«
Spätestens nach dieser Anzeige sollte jeder Kulturbürger in Wien begriffen haben: Beethovens Diabelli-Variationen sind ein Must-have, wie man heute sagen würde. Allein schon, weil sie aus Sicht Diabellis das legitime Erbe der Bach’schen Goldberg-Variationen antreten. Das war seine Story, sein Narrativ – und dies hat bis heute Bestand. Die Anzeige ist das Beispiel einer einzigartigen Verkaufsstrategie. Diabelli hat den Beweis angetreten, dass etwas Unspielbares nicht gleichzeitig etwas Unverkaufbares sein muss.
Wie strategisch der Verleger dachte, zeigt sich auch daran, dass Diabelli Beethovens Variationen sofort nach Erhalt veröffentlicht hat. Wohl auch, weil er von Beethovens Ungeduld getrieben wurde. Die Beethoven-Veränderungen erschienen unter der Verlagsnummer 1380, die Nummer 1381 ließ Diabelli frei und reservierte sie für den noch nicht fertiggestellten Sammelband der anderen Komponisten. Auch hier griff Diabelli ein Jahr später (inzwischen veröffentlichte er ohne seinen Kompagnon Cappi) in der Wiener Zeitung wieder die Sprache der Superlative auf: »Alle vaterländischen jetzt lebenden bekannten Tonsetzer und Virtuosen auf dem Fortepiano, fünfzig an der Zahl, hatten sich vereint, auf ein und dasselbe ihnen vorgelegte Thema, jeder eine Variation zu componieren, in welcher sich Geist, Geschmack, Individualität und Kunstansicht, so wie die einem jeden eigentümliche Behandlungsart des Fortepiano auf die interessanteste und lehrreichste Art ausspricht.«
Nachdem Diabelli in dieser Anzeige auch auf Beethoven verweist (er nennt ihn den »Jean Paul unserer Zeit«), preist er die neuen Variationen als »alphabetisches Lexicon aller, theils bereits längst gefeierter, theils noch viel versprechender Nahmen« und nennt explizit den »talentreichen elfjährigen Knaben Liszt« und »Hr. Carl Czerny«.
Auch diese Anzeige stellt uns Diabelli als klugen Geschäftsmann und begnadeten PR-Strategen vor, der genau wusste, wie er seine Noten an den Mann oder besser gesagt in Wiens bürgerliche Salons brachte: indem er Beethoven als legitimen Erben Bachs annoncierte und den zweiten Variationsband als Lexikon all jener Künstler, die man in der Wiener Gesellschaft kennen sollte, verkaufte. Der Hinweis, dass Erzherzog Rudolph ebenfalls eine Variation beitrug, dürfte den Verkauf zusätzlich beflügelt haben. Diabelli bot den zweiten Variationsband als Klavierbüchlein an, das es jedem Klavierspieler ermöglichte, jeweils ein Werk eines der angesehensten Komponisten seiner Zeit zu spielen. Die 50 Diabelli-Variationen waren so etwas wie eine Best-of-Playlist der 1820er-Jahre. Um dieser Auswahl zusätzlich Gewicht zu verleihen, erfand Diabelli – und auch das war ein Scoop – kurzerhand den »Vaterländischen Künstlerverein«, den es natürlich nie gab. Aber es klang eben gut, alle Komponisten, die ihm eine Variation geschickt hatten, unter diesem exklusiven Label zu vereinen.
Als ich irgendwann eine Erstausgabe von Schuberts Impromptus angeboten bekam, die ebenfalls von Diabelli herausgegeben wurden, staunte ich nicht schlecht. Das Buch war nach Schuberts Tod veröffentlicht worden, und der Verleger hatte auf eigene Faust eine Widmung auf der ersten Seite des Bandes eingefügt. Sie galt dem damals wohl erfolgreichsten Musiker überhaupt: Franz Liszt. Man muss sich das einmal vorstellen: Diabelli, der bereits in seinem Variationswerk auf Schubert setzte, kurbelte den Verkauf der Kompositionen Schuberts auch nach dessen Tod noch an, indem er sie – vielleicht nicht ganz lauter, auf jeden Fall aber unglaublich clever – einfach mit Franz Liszt (der ja schon als elfjähriger Komponist in den Variationen vertreten war) in Verbindung brachte. Durch eine simple Widmung, die er den Impromptus nachschob. Ich glaubte zunächst an einen Zufall. Aber als ich – wiederum einige Jahre später – die Erstausgabe von drei Schubert-Sonaten (auch sie erschienen bei Diabelli) erstand, wurde mir klar, dass Diabellis Strategie Methode hatte. Auch diese Sonaten hatte er persönlich, natürlich nach Schuberts Tod, kurzerhand dem ebenfalls populären Robert Schumann gewidmet. Was für eine Chuzpe!
Es ist erstaunlich, wie Anton Diabelli bereits in den 1820er-Jahren noch heute moderne Marketing-Strategien beherrschte. Allein die Idee, die 50 prominentesten Komponisten in einem Sammelband zu vereinen und Beethoven eine Sonderstellung einzuräumen, war genial. Seine Art, diese Musik anschließend zu bewerben und zu verkaufen, war ausgebufft. Wenn man so will, war Diabelli ein Pionier des modernen Marketings. Er hat Beethovens Musik eine Story und ein Narrativ gegeben, die bis heute gültig sind, und dabei stets für ein Kunstwerk geworben, für das es gar nicht genug Werbung geben kann.