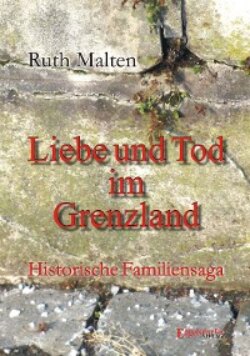Читать книгу Liebe und Tod im Grenzland - Ruth Malten - Страница 18
12. Kapitel
Humboldtstraße
Оглавление1939
Paul und Emma sitzen mit ihren Kindern an ihrem runden Wohnzimmertisch, der mit einer in zart pastelligen Streublümchen gestickten Tischdecke geschmückt ist und frühstücken. In einer bauchigen, lehmfarbigen Ton-Vase leuchten im Garten gepflückte Astern in herbstlichen Rottönen und verströmen ihren herben Duft. Dieser mischt sich mit dem Wohlgeruch von frisch gebackenem Hefekuchen und Malzkaffee mit Milch. „Es riecht nach Sonntag“, sagt Marie.
Sonntagsfrühstück bedeutet für die Familie: Es gibt Kuchen, trotz der mageren Zeiten. Emma hat es auch dieses Mal hingedeichselt, die nötigen Zutaten für den Lieblingskuchen zu ergattern und diesen gekonnt zu backen: einen Streuselkuchen aus einem Hefeteig, nach unermüdlichem Schlagen mit dem Holzlöffel aufgeplustert wie eine duftige Septemberwolke. Wattekuchen nennen die Kinder Emmas luftiges Backwerk. Glückstrahlend lächelt sie in die Runde. Genüsslich beißen die Mädchen in ihr zuckriges Kuchenstück. Zucker krümelt von ihren Lippen. Ihre Haut, gebräunt vom Sommer, die Augen leuchtend, glühen ihre Wangen rosig vor Behagen. Paul schneidet mit einem Messer die Streuseldecke seines Kuchenstücks, stapelt dieses auf die beiden anderen Streusel-Decken, um diese zuletzt zu verspachteln. Als Krönung nach den trockneren Hefesockeln. „Obersieger in Willenskraft“, bemerkt Marie bewundernd und sagt, was auch ihre jüngeren Schwestern denken dürften: „Meine Güte, so lange auf das Beste warten zu können!“
Da ertönt aus dem Volksempfänger die durchdringende Erkennungsfanfare, die eine Sondermeldung ankündigt. Das Signal für die Kinder, jetzt still zu sein, denn der Führer wird sprechen, und die Eltern wollen jedes einzelne Wort mitbekommen. Paul und Emma beugen sich nahe zu ihrem Radio und zeigen vorsorglich, den Zeigefinger vor dem Mund, ‚pst‘ in Richtung Kinder an.
Die Nachricht, die nun folgt, schlägt wie eine Granate in ihre frohgestimmte Sonntag-Morgen-Frühstücksrunde ein.
Paul ist blass geworden. Sein Messer hat er auf den Tisch gelegt. Den Bissen in seinem Mund scheint er vergessen zu haben. Emma schaut Paul mit großen, runden Augen verwirrt an. Auch der Kuchenbissen in ihrer ausgebeulten Wange scheint ihrem Bewusstsein entfallen. Mit halboffenem Mund, ernst und fragend schauen die Kinder auf ihre Eltern. Nur noch im Zeitlupentempo wagen sie weiterzukauen.
Eine dunkle Wolke hat sich beklemmend auf die eben noch frohe Sonntags-Kaffeerunde gelegt.
Der Führer hat gerade mitgeteilt: „Seit fünf Uhr wird zurückgeschossen.“
Der weiteren Meldung war zu entnehmen, polnische Grenzsoldaten hätten deutsche Grenzer angegriffen, worauf nun die Deutschen zurückschössen.
„Was hat das zu bedeuten?“, fragt Emma, um die drückende Stille zu beenden, wenngleich sie die Antwort kennt. Paul räuspert sich umständlich. Seine Stirn zuckt. Die senkrechte Falte zwischen den Brauen hat sich vertieft. Dann sagt er mit entfernt klingender, knarzender Stimme: „Krieg hat das zu bedeuten.“
Emma, die das Gehörte weder fassen kann noch glauben will, versucht klar zu denken. Sie streicht eine blonde Haarsträhne aus ihrem Gesicht und schaut besorgt auf ihre Kinder: „Aber der erste Weltkrieg ist doch gerade mal 20 Jahre vorüber. Es kann doch nicht sein, dass der Führer einen neuen Krieg anfängt!“ Emma versucht zu erfassen, was da gerade wie eine Bombe in ihr Leben eingeschlagen ist. Entgeistert schüttelt sie wiederholt den Kopf und schaut Paul fortwährend an, gegen jede Hoffnung hoffend, alles sei nur ein böser Spuk, den Paul verscheuchen könne.
Paul kaut seinen trockenen Bissen langsam und irgendwie zu Ende. Sein Magen hat sich zugezogen. Die feinen Teile mag er in diesem beladenen Augenblick nicht mehr aufessen. Er wischt die Hände an der Stoff-Serviette ab, legt diese neben seinen Teller, räuspert sich und sagt nach einer Weile heiser: „Hitler will den Krieg, gefehlt hat nur noch ein Anlass. Anlässe lassen sich basteln, wenn man zum Beispiel die polnischen Soldaten lange genug provoziert hat.“ Er macht wieder eine längere Pause. Sorgenvoll fährt er fort: „Wir wissen es nicht und werden es wohl auch nie erfahren. Das Erste, was im Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit. Die Propaganda wird uns künftig sagen, was die offizielle Wahrheit ist, die wir zu glauben haben. Der Volksempfänger hier wird das Sprachrohr der Regierung sein, wenn demnächst alle Medien und die Presse gleichgeschaltet sind. Wer was anderes denkt und sagt, tanzt auf dem Vulkan.“ Pauls Lippen sind schmal geworden. Seine Hände, zuvor entspannt mit dem Kuchen beschäftigt, liegen zu Fäusten geballt neben dem Teller. Seine Stimme hat zuletzt gereizt geklungen.
Die Kinder schauen auf ihre Eltern. Sie verstehen nicht, wovon die Rede ist. „ Silence “, sagt Emma zu Paul und weist mit ihren Augen auf die beiden älteren Mädchen Marie und Renate. Die Eltern haben sich angewöhnt, Englisch zu sprechen, wenn die Kinder etwas nicht verstehen sollen. Marie und Renate sind Schülerinnen und hören in der Schule möglicherweise eine andere Version als zu Hause. Paul und Emma wollen die Kinder nicht in Gewissenskonflikte bringen. Nicht erst seit heut müssen Väter und Mütter achtgeben, was sie in Gegenwart ihrer Kinder sagen.
„Ich will Herbert kurz rüberholen. Seine Meinung interessiert mich. Als Lehrer für Geschichte und Mathematik hat er mehr Ahnung als wir.“
Sie treffen sich in Pauls Herrenzimmer, in dem er normalerweise an den Wochenenden die mitgebrachte Arbeit erledigt. Paul schließt das Fenster. „Vorsicht, nicht schwätzen, Feind hört mit“, zitiert Emma einen Spruch, der gegenwärtig allerorten auf Plakaten, an Hauswänden und Litfass-Säulen prangt. Wie immer versucht sie, mit einem Scherz eine eingetrübte Stimmung aufzuhellen, heut allerdings vergeblich.
Die Kinder sind auf die Straße gegangen, um mit Nachbarskindern zu spielen und haben ihr angebissenes Kuchenstück mitgenommen.
Herbert sieht aus wie Paul: Grau im Gesicht, zerfurcht die Stirn, wie gealtert. Sein Begrüßungslächeln misslingt zu einer verrutschten Larve. Mit leiser, müder Stimme stellt er fest: „Seit der Führer die Macht übernommen hat, wurde mehr und mehr deutlich, dass seine Politik auf einen Krieg zuläuft“, sagt Herbert. Er hat sich auf einen der drei dunkel- braun-grünen Plüsch-Sessel gesetzt, den rechten Ellenbogen auf ein Knie gestützt; die fünf Finger seiner Hand streichen über seine verknitterte Stirn. Grüblerisch schaut er zu Boden. „Der Führer meint, Deutschland brauche mehr Lebensraum. Kurz nach seiner Machtübernahme am 30. Januar 1933 erklärte er bereits den Befehlshabern von Heer und Marine, er wolle den Lebensraums der Deutschen nach Osten hin erweitern und sähe die Jahre 1943 bis 1945 dafür als günstig an. Machterweiterung erfordere Krieg. Da er überzeugt ist, erfolgreich zu sein, schließt er ein Risiko aus.“ Herbert nimmt seine Brille ab, hält sie in Richtung Fenster, schaut hindurch, nimmt sein Taschentuch, haucht die Brille an und putzt sie ausgiebig. Paul und Emma sehen ihm dabei zu, als hinge es von seiner blanken Brille ab, die Beklemmung dieses Sonntagmorgens zu verscheuchen.
„Die Verschuldung des deutschen Staates ist so immens, dass diese Schulden nur beglichen werden können durch Güter und Vermögen, die bei einem Sieg den Deutschen zufallen. Das ist einkalkuliert“, sagt Herbert nach längerer Gedankenpause. „Die verdeckten Kriegsvorbereitungen, wie der Bau von Autobahnen, der Wiederaufbau der deutschen Wehrmacht, oder die Schaffung neuer Organisationen zur ideologischen Vorbereitung der Deutschen auf diesen Krieg haben Unsummen verschlungen. Die bisherigen Schulden wurden finanziert über Wechsel, die deutsche Kleinsparer kaufen in der sicheren Erwartung, ihre Ersparnisse mit hoher Rendite am Ende des Krieges zurückzuerhalten. Schaut man sich die Aktivitäten der vergangenen sechs Jahre seit 1933, dem Jahr der Machtergreifung an, fügt sich alles nahtlos zu einem Mosaik, dem geplanten Krieg.“ Je länger Herbert redet, desto hoffnungsloser klingt seine Stimme.
Paul hat einerseits Skrupel, seinem Freund, der offensichtlich schwer durchhängt, mit weiteren Fragen zu kommen. Doch allzu viele Fragen brennen auf seiner Seele. So unterdrückt er seine Gewissensbisse und forscht weiter:
„Was sagen die Westmächte dazu, die Verfasser des Versailler Vertrages?“ Herbert setzt sich aufrecht in den Sessel, nimmt seine Brille ab und setzt sie wieder auf, bevor er antwortet: „Das wird man sehen. Bisher haben sie sich begnügt, mit Protesten zu reagieren, wenn ihnen eine allzu eigenmächtige Handlung des Führers nicht gefiel. Ich denke da an verschiedene einseitige Vertrags-Aufkündigungen. Sie fühlen sich noch nicht stark genug für einen Krieg.“
„Ich dachte, die Deutschen müssten für alle Zeiten genug haben vom Krieg nach den Erfahrungen, die sie mit dem ersten Weltkrieg gemacht haben“, sagt Emma vorwurfsvoll und spricht lauter als sie sollte. Sie gießt Herbert einen Pfefferminztee nach und reicht ihm die Zuckerdose.
„Danke, Emma. Der Führer hat es geschafft, zu vermitteln, er sei von der Vorsehung auserkoren, aus Deutschland etwas Großes zu machen. Die Deutschen seien das arisch-germanische Volk, berufen, die Herren über die slawischen Untermenschen des Ostens zu sein. Solch große Worte tun gut, wenn man zuvor als Deutscher durch den Versailler Vertrag und seine schmählichen Folgen moralisch am Boden zertreten wurde. Es konnte nicht gutgehen, dass 2,1 Millionen Deutsche der Autorität Polens unterstellt wurden. Andere Konfession auf der einen Seite, auf der anderen das Wissen, dass Polen niemals in der Geschichte in der Lage war, sich selbst zu regieren. Das hatten bereits die Briten David Lloyd George und der Franzose George Clemenceau nach Abschluss des Versailler Vertrages festgestellt.
Unseren Glauben an uns selbst hat uns der Führer wiedergeben und ist inzwischen unser Heiland, dem wir zutrauen, uns in eine ruhmreiche Zukunft zu führen. Diese Zukunftserwartung blendet schleichend Dinge aus, die man nicht nur nicht gutheißen kann. Sie sind, wenn sie zutreffen sollten, unmenschlich, ja verbrecherisch!“
Herberts Stirn gleicht einer alten Baumrinde, denkt Emma. Obgleich nur vier Jahre älter als Paul, sieht er altersmäßig mehr Pauls Vater ähnlich, der mit ihnen zusammen die andere Doppelhaushälfte bewohnt, als Paul, seinem vier Jahre jüngeren Freund.
„Momentan muss ich meinen Schülern Dinge sagen, die ich selbst nicht glaube. Verrat an meinem Gewissen und schwer zu verkraften. Ich muss aufpassen, nicht eines Tages in mein eigenes Spiegelbild zu schlagen.“ Herbert schüttelt den Kopf, legt beide Hände aneinander und sein vergrämtes Gesicht auf die wie zum Gebet senkrecht gepaarten Hände.
„Gibt es keine andere Wahl? Was geschähe, wenn du deine Meinung ehrlich mit den Schülern diskutiertest?“ Emma kommt sich bei ihrer Frage selbst reichlich naiv vor.
„Ich kann auswandern, denn als Beamter habe ich die offizielle, gleichgeschaltete Meinung der einen, allumfassenden Partei zu vertreten. Oder ich kann mir eine Kugel in den Kopf schießen. Hast du Familie, musst du gegenwärtig Anwandlungen heroischen Edelmuts im Kohlenkeller vergraben. Widerlich, ich weiß. Wahl zwischen Charakterschwein oder Tod.“
Herbert macht eine Pause, trinkt einen Schluck des frischen Pfefferminztees, bevor er mit gedämpfter Stimme nach einer Pause fortfährt: „Ich hoffe, meine Selbstachtung, mein Überlebenswille und meine Nerven-Kraft, Schülern verdrehte Fakten vermitteln zu sollen, reichen, bis dieser Spuk in nicht allzu ferner Zukunft ein Ende hat. Jede Stunde Zeitgeschichte ist für mich eine Tortur. Ich müsste meinen Schülern sagen: ‚Seid vorsichtig, ihr Jungen. Wir haben es erlebt, was aus einem kleinen Brandherd werden kann, einem einzigen Schuss aus einem Gewehr. Am Ende blieb blutgetränktes, zerstörtes Land, waren fünf Millionen Tote zu beklagen, zerstörte Familien, kranke oder tote Väter und Söhne. Gab es Hunger und Elend. Nicht nur die Deutschen waren von all dem Elend betroffen.‘ Das alles würde ich meinen Schüler sagen müssen, wenn ich den Mut hätte, für meine Überzeugung ins Zuchthaus zu gehen und wegen Verhetzens der Jugend aufgehängt zu werden. Was wäre erreicht? Meine Familie zerstört. Geändert hätte sich durch meinen pompösen Todesmut nichts. Schon, dass ich heut mit euch beiden so offen rede, könnte mich den Kopf kosten. Aber Ihr seid meine Freunde, und ich kann mich auf euch verlassen. Wohltuend, aussprechen zu können, was sonst nur Gedanken sind.“ Emma tat dieser Mann leid, der aufgewühlt vor ihnen saß und durch seinen Beruf in doppelter Zwangslage steckte.
Auch Paul war in die Partei eingetreten. Als Führungskraft im öffentlichen Dienst hoffte er, mit diesem Schritt unangenehmen Fragen zu entgehen.
Emma sann, auch bei ihnen galt: Unser kleines Glück ist so kostbar und schützenswert, dass jede Gefährdung vermieden werden musste. Für Heldenmut war nicht die Zeit. Ein viel zu kleines Rädchen im Getriebe waren sie, als dass eine Heldentat irgendwas Positives bewirken konnte. Ihr Haus abzustottern, bescheiden zu leben und ein Leben zu bewerkstelligen, an das sich die Kinder eines Tages gern erinnern konnten, war mühselig genug.
Emma sagte: „Ich verstehe dich und wünsche dir alle Kraft für deinen täglichen Seelen-Spagat. Ein einziger Schüler, scharf gemacht von der Hitlerjugend, seinem Vater oder wem auch immer, könnte dir das Kreuz brechen. Dank dir für dein Vertrauen. In dieser Zeit sind vertrauenswürdige Freunde ein Kleinod.“ Emma legte ihre Hand auf den Handrücken des Freundes. Ihr kleines Lächeln war einfühlsam und zugetan. Alle schwiegen eine Weile.
Emma sagte: „Ich wünsche mir vor allem, dass wir unseren Kindern solange wie möglich das Gefühl eines normalen Lebens erhalten können. Meine Hoffnung, vielleicht wird das kleine Feuerchen in Polen gar kein Flächenbrand, und wir haben uns umsonst gesorgt.“ Sie tranken gemeinsam ihren Pfefferminztee, den Emma immer wieder nachgegossen hatte. Pfefferminztee aus der Minze in ihrem Garten.
Als Herbert gegangen war, sagte Emma zu Paul: „Die heutige Kriegsbotschaft ist ja nicht der erste Schrecken seit Hitlers Machtergreifung. Das Strickmuster sieht immer ähnlich aus. Denk an den Reichstagsbrand vor sechs Jahren. Es hieß, Kommunisten seien die Verursacher gewesen. Anschließend wurden scharenweise KP-Funktionäre verhaftet. Wurde wirklich bewiesen, dass sie es waren? Es gab auch Stimmen, die Zweifel am vermeintlichen Brandstifter äußerten.
Wir werden die Wahrheit nicht erfahren. Die Rassegesetze vor vier Jahren mögen zwar gut für die blonden und blauäugigen Menschen in unserem Land geklungen haben, die plötzlich zu einer besonders schützenwerten Gattung wurden. Aber ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die diesem Bild nicht entsprechen. Anmaßende Vorstellung, die arischen Menschen seien per se die höherwertigen. Man könnte das alles als Schnapsidee abtun, wären da nicht die ungeheuerlichen Methoden, mit denen die Juden aus unserer Gemeinschaft aussortiert werden. Auch da wissen wir ja nichts Genaues. Es sind Gerüchte. Ich hoffe, dass einige der Fantasie entsprungen sind. Die Betroffenen sind Menschen, die Familien haben, Kinder, einen Beruf. Mir graut bei der Vorstellung, wir alle, wir Deutschen, könnten eines Tages für diese Schandtaten belangt werden von einer Art höherer Gerechtigkeit.“
Emma hatte sich in Rage geredet. Sie strich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihre honigbraunen Augen funkelten erregt. Ihre unruhigen Hände suchten nach einer Bleibe und schoben sich schließlich hinter den Latz ihrer Schürze.
„Guter Rat deines Mannes: Solche Gedanken behältst du künftig besser für dich. Mit Sätzen wie den eben geäußerten kannst du dir ganz schnell den Mund verbrennen. Wie gesagt: ‚Vorsicht, nicht schwätzen, Feind hört mit.‘ Jeder kann das sein, ein vermeintlich ganz lieber Nachbar, der irgendwas in den falschen Hals bekommen hat und nun eine Möglichkeit sieht, dich, mich, uns beide in die Pfanne zu hauen“, sagte Paul gereizt, dem dieses ganze Thema allmählich auf die Nerven ging.
„Ihre Judenpolitik begründen die Nazis so: Sie sitzen an den Hebeln der Macht, überall da, wo das Geld ist. Ihnen gehören Kaufhäuser, Banken …“, er atmete schwer.
„Warum sind sie in den Geldberufen?“, wollte Emma wissen. „War es nicht so, dass man sie zu Handwerksberufen nicht zugelassen hat, dass sie vieles nicht durften, sodass nur Handel und Geld blieben? Und warum will Hitler ihnen nun an den Kragen? Wenn wirklich alles von vornherein auf einen Krieg zugelaufen ist, könnte es nicht sein, dass er bei den Schulden, die sich durch die riesige Aufrüstung angehäuft haben, einfach an ihr Geld ran will, an ihre großen Vermögen? Auch das wäre doch ein weiterer riesiger Etiketten-Schwindel, vergleichbar dem von heut Morgen mit dem angeblichen ‚zurückschießen‘, oder? Sie reden von Rasse und meinen ihr Geld. Sie reden von ‚Volk ohne Raum‘ und meinen Machtzuwachs. Oder sehe ich das alles falsch?“
Emma ließ nicht locker. Die Verlogenheit empörte sie und die menschliche Seite, die Tatsache, dass hier Menschenleben und Menschenschicksale bei aller Politik ausgeblendet wurden, so wie am heutigen Tag in Polen, wo möglicherweise schon die ersten Frauen ihre erschossenen Männer beklagten, Kinder ihren toten Vater. Politik hatte sie noch nie sonderlich interessiert, schmutziges Geschäft, fand sie. An die sogenannte ‚Reichskristallnacht‘ durfte sie gar nicht denken. Sie schämte sich, dass es ihre Landsleute waren, die Juden deren Geschäfte zerstört hatten. Wenn andere Pauls Büro verwüstet hätten, seine Lebensarbeit, die Grundlage der Existenz ihrer Familie? Woher kam überhaupt dieser Juden-Hass, der offenbar nicht nur in Deutschland existierte? Angeblich, weil es Juden waren, die Jesus 2000 Jahre zuvor ans Kreuz genagelt hatten? Irrsinn, fand Emma, solche an den Haaren herbeigezogenen Begründungen aus der Mottenkiste. Möglicherweise wollte man neben dem Wunsch, jüdische Vermögen zu kassieren, missliebige Konkurrenten loswerden.
So sah sie das jedenfalls, sie die unpolitische Mutter und Ehefrau, die die Dinge aus dem Bauch heraus beurteilte und sich wenig für die raffinierten Begründungen der Politiker interessierte, die ihr verlogen erschienen und an den Haaren herbeigezogen.
Pauls Informationen bis zu diesem Zeitpunkt waren die folgenden, die er für sich selbst vor kurzem in einer Art politischen Tagebuchs handschriftlich festgehalten hatte:
‚ Als Hitler die Macht übernommen hatte, verkündete er Friedenswillen und die Fortsetzung der friedlichen Revision des Versailler Vertrages. Den Befehlshabern von Heer und Marine hingegen hatte er bereits zu diesem Zeitpunkt seine Revisionspläne für die Zukunft mitgeteilt. Die 1935 wieder eingeführte Wehrpflicht widersprach bereits den Bestimmungen von Versailles. Als er das entmilitarisierte Rheinland besetzen ließ, brach er den LocRocco-Vertrag. Vor einem Jahr marschierte er in Österreich ein. Mit dem Münchner Abkommen erreichte er die Abtretung des Sudetenlandes an Deutschland, was von den Alliierten mit dem Münchener Abkommen nachträglich sanktioniert wurde. Ein Jahr später marschierten die deutschen Truppen in der Rest-Tschechoslowakei ein und Hitler gründet das Protektorat ‚Böhmen und Mähren‘. Die Westmächte wollten sich dem hochgerüsteten Deutschland noch nicht entgegenstellen. Dessen wirkliche Absichten waren ihnen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings bereits klargeworden.
Hitler wandelte das deutsche politische System in eine Ein-Parteien-Führer-Diktatur um.‘
Emma und Paul waren in den Garten gegangen und hatten sich auf den Rand ihres Regenwasserbassins gesetzt, das Paul im Jahr zuvor gebaut hatte und ihnen das Gießwasser für den Garten lieferte.
„Ich weiß“, sagte Emma leise und ruhig, „dass du einiges nachvollziehen kannst und gut findest, was Hitler macht. Du siehst die Dinge aus einer anderen Warte und bewertest die Fakten politisch. Ich möchte dich verstehen. Vielleicht bin ich zu emotional. Nenne mal die Punkte, die du als Mitglied der Partei positiv siehst und ich, der weibliche Laie, sage dir meine Meinung dazu, ja?“
„Gut“, sagte Paul, „ich muss da allerdings etwas weiter ausholen. Beginnen wir mit dem Versailler Vertrag, der Wurzel allen Übels und dessen, was heute unter Umständen begonnen hat, ein zweiter Weltkrieg. Die uns auferlegten Zahlungen waren in der beschlossenen Höhe nicht zu stemmen und hätten unsere Wirtschaft und uns umgebracht. Besonders, wenn man die Besetzung des Rheinlandes, des Zentrums der deutschen Industrie, durch französische und britische Truppen berücksichtigt. Die Metaller waren nicht mehr bereit, unter diesen entwürdigenden und behindernden Bedingungen zu arbeiten. Die Besetzung war erfolgt, weil die Deutschen mit den Reparationszahlungen in Rückstand waren. Aber sie hatten das Geld nicht. Mit dem Young-Plan, der die Bedingungen abmilderte, kamen Erleichterungen, aber immer noch Zahlungen bis 1988. ‚Versklavung der Deutschen‘ nannte Hitler das und stellte die Zahlungen ein“, sagte Paul, „und wurde auf riskante Weise vertragsbrüchig“, entgegnete Emma lakonisch.
„Hitler ergriff gleich nach der Machtübernahme Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit, im Jahre 1933 sechs Millionen Arbeitslose“, fuhr Paul fort. „Bereits 1936 war die Arbeitslosenzahl auf 1,6 Millionen gesunken. Das gelang durch den Bau von Autobahnen, durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Arbeitsdienstes, zum Beispiel Aufforstung und Bodenkultivierung, Erntehilfe, Wegebauarbeiten, Gebäudeinstandsetzung, Bau von Kleinsiedlungen und Versorgungsbetrieben.“
„Die Autobahnen dienten der Kriegsvorbereitung“, sagte Emma, „waren aber wirksam zur Linderung der größten Not, die die riesige Arbeitslosigkeit verursacht hatte“, ergänzte Paul.
„Durch den Bund deutscher Mädel (BDM) und die Hitlerjugend (HJ) sorgte er für eine Körperertüchtigung der Jugend. Dem dienten auch die Jugendspiele sowie die Olympischen Spiele.“
„Er schaffte sich gesundes, kräftiges Menschenmaterial für den kommenden Krieg. Vor allem hatte er die Möglichkeit, den Nachwuchs in den unterschiedlichen Organisationen bereits früh ideologisch indoktrinieren zu können“, konterte Emma.
„Hitler ist zutiefst überzeugt, dass die germanisch-arische Rasse intelligenter sei als andere und deshalb so rein wie möglich erhalten werden sollte. Sie seien die Herrenmenschen und ausersehen, die anderen zu führen.“
„Unglaublich anmaßend, wenn du mich fragst und durch nichts bewiesen. Eine Behauptung. Klar, ich wünsche mir auch, dass die blonden, blauäugigen Menschen nicht aussterben, die dunkelhaarigen sind ohnehin in der Überzahl. Aber kein Mensch hat das Recht, eine Art Menschenzucht zu betreiben. Wir als Christen glauben schließlich, dass wir alle aus Adam und Eva hervorgegangen sind, wenn denn an dieser alttestamentarischen Geschichte überhaupt was Wahres dran sein sollte.“
„Hitler schrieb bereits in seinem Buch ‚Mein Kampf‘, dass wir ein Volk ohne ausreichend Lebensraum seien und nach Osten expandieren sollten und müssten. Diesem Ziel dienen seine Kriegsvorbereitungen, Landgewinn, etwas, was zahlreiche Führer in der Geschichte versucht haben. Denk an Alexander den Großen, Friedrich den Großen, Napoleon. Machtzuwachs, Gewinn an Ansehen und einen historischen Gedenkstein in den Geschichtsbüchern durch Landgewinn mit allem, was sich in diesem Land befindet. Die Kriege werden im Allgemeinen von denen finanziert, in deren Ländern sie stattfinden, sind demnach theoretisch kostenneutral, allerdings nur, wenn sie gewonnen werden.“
„Und das ist genau der springende Punkt: wenn sie gewonnen werden. Und wenn nicht? Bezahlen die Frauen, Kinder, Alten und Kranken die Zeche. Und die Soldaten, sprich: die Familienväter, Söhne mit ihrem Blut. Die Frauen mit ihren Kindern, ihren Alten und Kranken können später sehen, wie sie im Elend überleben. Meine Meinung zu Krieg: jeder Krieg ist ein Verbrechen, weil er zerstört, Leben und Besitz, Pläne und jegliche Moral. Ein Soldat, der Jahre im Dreck gekämpft hat wie seinerzeit vor Verdun, ist, wenn er überlebt, allzu häufig nur noch ein Schatten dessen, der er mal war. Vielleicht ist er nur körperverletzt, vielleicht invalide und nicht mehr arbeitsfähig, oft aber sind sie seelisch so zerschunden, sich selbst und ihrem Umfeld nur noch eine Zumutung. Mit allen unguten Auswirkungen auf ihre Kinder, die ein solches Unglück ertragen müssen. Von den Frauen nicht zu reden. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe sie erlebt, in dem Lungen-Sanatorium, in dem ich gearbeitet habe, diese menschlichen Wracks, die mit zerfressenen, zerfetzten Lungen aus dem Krieg zurückkamen. Viele von Anbeginn an Todeskandidaten. Deshalb: mir wäre am liebsten, wir hätten weiter unsere Reparationen bezahlt und alles gelassen, wie es war. Ich weiß, die Brüning’schen Notverordnungen während der Weimarer Republik waren schwer zu verkraften, die Kürzungen von Löhnen und Gehältern, das Ansteigen der Beiträge zur Sozialversicherung, der Steuern, das ganze Elend einer kaputten Wirtschaft, die nicht in Gang kam, die Not der Menschen. Ja, das alles hat die Menschen mürbe gemacht und bereit, einem neuen Heiland zu folgen. Und die Augen zu verschließen vor den ersten Anzeichen einer düsteren Unwetterwolke, die mit dem heutigen Tag dunkler und bedrohlicher ist als in den letzten Jahren.“
Emma war aufgewühlt. Sie hatte versucht, das alles ruhig und leise zu sagen, denn bereits seit sechs Jahren hatten sie sich angewöhnt, leise zu sprechen und darauf zu achten, dass niemand mithörte, so wie heut. Aber sie hatte sich wieder ungewollt ins viel zu Laute gesteigert.
„Die Reichsregierung erklärte 1936 die Wiederherstellung der deutschen Hoheit über die deutschen Flüsse Rhein, Donau, Elbe und Oder. Diese Flüsse waren laut Versailler Vertrag internationalisiert worden. Aber ich schlage vor, wir hören mit diesem Thema auf. Es gäbe da noch einiges. Ich hoffe, er erreicht auf anständige Weise, was er für unser Vaterland erreichen will“, sagte Paul, erschöpft und eher ungläubig den Kopf schüttelnd.
„Uns bleibt ja keine andere Wahl, als zu hoffen“, ergänzte Emma. „Was hat Luther gesagt: ‚Und wenn morgen die Welt untergeht, so will ich noch heute meinen Garten bestellen und mein Apfelbäumchen pflanzen. ‘ Wie wahr! Auch damals war Krieg, die Not groß und das Elend. Und die Menschen haben in ihrer jeweiligen kleinen Nische versucht zu überleben. Auch wir wollen überleben. Deshalb lass uns unseren Garten anschauen und auf andere Gedanken kommen.“
Emma fasste Paul an der Hand, sie erhoben sich vom Rand des Regenwasserbeckens und gingen den mit Ziegelsteinen zu beiden Seiten eingefassten Mittelweg entlang bis ans Ende, um dann auf dem Rückweg ihr kleines Haus und den ganzen Garten im Blick zu haben.
Links neben ihnen an der Seite des Kompostes reiften die ersten Reineclouden, grüne, runde Pflaumen, die, bevor sie honigsüß und erntereif waren, Harztropfen hervorbrachten, die an den Früchten herabglitten. Paul schluckte bei dem Gedanken an die saftigen Früchte mit dem außergewöhnlichen Geschmack. Zur Rechten reiften die bäuerlich wuchtigen Tonger-Birnen in warmen Herbstfarben, Ocker, Orange, Dunkelgrün und Rot. Noch waren sie hart. Sie brauchten bis zur Ernte noch einige warme, sonnige Herbsttage. Die Winterkartoffeln wuchsen vielversprechend, sie gediehen prächtig auf dem leichten Sandboden. Der Herrenhuter Apfelbaum hing voller rot-grün gestreifter großer Früchte. Sie konnten bald geerntet werden und würden im Dezember, mit weichem Tuch auf Hochglanz poliert und mit Bindfäden ausgestattet, einen farbenprächtigen Christbaumschmuck abgeben. Sie schäumten beim Hineinbeißen, wenn sie im Keller zur vollen Reife gelangt waren. Unter dem Eva-Apfelbaum im Gras lagen einige Früchte, die Emma und Paul aufhoben. Sie waren von Wespen angestochen, notreif, würden aber schon herrlich munden. Sie waren die kleinen Schönheiten unter den Äpfeln: zart lindgrün mit einem pink-farbigen Bäckchen auf einer Seite, kleine Engelsgesichter kurz nach erquickendem Nachtschlaf, kleine liebliche Köstlinge.
Sie kamen zu der zweiten Terrassenstufe, die Paul mit einer Natursteinmauer angelegt hatte, um in dem schräg nach hinten abfallende Gartengelände zu verhindern, dass Regen den knappen Mutterboden rückwärtig wegschwemmen konnte. Das Wasserspeichern war bei dem Sandboden eine Herausforderung. Nach jedem Regen versickerte das kostbare Nass viel zu schnell. Dem hatten Paul und Emma mit Torf, selbsterzeugtem Kompost und Dung aus ihrer eigenen Senkgrube entgegengewirkt, und sie würden weiterhin den Boden anreichern mit dem, was einmal jährlich mit eimergroßer Blech-Kelle aus ihrer selbst gefüllten Dunggrube als Gold des Kleingärtners auszuschöpfen und segenspendend zu verwerten war.
Die andere Terrassenstufe befand sich unmittelbar unterhalb des vorderen Gartenzauns. Hinter dem grün gestrichenen Holzlattenzaun war ein breites Beet angelegt, bestanden mit farbig blühenden Sträuchern, blauem Flieder, Weigelien mit ihren altrosa Blüten, maisgelben Forsythien und cremefarbigem Schneeball. Liebling der Familie eine Spiräe neben dem Gartentor. Bei Regen saugten sich ihre kleinen Blättchen und satten Blütenreihen voll Wasser, mit dem sie Eintretende mit sprühfeiner, breitgefächerter Regentaufe begrüßte, hochwillkommen an gewittrig-heißen Sommertagen.
Gleich hinter dieser Hecke, einem Blickfang Passanten gegenüber und beliebtes Revier für die Vögel des Gartens, stand die erste Natursteinmauer, einen knappen Meter hoch, mit viel Schweiß, großer Freude am handwerklichen Tun und den vielfältigen Farben der Natursteine von Paul aufgebaut. Emma brachte anschließend nach und nach Stauden vom Gärtner mit oder als Mitbringsel vom einen oder anderen Nachbarn. Zwischen die Ritzen gesteckt, gediehen sie innerhalb kürzester Zeit üppig und wuchsen zu dicken farbigen Polstern heran.
An der vorderen Hauswand wuchs an einem Holzgestell eine Ranke wilden Weins empor, nach und nach die gesamte Hausfront bedeckend, die sich im Herbst in den schönsten Rottönen färbte und ihrerseits Vögeln Nistgelegenheiten bot. Die gefiederten Freunde aßen die dunkelblauen Beeren frisch im Herbst und zu kleinen Mini-Rosinen eingetrocknet an kalten Wintertagen.
Auf der rückwärtigen Hausseite mit dem großen Wohnzimmerfenster zum kleinen Hof hin stand die Teppichklopfstange, gut zum Turnen für die Kinder, für Klimmzüge und Aufschwünge.
Der Hof schloss ab mit einem Drahtzaun zum Doppelhaus-Nachbarn, den Großeltern Hermine und Gustav. An diesem Zaun hatte Ute, die vierjährige Jüngste, ein eigenes Beet. Sie durfte hier alles selbst entscheiden. Sie wünschte sich Lilien. Emma hatte ihr geholfen, die Lilienzwiebeln fachmännisch, einen halben Meter tief, auf Sand einzugraben und dann viel zu gießen. Ute war entzückt über die großen, wundersamen Blüten, die aus diesen unscheinbaren Zwiebeln emporsprossen. Radieschen-Samen hatte sie ferner ausgewählt, rote, längliche Zeppeline mit weißen Spitzen. Oft kontrollierte sie am oberen Blätterschaft, wie groß ihre roten Lieblinge schon waren. Drei Monatserdbeerstauden hatten auf ihrer Wunschliste gestanden, die bis Oktober kleine, hocharomatische Früchtchen hervorbrachten.
„Mehr braucht ein Mensch eigentlich nicht“, sagte Emma, als sie noch einmal über ihren Garten schauten, in dem alles wuchs, in dem sie viele Stunden im Jahr verbrachten mit Arbeit, die Glück vermittelte, eine besondere Art von Glück, Glück mit Langzeitwirkung. Jede Woche ist irgendwas anders: etwas sprießt aus dem Boden, etwas anderes kann geerntet werden und im Winter stehen im Keller Einmachgläser in Reih und Glied, gefüllt mit Marmeladen, Gurken, Gemüse, Kartoffeln in einer Schütte, ein großes Fass mit Holzdeckel und Wasserrinne, gefüllt mit geraspeltem Weißkohl, in Gärung begriffen, um herrliches Sauerkraut zu werden. Möhren in einem sandgefüllten Steinkrug, die auch im Winter noch frisch gegessen werden konnten. Das eigene Gemüse war eine große Hilfe bei ihrem Bemühen, regelmäßig ihre Raten für das Haus zu überweisen. Sie kamen voran. Auch das machte sie zufrieden.
„War das nicht eine enorm gute Idee von mir, vor vier Jahren, als du aus der Kur zurückkamst, zu entscheiden, dass wir das Haus kaufen sollten?“, fragte Paul und legte Emma den Arm um die Schulter. „Es war die genialste Idee, seit wir verheiratet sind, Paul, du autoritärer Wahnsinniger! Ich habe eine Waschmaschine, teilmechanisch, sie kurbelt an meiner Stelle, die Miele-Presse quetscht das meiste Wasser aus den schweren Teilen. Vor der Wäsche kann ich die Wäsche zum Bleichen auf die Wiese legen, vorab in Bleichsoda eingeweicht und quasi vorgewaschen. Später hänge ich den ganzen Salat auf die Leinen im Garten, Sommer und Winter, alles gut durchlüftet. Im Winter steifgefroren, standfeste Wäsche sozusagen. Ich muss nicht mehr von morgens früh bis abends spät endlos viele Treppen erklimmen, wenn ich in Keller, Waschküche oder auf den Boden will. Ich muss auch nicht mehr mit den Kindern spazierengehen. Ute spielt gern in ihrer Sand-Ecke oder bei ihrer Freundin Bea in deren Sandkasten. Die Großen haben Freunde, spielen draußen auf der Straße, auf der nur ein Auto verkehrt, das des Großvaters Gustav, und die Kinder müssen nicht Rücksicht auf Straßenverkehr nehmen. Hinter den Häusern sind Wiesen und Äcker.“
Gegenwärtig machen sie Stoppelschlachten auf den abgeernteten Getreidefeldern, das heißt, sie reißen Büschel der Getreidestrünke mitsamt Wurzeln aus und bewerfen sich damit. Abends sehen sie aus wie zweibeinige Ferkel. Zwar müssten die Haare täglich gewaschen werden, aber den Umstand macht sich hier keiner. So sind auch in den Betten Sandspuren, auf den Betten, den Treppen, den Teppichen. „Warum eigentlich nicht?“, sagt Emma. „Kinder, die nicht in Watte gepackt werden, sind gesünder.“ Die Fakten geben ihr recht. Baden, Haare-Waschen inbegriffen, ist am Samstag angesagt. Bade-Fest in der Zinkwanne in der Waschküche. Nach jedem Badegang wird Seifenschaum abgeschöpft und ein Töpfchen frisches, heißes Wasser für den Nächsten nachgeschüttet. Spaß macht es auf jeden Fall. In der Woche reicht die Schüssel in der Küche für Gesicht, Hände und Füße.
„Was für ein gutes Leben wir haben“, sagt Emma und umfasst Paul, dankbar für alles, was sie vor sich sehen und gemeinsam erlebt haben, seit sie vor neun Jahren geheiratet haben. „Ja, meine Emma“, bestätigt Paul.
„Komm, ich zeig dir mal was Schönes.“ Emma zieht Paul hin zu ihren beiden Lieblingen. Rechts und links vom großen Wohnzimmerfenster zum Hof hin, haben sie kurz nach ihrem Einzug je einen Weinstock angepflanzt. Die Ranken reichen bis zur Dachrinne und werden von einem Holzgestell gehalten. In diesem Jahr tragen beide Weinstöcke zum ersten Mal. Die Trauben sind zwar noch grün, aber Emma zupft einige goldgrüne Beeren einer Traube vom linken und steckt sie Paul in den Mund. Paul verzieht zwar unwillkürlich sein Gesicht Richtung sauer, dann kaut er andächtig die Beeren und spürt ihrem Aroma nach: „Wie wunderbar“, sagt er schließlich, „wer hätte das gedacht! Der Versuch hat sich gelohnt. Und Du, mein Mädchen, kommst an deine heißgeliebten Weintrauben.“ Emma zieht Paul zur anderen Seite: „Diese hier sind rund, noch dunkelgrün, haben große Trauben, brauchen aber noch länger.“ Eine Hand unter einer Traube sagt sie, stolz lächelnd: „Schau dir das an, wie riesig!“
Paul muss noch arbeiten, wie an den meisten Sonntagen. Emma hat vor, mit Ute und Sportwagen zu den Bleichen zu gehen, einem kleinen Hof Richtung Stadt, nahe der Neiße, wo ein Wurf junger Boxer angekommen sein soll. Sie will sie nicht nur anschauen. Sie hat seit Wochen kleine Beträge ihres Wirtschaftsgeldes zurückgelegt. Paul wünscht sich einen Boxer. Auch Emma denkt seit langem an einen Hund, jetzt, wo die beiden Großen an den Vormittagen in der Schule sind und auch Ute in absehbarer Zeit eingeschult wird.
Zuvor macht Emma für Paul einen Malzkaffee aus selbst gerösteten Gerstenkörnern. „Du willst doch sicher noch deine ‚Krönungs-Kuchen-Krusten‘ aufessen“, sagt sie und stellt die dampfende Tasse auf seinen Schreibtisch.
Am späteren Nachmittag kommt sie zurück, Ute im Sportwagen, den achtwöchigen Boxer-Welpen Rocco auf ihrem Schoß, der bereits unterwegs Erfahrungen mit einem Zitronenfalter gemacht hat, den er fangen wollte und dabei kopfüber aus dem Wagen purzelte.
Emma schleicht bei ihrer Rückkehr zusammen mit Ute auf Zehenspitzen ins Herrenzimmer, den Zeigefinger Richtung Ute auf den Lippen und hält Paul den warmen, seidenweichen Hund von hinten an die Wange. ‚Ihr sollt mich doch nicht beim Arbeiten stören‘, wollte Paul gerade sagen. Stattdessen ist ein überraschtes, freudiges: „Nein, das gibt’s doch nicht“, zu hören. Paul steht so schwungvoll auf, dass sein Schreibtischstuhl schwankt und dann umkippt, nimmt den neuen Familien-Zuwachs in beide Hände und hält ihn sich an die Nase, um ausgiebig an ihm zu schnuppern, den Welpen an sich schnuppern zu lassen und seine Wärme zu empfinden, dann hält er das Hunde-Baby hoch in die Luft, um ihn eingehend zu betrachten und zu bewundern. Rocco hat einen dicken Milchbauch und weiche Beine, die den Tonnenbauch noch nicht tragen können. Deshalb rudert er, als Paul ihn auf den Boden setzt, mit seinen vier Gummibeinen und bewegt seine Milchtonne rutschend durch das Herrenzimmer. „Was für ein Prachtbursche“, findet Paul und nimmt Emma und Ute in die Arme. „Willkommen in unserer Familie, du kleiner Hundemann, hochwillkommen auch zur Verstärkung des unterrepräsentierten männlichen Teils der Familie. Wir zwei Männer müssen gegen so viele Frauen zusammenhalten, was meinst du?“ Paul hat den kleinen Milchsack wieder hochgehoben. Er hängt, alle vier Pfoten abwärts baumelnd wie weiche Würste, in Pauls Händen und schaut mit großen, samtig-braunen, neugierigen Augen aus seiner zerfurchten Faltenstirn. Sabber tropft aus seinen schwarzen, seidenweichen Lefzen.