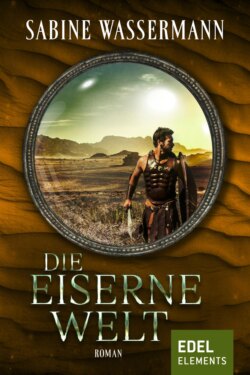Читать книгу Die eiserne Welt - Sabine Wassermann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеDie Nacht verdeckte die Spuren der Zerstörung, Heria wirkte unverletzt. Die Stadt lag im Schlaf, ihre weiß getünchten Häuser in der Dunkelheit waren nur fahl schimmernde Mauern im Sternenlicht. Auf den Flachdächern lagen ihre Bewohner und ersehnten im Schlaf einen kühlenden Windhauch herbei. Hier und da erhellte ein Öllämpchen ein Fenster; vielleicht hielt die Sorge um das Brot des nächsten Tages jemanden wach. Die Stadt wirkte wie immer, doch Geeryu roch verbranntes Holz, verbrannte Vogelfedern, verbrannten Stolz. Mochte es auch nur die Erinnerung daran sein. An den unregelmäßig vorspringenden Ziegeln eines Mäuerchens entlang, das Heria von der Schlucht trennte, tastete sie sich mühsam vorwärts. Wohin, das wusste sie, aber nicht, warum. Mochte der Palast in alter Pracht erstrahlen, was sollte sie dort? Mallayur war tot. Das Zuhause, das er ihr geboten hatte, existierte nicht mehr; sie hatte ihn überlebt. So war es in ihrem langen Leben immer gewesen.
Sie gelangte an einen Platz, gesäumt von Händlerhäusern und der Palastmauer. Auch wenn Geeryu wenig erkennen konnte, so doch, dass das Tor geschlossen war. Kein Licht, keine Wächter. Sie sank auf die Pflastersteine. Ausruhen, nur kurz. Atem schöpfen. Dies fiel ihr noch immer schwer, wenngleich die Schmerzen nachgelassen hatten. Nur in solchen Momenten, wenn ihre Kraft, sich mittels ihrer göttlichen Gabe über den Boden schweben zu lassen, erschöpft war, fühlte es sich an, als wühle die Klauenpfote des Schamindar in ihrer Brust.
Wohin? Wohin? Vor einigen Stunden hatte sie ihren Hunger in einer Bauernkate gestillt, nachdem die Bewohner angesichts ihrer Augen und eigenartigen Bewegungen fortgelaufen waren. Nun plagte sie Durst. In Mallayurs Palast hatten die Sklaventiere ihr jeden Wunsch von den silbernen Augen abgelesen. Wer sollte jetzt ihre Bedürfnisse stillen?
Wer sollte wenigstens ab und an vergessen, dass sie eine kalte Halbgöttin war? Mallayur war ein törichter, von Ehrgeiz und Neid gegenüber seinem so viel mächtigeren Bruder zerfressener Mensch gewesen, aber ihm war es gelungen. Ihre Augen hatten ihn nicht erschreckt, als sie zu ihm gekommen war, um ihm anzubieten, den Gott zu fangen.
Sie kämpfte sich zurück auf die Füße. Der Wunsch, die Beine zu bewegen, kam ihr beständig in die Quere, so dass ihre Konzentration ins Wanken geriet und sie wie eine Betrunkene hin und her schwankte. Würde das eines Tages besser werden? Wenn sie sich genug anstrengte, sicherlich. Aber dieser eine Tag schreckte sie, wie auch die anderen davor und danach, einer wie der andere ... Wozu all die Tage, all die Mühen? Wozu?
Ihre Schulter stieß gegen einen der zwei aufragenden, mit blauen Schmuckfliesen verkleideten Torpfeiler. Hier begann die Brücke zu Argad. Ein Tor gab es nicht, denn die Zeiten, da sich Argad und Hersched bekriegt hatten, lagen unendlich lange zurück. Geeryu schwebte über die hölzernen Brückenbohlen. Sie warf die Arme auf die Brüstung und zog sich ein Stück hoch, so dass sie in die Schlucht blicken konnte. Zu sehen gab es nichts, da war nur ein gewaltiger Fluss aus Schwärze, mit glatten Kanten, der entstanden war, weil Inar, der höchste aller Götter, die Hochebene mit einem Schwerthieb geteilt hatte.
Der Wind pfiff durch die Schlucht und ließ die Felsengrasbüschel an ihren Wänden gegeneinander kratzen, das einzige Geräusch der schlafenden Städte. Geeryus Haare bauschten sich. »Vater, bist du es?«, fragte sie. Ob er ihre Bitte erfüllt hatte? Eines Tages würde sie es erfahren. Wollte sie wirklich wegen dieses Tages ausharren? Vergiss das alles, schien ihr die Schwärze lockend zuzuflüstern. Du bist mit einem langen Leben geschlagen, aber deshalb nicht unsterblich. Komm, ich beweise es dir ...
Geeryu zwang die Luft, ihr Bein auf die Brüstung zu heben. Doch bevor sie das andere folgen lassen konnte, packten zwei kräftige Hände ihre Schultern und zogen sie zurück.
»He, was tust du denn da?«, sagte jemand hinter ihr, ein Mann, dessen Stimme verriet, dass er über ihr Ansinnen erschrocken war. Alle Kraft sickerte aus ihr wie aus einem aufgeschlitzten Beutel, und sie sackte auf die Brückenbohlen. Zwei Männer waren es, die sich über sie beugten. Einer hielt eine Fackel; die zuckenden Flämmchen beleuchteten auf weiße Hemden aufgenähte Bronzeplättchen. Es mussten die beiden Torwächter sein, die gleich jenseits der Brücke den Eingang in den Palast von Argadye hüteten.
»Völlig zerlumpt ist sie. Und mager wie ein Kind. Die braucht dringend etwas zu essen und ein Bad.«
»Vor allem jemanden, der sie davon abhält, ihr Leben wegzuwerfen. Was machen wir jetzt mit ihr?«
»Ich besorge rasch einen Sklaven, der soll ... Inar und alle Götter! Siehst du das? Ihre Augen glänzen wie in Silber gegossen. Ist das etwa die Wassernihaye?«
»Nein. Die hat grüne Augen und rotes Haar. Und die kann ja nicht hier sein, denn hat sie der Meya nicht mit dem Ersten der Zehn nach Temenon geschickt?«
»Das stimmt. Wer bist du?« Der Mann schrie, als sei sie schwerhörig. Geeryu war zu müde, um zu antworten. Eine Hand klatschte gegen ihre Wange, auch das störte sie nicht.
»Stirbt sie?«
»Eine Nihaye? Die werden uralt, heißt es. Lebte nicht im Palast von Heria eine Nihaye? Aber man hat nie wieder von ihr gehört. Wenn sie es ist ...« Die restlichen Worte prallten von Geeryu ab. Sie ahnte, dass sie wieder in einen langen Schlaf abzugleiten drohte, und wusste nicht, ob sie das wirklich wollte. Schlaf brachte Ruhe, aber auch Träume.
Sie fühlte sich hochgehoben. Weiter schwebte sie, diesmal auf den kräftigen Armen eines argadischen Palastwächters. Nur erahnen konnte sie, dass er sie in die Kühle des Palastes trug, treppauf, durch verwinkelte Korridore, treppab, immer weiter. In ihrer Benommenheit kam ihr das Geschaukel endlos vor. Hatte sie jemals zuvor diesen anderen Palast betreten? Sie konnte sich nicht darauf besinnen. Endlich gab sie auf, gegen den Schlaf anzukämpfen; sie hoffte nur, dass es ein kurzer sein möge, wie er den normalen Menschen vergönnt war. Die Hände fremder Frauen, die sie wuschen, die Blütendüfte und feinen Stoffe, die sie umhüllten, geschah dies wirklich? Leise Stimmen schwirrten um sie herum. Geeryu ermahnte sich, die Lider geschlossen zu halten, damit es nicht wieder Schrecken und Geschrei gab.
Irgendwann wurde es ruhig; die weiche Unterlage lud ein, an nichts mehr zu denken.
Keine Träume plagten sie diesmal. Und als sie erwachte, waren keine Wochen, Monate vergangen, nur der Rest der Nacht. Die ersten Sonnenstrahlen stahlen sich in das Gemach. Vorsichtig, um niemanden zu erschrecken, spähte Geeryu durch die halb geschlossenen Lider. Zwei Wüstenfrauen, gekleidet in weiße Kittel, die mit türkisen Borten, der Farbe Argads, geschmückt waren, knieten vor einem Mann, der offenbar soeben eingetreten war. Ein seidiger Mantel umhüllte ihn, aber seine unordentlichen grauen Haare und die zerknitterte Miene verrieten, dass er aus dem Schlaf gerissen worden war. Madyur-Meya nahm einen dargebotenen Becher, kippte den Inhalt hinunter, schüttelte sich und rieb sich die faltige Stirn, während er den gemurmelten Erläuterungen eines Palastkriegers lauschte. Vermutlich war es jener, der sie hergetragen hatte.
Madyur nickte; der Mann verneigte sich tief, mit einer Hand an der Brust, und verschwand aus Geeryus Blickfeld. Der Großkönig, der Beherrscher des gesamten Hochlandes, der Träger des selten vergebenen Titels Meya, näherte sich ihr. Geeryu starrte ihn an, verfolgte jede seiner Bewegungen, unfähig, die Augen vor ihm zu verschließen. Langsam ließ er sich auf der Bettkante nieder. Er wirkte um einiges älter als die drei Jahre, die ihn von seinem Bruder getrennt hatten. Mitte der vierzig war er, ganz der erhabene Herrscher, selbst jetzt.
Nachdenklich rieb er sich das stoppelige Kinn. »Du bist Geeryu, richtig?«
Sie nickte.
»Ich hörte, du seist tot.« Sein Blick wanderte zu ihrer Brust, und da wusste sie, dass Anschar ihm alles erzählt hatte. Weshalb auch nicht? Eine mächtige Nihaye besiegt zu haben, war eine Tat, die ein Krieger sicherlich gern zum Besten gab. Madyur griff nach dem Laken, das ihren Körper bedeckte, verharrte, und da sie keine Anstalten machte, ihn zu hindern, zog er es herab, bis ihre Brust entblößt vor ihm lag. Angesichts der Narbe verengten sich seine Augen.
»Die Götter haben nicht zugelassen, dass ich sterbe«, stieß sie in einem Anflug von Stolz hervor und schlug das Laken wieder hoch. »Falls dein Krieger noch lebt, werden sie ihn dafür strafen.«
Aus seinem Schweigen sprach Ungeduld. Sollte er nicht vor Ehrfurcht erstarren, eine Nihaye vor sich zu haben? Nein, nicht er.
»Wo warst du all die Monate?«
»Ich habe geschlafen.«
Auch das beeindruckte ihn nicht. »Ich habe viele schlimme Dinge über dich gehört«, sagte er unvermittelt.
Sie leckte sich über die trockenen Lippen. »Von ihm, ja?«
»Sollte ich ihm nicht glauben?«
»Er hasste mich, weil er Mallayur gehasst hat. Dafür konnte ich nichts. Ich habe deinen Bruder nur zu verteidigen versucht.«
»Du hast mir den letzten Gott vorenthalten.« Er neigte sich vor. Jedes Fältchen konnte sie erkennen, jedes Äderchen an seinen Schläfen, jeden Fleck in seinen dunkelbraunen Augen. Ihre silbernen Augen schienen ihn nicht zu beeindrucken. »In den Palastkeller drüben hast du ihn gesperrt, obwohl du wusstest, dass er mir gebracht werden musste!«
Dieses herrische Vorpreschen! »Ich tat nur – ich tat immer nur, was dein Bruder von mir wollte«, verteidigte sie sich.
Er presste die Lippen zusammen, schien darüber nachzusinnen. Die Ärmel seines Seidenmantels knisterten, als er die Arme verschränkte. »Was soll ich jetzt mit dir machen?«
Keinen Augenblick hatte sie darüber nachgedacht, was es bedeuten mochte, in dieses Haus getragen worden zu sein. Innerhalb eines Herzschlags wurde es ihr klar. Dies war der einzig denkbare Ort, der das Leben erträglich machte. Und die Möglichkeit bot sich ihr nur, weil Anschar nicht da war. Er hätte es zu verhindern gewusst. »Du warst so begierig darauf, eine Nihaye zu besitzen, dass du die Rothaarige hattest einsperren lassen. War es nicht so? Und bei mir überlegst du?«
Sie hatte ihn überrumpelt. »Wie nützlich ihre Gabe war, wusste ich immerhin«, knurrte er. »Bei deiner bin ich mir nicht so sicher. Was ist das eigentlich, was du kannst? Anschar hat zwar einiges erzählt, aber wirklich begriffen habe ich es nicht.«
»Muss ich es dir zeigen, damit du mir deine Gastfreundschaft gewährst?« Sie hob eine Hand, spreizte die Finger und tat so, als berühre sie einen unsichtbaren Gegenstand. Zugleich befahl sie der Luft, sich sanft zu härten und über Madyurs Wange zu streichen. Seine Augen weiteten sich. Er fasste sich ins Gesicht, aber bevor er das Luftpolster greifen konnte, löste sie es auf.
»Unsichtbare Hände. Geheuer ist mir das nicht«, sagte er ungehalten. »Aber selbstverständlich gewähre ich dir Gastfreundschaft. Unter der Bedingung, dass du deine Gabe bezähmst. Grazia hat mit ihrer Wasserkraft schon für reichlich Aufsehen gesorgt – die Aufregung möchte ich nicht erleben, wenn du mit etwas herumspielst, das man nicht sehen kann. Du lässt deine unsichtbaren Finger bei dir, hast du verstanden?«
Seine Verwirrung war gänzlich verschwunden, stattdessen hatte er mit der dröhnenden Selbstsicherheit gesprochen, für die er bekannt war. Geeryu nickte ergeben. Was konnte man diesem Mann entgegensetzen? Mallayur hatte einiges versucht, aber es war ihm nur selten gelungen, den Stolz des Bruders zu verletzen. So klein wie er fühlte sie sich nun auch. Madyur nickte zufrieden und erhob sich.
»Die Wachen hatten erwähnt, dass du ziemlich herumgewankt bist. Hast du dich irgendwo am Fuß verletzt?«
»Nein, ich bin nur erschöpft.«
»Dann ruh dich aus. Dieses Gemach ist dein, solange es nötig ist.«
Niemand wusste, dass sie von der Brust an gelähmt war. Und so sollte es bleiben. Sie würde lernen, damit umzugehen. Damit zu kämpfen. Sie wandte den Kopf ab, sah nicht mehr hin, wie der Meya das Gemach verließ. Genüsslich schlug ihr bei dem Gedanken, dass Anschar und seine dumme Rothaarige nichts mehr gegen ihre Anwesenheit im Palast unternehmen konnten, das Herz in der schmerzenden Brust. Beinahe bedauerte Geeryu, dass sie ihren Vater gebeten hatte, sie zu töten. Wenn sie die Augen schloss und die Gedanken wandern ließ, sah sie sie still daliegen. Käfer krochen unter ihre Haare, suchten sich Öffnungen in ihre Leiber. Ein sanfter Wind blies Sand über die starren Glieder.
Grazia kletterte aus der Sänfte, rutschte hinter Anschar, der ihr Sturhorn führte, und legte die Arme um ihn. Freudig brummte er etwas, auch wenn sie ihn nicht, wie sie es zuvor so gern getan hatte, erfrischen konnte. Ihre Hände blieben trocken. Auch ihr Mund war eine knirschende, klebrige Höhle, aber sie brachte es nicht über sich, um einen Schluck Wasser zu bitten. Zu heftig klagte sie sich an, an dem Mangel gleich in zweierlei Hinsicht schuld zu sein: Sie war nicht fähig, Wasser zu schaffen, und hatte sinnlos einen großen Vorrat vernichtet. Seit zwei Tagen waren sie wieder unterwegs, und jeder trank nur das Allernötigste.
»Was ist?«, fragte Anschar.
Hatte sie aufgeseufzt, ohne es zu merken? »Es ist nichts, nur ... mir fehlt mein Korsett. Mir schmerzt der Rücken.«
»Dass du es nicht mehr hast, ist das einzig Gute an der Sache. Würdest du nicht so dickköpfig an deinen alten Sachen hängen, wäre dein Rücken nicht so schlaff.«
»Sei nicht so brummig.«
»Hast du Durst?«
»Nein!«
Er knüpfte einen Wasserbeutel vom Sattel und warf ihn sich auf die Schulter. Grazia wollte protestieren, doch die Gier siegte, und sie griff zu. Wie selbstverständlich es gewesen war, jederzeit das köstlichste Wasser zur Verfügung zu haben! Nun musste sie sich nach drei Schlucken warmer, schaler Brühe zwingen, den Lederschlauch abzusetzen. Sie verschnürte die Öffnung und gab den Beutel zurück. Steh es einfach mit preußischer Disziplin durch, mahnte sie sich. Die Dame, die morgens Honigbrötchen, mittags Homer und abends Zerstreuungen brauchte, war zwangsläufig mit dem Schweiß an ihr heruntergeflossen.
Die Sorge um das Wasser verdrängte ihre Gedanken an das, was mit ihr im Lager der Sklavenfänger geschehen war. Oder beinahe geschehen war. Es kam ihr so vor, als sei es vor langer Zeit geschehen, und so, sagte sie sich, hatte auch der Durst sein Gutes. Von jenen, die ihre Schmach mit angesehen hatten, lebten nur noch die beiden Sklaven, und die plagten eigene Sorgen. Grazia blickte über die Schulter zurück. Im schattigen Sänftenrund lag Ralaod, vom Schaukeln in den Schlaf gewiegt, und weiter hinten ritten die beiden fremden Wüstenmenschen auf einem der herschedischen Sturhörner.
Der Mann lenkte folgsam das Tier, ohne aus der Karawane auszuscheren. Wo sollte er auch hin? Das wenige Wasser war unter den Wüstenmenschen verteilt, nur die beiden hatten nichts bekommen; sie mussten erst bitten, wenn sie trinken wollten. Hinter ihm saß die Frau, hatte die Arme um seine Mitte gelegt und den Kopf auf seine Schulter gebettet. Die Kapuze ihres Mantels verdeckte gänzlich ihr Gesicht. Jählings ging ein Ruck durch sie, und sie deutete über seine Schulter hinweg voraus. Er zerrte so heftig an den Zügeln, dass das Tier mit tiefem Knurren den Kopf hochwarf.
»Nicht weiter!«, schrie er. Gleichzeitig geriet der Grund unter Anschars Sturhorn in Bewegung. Rasch trieb er es seitwärts von der tückischen Stelle fort. Kleine Krater und Gräben erschienen im Sand. Dann hörte es so schnell auf, wie es begonnen hatte. Doch einer der Gräben bildete sich fort, wurde zu einer breiten, gezackten Linie; plötzlich sackte eine ganze Düne ein und gab den Blick auf einen Erdspalt frei, der sich mitten durch die Wüste zog und dabei stetig breiter wurde.
Anschar zeigte auf die beiden Gefangenen, bedeutete ihnen, abzusteigen, und winkte sie herbei. »Ist das die Schlucht, von der ihr gesprochen habt?«, fragte er, als sie an der Seite seines Sturhornes standen.
Der Wüstenmann nickte. »Ja, dort unten ist die Stadt. Man muss nur dem Spalt folgen.«
»Und irgendwo einsacken?«
»Nein, er wird zu breit, um zugeweht zu werden, du wirst es sehen.« Er fiel auf die Knie und presste die Stirn in den Sand. »Es sind nur noch ein paar Stunden zu laufen«, er streckte einen Arm aus, ohne aufzusehen. »Ich schwöre beim Herrn des Windes und meinen Ahnen, dass es so ist. Dort bei der Stadt gibt es auch einen Weg hinunter, der breit genug für die Tiere ist. Du brauchst uns nicht mehr. Lass uns gehen.«
»Gehen?« Verständnislos blickte Anschar auf ihn hinab. »Wohin denn?«
»Irgendwohin, nur nicht dort hinunter.«
»Ihr werdet sterben, das weißt du.«
Gemeinsam mit seiner Gefährtin hob der Wüstenmann den Kopf. Beide waren eines Sinnes, das ließ sich unschwer von ihren gramgebeugten Gesichtern ablesen. »Das werden wir so oder so. Dann lieber in Freiheit.«
Anschar drehte sich im Sattel und wechselte mit Parrad einen fragenden Blick. Am liebsten hätte Grazia sich vor Scham unsichtbar gemacht. Zum wievielten Male ballte sie nun die Fäuste in dem Versuch, Wasser zu erzeugen, bis ihre Schläfen pochten? Und zum wievielten Male war alle Anstrengung umsonst?
»Geht«, sagte Anschar. Füße scharrten im Sand. Als sich Grazia umwandte, waren die beiden bereits zwei kleiner werdende Schatten, die über den grellen Sand huschten. Die Männer starrten ihnen nach. Ihr einstmals erdiger Hautton war heller und gräulich, wie mit Staub bedeckt. War es Dreck? Oder Angst?
»So schnell, wie die laufen, frage ich mich, ob wir es ihnen nicht gleichtun sollten«, hörte sie Parrad missmutig in den Bart brummen. Einer der Männer band das herrenlose Sturhorn ans Ende des Zuges, dann ging es weiter, mit einem gehörigen Abstand zu dem Spalt, der sich im Laufe der nächsten Stunden tatsächlich zu einer richtigen Schlucht weitete. Sandkörner rieselten an den Kanten hinab und legten sich auf gezackte Simse. Aus senkrechten Spalten reckten sich Felsengras und Dornengewächse, und manchmal waren ihre Ränder gesprenkelt, wie mit Tierkot. Schließlich brachte Anschar das Sturhorn zum Stehen.
Alle stiegen ab. Er kniete an der Felskante, schob die Kapuze zurück und stützte sich mit den Händen dicht am Rand auf; sein Blick glitt in beide Richtungen die Schlucht entlang. »Ich glaube, hier kann man hinabsteigen. Der Gedanke, es dort zu tun, wo einen die ganze Siedlung anstarren wird, gefällt mir nicht so recht.«
»Hier?«, fragte Parrad. »Sollen wir uns die Hälse brechen?«
»Warum so abgeneigt? Vorhin hast du noch überlegt, den beiden hinterherzurennen, um zu sterben. Mir scheint ein gebrochener Hals die angenehmere Todesart zu sein. Außerdem will ich ja allein gehen.« Über die Schulter hinweg musterte Anschar ihn so eindringlich, als sähe er ihn zum ersten Mal. »Mit euren sandbedeckten Bärten seht ihr alle gleich aus. Willst du, dass man euch für die entlaufenen Sklaven hält?«
»Wir sehen überhaupt nicht alle gleich aus!«, empörte sich der Wüstenmann. »Du wirst deinen argadischen Hochmut selbst im Angesicht des Todes nicht ablegen!«
»Parrad.« Anschar erhob sich und deutete in die Schlucht. »Irgendwo da unten sind herschedische Sklavenfänger. Glaubst du, die können euch unterscheiden? Die Fuchtelei mit dem Rollsiegel wird irgendwann auch nichts mehr helfen.«
Parrad schnappte heftig nach Luft, doch bevor er etwas entgegnen konnte, ging Grazia auf ihn zu. »Bitte sei jetzt ruhig. Er will euch doch nur schützen.«
»Und wir wollen nicht nutzlos sein. Verzeih, Herrin.« Sichtlich zerknirscht neigte er den Kopf.
»Wenn ich da hinabsteige, ist mein Leben in deiner Hand.« Anschar ging an ihm vorbei zu seinem Sturhorn und machte sich an den Verschnürungen der Beutel zu schaffen. »Wir müssen die Zügel aneinanderknüpfen.«
»Du willst das wirklich tun?« Grazia lief zu ihm. »Nein. Das geht nicht! Ich will mit dir gehen, aber diese steile Felswand hinunter, das schaffe ich niemals.«
»Feuerköpfchen ...«
»Nein!«
In diesem Wort lag alles, was sie plagte: dass jemand sie erneut fangen, sie erneut überwältigen könnte; und Anschar, der allein sie davor bewahren konnte, wäre wieder nicht da. Lieber wollte sie sich mit ihm in dieses Sklavenfängerdorf begeben, wo die Gefahr am größten war.
Sie stellte sich auf eine Auseinandersetzung ein, die sie am Ende verlieren würde. Keinesfalls würde er das dulden. Doch in seinen dunklen Augen stand das Begreifen. Er nickte langsam und schüttelte sogleich den Kopf über seine Entscheidung. »Das ist vollkommen unvernünftig. Aber ein Auge auf dich haben zu können, ist mir nach allem, was passiert ist, doch wirklich lieber.« Er fuhr zu den anderen herum und deutete auf sie. »Fleht zu eurem Sandgott, dass ich das nicht bereuen muss! Das ist ohnehin das Einzige, was ihr jetzt tun könnt.«
Er half ihr in den Sattel und schwang sich vor ihr auf. Weitere Anweisungen gab er nicht, und es fragte auch niemand. Warum auch? Ein Scheitern bedeutete ihrer aller Tod. Grazia legte die Arme um seine Mitte, und schon geriet der muskulöse Rücken des Sturhorns unter ihr in Bewegung. Nach einigen Schritten löste Anschar den dünnen Wasserbeutel und gab ihn ihr. »Trink noch einmal«, befahl er, und sie gehorchte.
»Wir werden flehen!« Es war Ralaod, die hinter ihnen herschrie. Grazia schnitt es ins Herz. Die Trauer über den Verlust ihrer Gabe hätte sie in Tränen ausbrechen lassen, wäre sie nicht auch der Fähigkeit des Weinens beraubt.
Mit einem kräftigen Zügelzug lenkte Anschar das Tier an den Rand der Spalte. Hin und wieder tat er das, und dann musste Grazia das Gesicht abwenden, da sie befürchtete, die Kante könne unter dem Gewicht wegbrechen. Manchmal löste sich ein Stück vom Fels, das polternd in die Tiefe fiel. Sie beklagte sich nicht, denn sie wollte nicht übermäßig ängstlich sein, und nach allem, was bisher geschehen war, sagte sie sich, dass das Kommende keinen großen Schrecken mehr bergen konnte.
Die Schlucht verbreiterte sich weiterhin. An der gegenüberliegenden Wand zeigten sich abwechselnd dunkle und helle Felsschichten. Die Sonne ließ das Gestein glitzern, als stecke Erz darin. Schatten winziger Echsen huschten darüber hinweg, als einziges Zeichen tierischen Lebens. Wenn Grazia einen Blick in die Tiefe wagte, entdeckte sie das allgegenwärtige Gras in den Felsspalten. Unten im Schatten formte es sich zu lückenlosen Wandteppichen. Nicht einmal die schlimmste Wüstenhölle konnte es aufhalten.
»Da!«, stieß sie hervor. »Wasser! Siehst du es?«
»Ja.« Anschar ruckte an den Zügeln, und das Sturhorn stand still. Vorsichtig reckte Grazia den Kopf. Dort, am Grund der Schlucht, war ein Tümpel, halb vom Gras zugewachsen. Es schien nicht mehr als ein Dreckloch zu sein, mit einer grauen, trüben Wasseroberfläche, und doch verheißungsvoll wie ein Springbrunnen.
Grazia litt unter ihrem Durst, aber sie schwieg, damit Anschar ihr nicht wieder seinen Wasserbeutel reichte. Den ganzen Tag hatte sie ihn nichts trinken sehen. Entschlossen schluckte sie den trockenen Klumpen, der ihren Mund auszufüllen schien, hinunter. »Wenn da unten Wasser ist, stimmt es wohl, dass es auch eine Stadt gibt.«
»Dort ist noch ein Tümpel. Oder eine Quelle oder was auch immer.«
»Wir schaffen es«, flüsterte sie in Anschars Rücken und drückte das Gesicht in den Stoff seines Mantels. »Wir schaffen es ...«
»Ja.« Er war wortkarg und klang müde. Grazia legte die Arme um seine Mitte und schloss die Augen. Es galt, nur noch eine Weile durchzuhalten. Was sie erwarten mochte, wenn sich diese Leute als feindlich entpuppten, daran wollte sie nicht denken. Das stetige Wanken des Sturhorns machte sie schläfrig, und als sie Stimmen hörte, war ihr, als sei sie eingenickt. Es klang wie das Gewimmel eines Marktes. Sie reckte den Kopf über Anschars Schulter. Aus dem Geflirr der Hitze schälte sich ein Zelt.
Als sie bis auf wenige Meter heran waren, warf jemand die Eingangsplane zurück und trat heraus. Der schlaksige junge Mann erstarrte. Sein Kinn sackte herab, und er deutete mit einem bebenden Finger auf sie. Anschar brachte das Sturhorn zum Stehen, doch bevor er etwas sagen konnte, stolperte der Junge zur Schlucht und schwang sich über die Kante.
Unwillkürlich kniff Grazia die Augen zusammen, in Erwartung eines hässlichen Geräusches, das den Aufschlag des Körpers verriet. Stattdessen hörte sie den Jungen rufen, und als sie die Augen öffnete, hatte Anschar das Tier an den Rand der Schlucht gelenkt. Nun sah sie, dass es hier nicht ganz so steil bergab ging. Eine schmale, vielfach gewundene Serpentine führte hinunter. Der Junge schlitterte mehr, als dass er lief; er sprang das letzte Stück, stob inmitten von Menschen herum und deutete herauf.
»Das soll eine Stadt sein?«, brummte Anschar. »Nichts als ein Haufen dreckiger Hütten und Zelte. Jetzt halt dich gut fest und sieh nicht hin.«
Ohne Federlesens ließ er das Sturhorn dem Weg des Jungen folgen. Es bockte, und er musste mit der Peitsche nachhelfen. So schmal war der Weg, dass Grazia überzeugt davon war, das Sturhorn müsse seitlich hinabkippen. Es stieß schnaubende Protestlaute aus; sein Schwanz schlug wütend gegen den Fels. Geröll polterte in die Tiefe. Sie spürte, wie Anschar ihr mit dem linken Arm Halt gab. Es kostete sie ihre ganze Selbstbeherrschung, nicht zu schreien, und als ihr Knie gegen einen vorspringenden Grat schrammte, biss sie in sein Hemd.
»Du kannst die Augen wieder aufmachen«, sagte er. Äußerst zögerlich reckte sich Grazia und blickte über seine Schulter hinweg. Noch hatten sie den Abstieg nicht vollendet; zwei, drei Meter fehlten. Anschar hielt die Zügel kurz, so dass das Tier innehielt. Oder war es die Zeit selbst, die stillstand? Sturhörner liefen frei herum, aber niemand von den vielleicht zweihundert Menschen hier unten rührte sich; alle wirkten wie in ihren Bewegungen erstarrt. Kein Lüftchen regte sich, um mit den langen, schweißgetränkten Haaren zu spielen. Im ersten Moment meinte Grazia, jede dieser Gestalten sehe aus wie die andere, doch dann entdeckte sie zwischen all den kriegerisch wirkenden Männern Greise, schlaksige Halbwüchsige, Frauen und Kinder. Sie alle bevölkerten eine Straße, die das Dorf der Länge nach durchschnitt. Seidich davon, bis hin zu den Felswänden, überwucherten Hütten und Zelte aus dunklem Echsenleder und geflochtenem Gras den Grund der Schlucht. Und wie jene Männer um Bedyadrur, den Sklavenfänger, waren auch die Bewohner dieser armseligen Behausungen in Kleidung gehüllt, die vornehmlich aus Leder und Bast bestand. Nur wenige hatten Stoffe, in erdigem Rot gefärbt, am Leib.
Ein solcher Mann, fast schwarz gebräunt und mit wettergegerbtem Gesicht, trat vor und legte den Kopf in den Nacken. »Wie habt ihr uns gefunden?«
»Jemand sagte, wir sollen der Schlucht folgen.« Anschar streifte seine Kapuze ab. Dann wies er mit einer belanglosen Handbewegung in die Höhe. »Irgendein Wüstenhund. Ich hatte schon befürchtet, er schickt uns in die Irre.«
»Wo ist er? War er allein?«
»Es waren zwei. Doch frage nicht weiter. Ich habe sie längst vergessen, und mit trockener Kehle fällt ohnehin jedes Wort schwer. Wir brauchen Wasser.«
Anschar lockerte die Zügel und schlug gegen den Hals des Sturhorns. Es sprang hinab. Der Aufprall rüttelte Grazia durch, so dass sie von der Kruppe rutschte. Es gelang ihr, auf den Füßen aufzukommen. Anschar folgte ihr. Sofort trottete das Sturhorn zum nächstgelegenen Tümpel, stieß die armlange Zunge ins Wasser, rollte sie zusammen und begann zu schlürfen. Der mächtige Schädel schnellte in die Höhe, ein markerschütterndes Brüllen kam aus dem Maul. Zornig wühlte das Tier mit seinem Hornstumpf die Oberfläche auf.
»Die Tümpel sind salzig«, erklärte der Mann. »Davon ernährt sich nur das Felsengras, falls es das überhaupt tut. Nehmt lieber das.« Er warf Anschar einen Lederbalg zu; der fing ihn, hatte einen Atemzug später den Stopfen herausgezogen und den Balg an die Lippen gesetzt.
»Trink«, murmelte er und legte das halb geleerte Behältnis in Grazias Hand. Nicht weniger gierig schluckte sie das warme, doch wohlschmeckende Wasser. Ein Junge, bis auf eine lederne Schamkapsel zwischen den Beinen vollkommen nackt, schleppte mit zwei Händen einen Lederbeutel heran, den er vor dem wild schnuppernden Sturhorn ablegte und öffnete. Die Hälfte des Wassers ergoss sich auf den Felsboden, als es soff.
»Danke«, sagte Anschar. »Wir brauchen mehr Wasser – viel mehr. Wir sind nicht allein, wir haben Sklaven. Dazu sieben Sturhörner.«
»Was redest du da? Du bist ja selber als Sklave gekennzeichnet.« Der Mann fasste sich ans Ohrläppchen und verfiel sodann ins Schweigen. Auch aus den Reihen der anderen war lediglich hier und da ein Räuspern zu vernehmen. Es war, als seien all diese Menschen mit dem Erscheinen fremder Leute überfordert.
»Mein Zeichen besagt nichts. Wir kommen aus Argad, uns schickt der Meya«, versuchte Anschar zu erklären, doch auch das rief bestenfalls Achselzucken hervor.
»Sie sieht merkwürdig aus.« Unter der Achsel eines kräftigen Mannes lugte eine alte Frau hervor. »Und sie ist verletzt.«
Grazia sah an sich hinunter. In der Tat, oberhalb des Knies war das Kleid feucht und klebrig. Hastig kehrte sie den Männern den Rücken zu und hob den Stoff. Bis hinunter zum Fuß hatte das Blut rote Striche auf ihr Bein gemalt. Winzige Steine bedeckten die Wunde. Sie versuchte den Dreck fortzuwischen. Wie war das passiert? Der wacklige Abstieg dicht an der Felswand ... Während sie das Malheur betrachtete, erinnerte sich ihr Magen an die gefährliche Schaukelei. Oder war es das so eilig getrunkene Wasser, das ihn umstülpte? Grazia krümmte sich, doch bevor sie es wieder von sich geben konnte, flirrte es vor ihren Augen, und sie sackte auf den Hintern. »Mir ist schlecht«, flüsterte sie.
»Sie ist auch gezeichnet!«, schrillte die Frau.
Schritte scharrten, fremde Hände griffen nach Grazia.
»Zurück!« Anschar baute sich über ihr auf und zog sie auf die Füße. Sie hielt sich an seinem Arm fest, wollte sich umwenden, da erblickte sie über seine Schulter hinweg Bogenschützen. Vier Männer standen auf einer Art Brücke, die von Felswand zu Felswand reichte. Hoch war sie nicht, man konnte unter dem Bogen so eben hindurchgehen. Auf ihr, die gesamte Breite einnehmend, erhob sich ein zeltartiger Aufbau. Er wirkte, als hätten sich riesige Fledermäuse niedergelassen, nebeneinander, übereinander, und ihre Schwingen ausgebreitet.
Die Männer spannten die Bogen.
»Anschar«, wisperte Grazia. »Da oben – sieh doch.«
Er raunte einen Fluch. Nie zuvor hatte sie in dieser Welt Männer mit Kampfbogen gesehen; das argadische Wort kannte sie nicht. Sie konnte nur starren, die Linien ihrer angespannten Schultern und Arme bewundern. Doch der Gedanke, die Pfeile könnten sich in ihren und Anschars Körper bohren, ließ sie sich erneut krümmen.
»Ergib dich, Sklave«, hörte sie den Mann sagen. »Und gib dein Schwert her.«
Anschar stand der Wunsch ins Gesicht geschrieben, dem Mann die Zähne in die Kehle zu schlagen oder ihn wenigstens anzuspucken. Doch er schüttelte nur mit einem galligen Auflachen den Kopf, während er mit der freien Hand den Schwertgürtel löste. »Manche Dinge ändern sich einfach nicht.«
Sie gab den Kampf gegen ihren rebellischen Magen auf. Schlaff hing sie in Anschars Arm, irgendetwas über seine Schulter spuckend. Er schimpfte und fluchte, und sie fragte sich, ob es ihr galt. Aber sie konnte ihrer Schwäche nichts entgegensetzen und ergab sich der Dunkelheit. Dumpfe Geräusche – Schreie, Schläge – drangen an ihr Ohr, dann war es lange Zeit still. Erst das Plätschern von Wasser brachte sie ins Leben zurück. Sie lag, halb an die Felswand gelehnt, auf dem Boden. Eine Hand ruhte unter ihre Wange und hob leicht ihren Kopf. Warme Tropfen rannen zwischen ihre Lippen. Sie sperrte den Mund auf, und da verstärkte sich der Strom.
»Ja, so ist es gut.« Anschars Stimme vertrieb den Nebel. Grazia fuhr auf. Ein Netz dicken Felsengrasgeflechts trennte sie von den Männern, die einige Meter entfernt standen und stierten, sich mit den Ellbogen anstießen und grinsten.
»Was ist das?«
»Ein Käfig.«
Anschar hatte einen Wasserbalg sinken lassen. Nun nahm er ein Stück Tuch von seinem Schoß und presste es auf seine Nase. Längliche Blutstropfen prangten auf seinem ausgeblichenen Hemd. »Du hast dich gewehrt, trotz der ... der ...«
»Bogenschützen?« Unter dem geknüllten Fetzen klang seine Stimme gedämpft. »Nur ein bisschen. Hätte ich auf deine Anwesenheit keine Rücksicht nehmen müssen, wäre ich jetzt entkommen oder tot. Nun, tot vermutlich. Eigentlich sollte ich dir ein klein wenig von dem Schlag zurückgeben, auf deinen Hintern, weil du mich gezwungen hast, dich mitzunehmen. Mit einem Blick hast du mich gezwungen!« Er stöhnte auf, Blut quoll aus seiner Nase, die gottlob nicht gebrochen aussah. »Nein, eben deshalb habe ich den Hieb wahrhaftig verdient.«
»O Himmel«, murmelte sie. »Bitte tu so etwas nicht noch einmal.«
»Ich furchte, das wäre ein leichtfertiges Versprechen.« Zu ihrer Überraschung lächelte er. »Wir sind gefangen. Es ist wie damals, in jener Höhle, als wir uns kennenlernten. Diese Erinnerung macht es ein wenig erträglicher.«
Erneut besah er sich das Tuch. Die Blutung war gestockt. Er übergoss es und säuberte notdürftig sein Gesicht. Woher hatte er das armselige Stück Stoff? Vom Saum seines Mantels gerissen. Er hob ihr Kleid an. Sie wollte seine Hände abwehren. Hier, gefangen wie Einhornziegen, umgeben von glotzenden Männern, die ihr wie Steinzeitmenschen vorkamen, kam es ihr undenkbar vor, sich fast bis zu den Hüften zu entblößen.
»Sie sehen ja nichts«, beschwichtigte er sie und rückte näher heran, um sie mit seinem Körper abzuschirmen und das Wasser über ihre Schürfwunde fließen zu lassen. Eilends riss er einen weiteren Streifen von seinem Mantel und wickelte ihn um ihr Bein.
Die Blicke der Dorfbewohner klebten an ihr. Grazia sprang auf, schüttelte das Kleid herunter. Sie warf sich gegen das Geflecht.
»Wir sind keine Sklaven!«, schrie sie, daran rüttelnd. »Was fällt euch ein, uns zu schlagen? Wir sind Gesandte des Meya, in wichtiger Mission unterwegs. Ihr müsst uns doch wenigstens anhören!«
Die Männer grinsten, eher verwirrt. Wie Schafe!, dachte sie zornig. An den Schultern zog Anschar sie zurück.
»Hör auf, Feuerköpfchen«, sagte er sanft.
»Das verlangst ausgerechnet du?« Ihre Füße stampften den schlammigen Boden. »Hast du nicht eben selbst um dich geschlagen?«
Er drehte sie um. »Eine Prügelei steht mir ja auch besser als dir. Hier in diesem Käfig wüsste ich allerdings nicht mehr, was es uns noch nützen könnte. Wir müssen warten.«
»Worauf denn?« Sie krallte die Finger in ihr Haar und schluchzte würgend auf, denn die Angst schnürte ihr die Kehle zu. Als es ihr gelang, Luft zu holen, schluchzte sie haltlos das Entsetzen der letzten Tage hinaus.
»Schsch, Grazia ...«
Sie erschrak vor sich selbst, so tierisch klangen die Laute, die sie ausstieß. Hinter sich hörte sie vereinzeltes Gelächter. Sie keifte, stieß argadische Schimpfwörter aus, die sie unmöglich gelernt haben konnte, und schrie und heulte.
»Achte nicht auf sie.« Fest umschlang Anschar sie, begann sie zu wiegen und kräftig ihren Rücken zu reiben. »Wie ging noch dieses Lied?« In ihr Lärmen mischte sich sein Summen. Sie ahnte, dass sie sich darauf konzentrieren musste, um nicht den Verstand zu verlieren. Verzweifelt lauschte sie der Melodie, suchte nach den Worten.
»Ja, weiter, weiter«, flüsterte Anschar in ihr Ohr.
»... als – als hier das unsre weit und breit ...« Ihr Geschrei ging in Weinen über. »Wo wir uns finden ... wohl unter Linden ... zur – zur Abendzeit.«
»Weiter.«
»Da haben wir so manche Stund’ gesessen da in froher Rund’...« Sie flüsterte nur noch, so müde war sie plötzlich. »Dass wir uns hier in diesem Tal noch treffen so viel ...«
Ihre Stimme erstarb. Er zog sie mit sich und kauerte an der Felswand nieder. Ihr blieb gar nichts anderes übrig, als sich an seiner Seite hinzuhocken. Dankbar für seine Gegenwart, legte sie den Kopf auf seine Schulter. Sie fühlte sich wie all die schlaffen Wasserbeutel, die sie bei ihren Begleitern zurückgelassen hatten.
»Deine Haut schält sich«, er zupfte in ihrem Gesicht herum und ergriff eine ihrer Hände, um sie prüfend herumzudrehen. »Weißt du, Feuerköpfchen, ich glaube nicht, dass die Götter uns schon so sehr hassen, dass sie uns hier scheitern lassen.«
»Sie sind doch gar nicht da. Das hast du jedenfalls immer gesagt.«
»Ich habe auch immer gesagt, dass sie auf uns herabschauen. Wir sind so vielem entronnen, da mag es ja sein, dass sie öfter eingreifen, als wir bisher geglaubt haben.« Er betastete das verkrustende Blut an seiner Nase. »Vielleicht mögen sie ja dein und mein Blut.«
Ihr schauderte es. »Das hört sich beinahe an, als hättest du dich schlagen lassen, damit dein Blut als Opfer fließt.«
»Ah, nein. Das natürlich nicht. Aber es könnte ja sein, dass sie uns dadurch leichter entdecken und vielleicht helfen. Deine Hand war nass, hast du es gemerkt?«
»Nass?« Sie hielt ihre Hände vors Gesicht, leckte daran. Was sie schmeckte, war nur salziger Schweiß. »Nein, gar nicht.«
»Dann hab ich mich getäuscht«, brummte Anschar. »Mir kam sie eben richtig nass vor.«