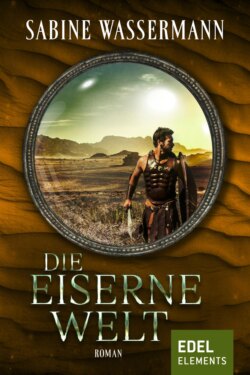Читать книгу Die eiserne Welt - Sabine Wassermann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеIhre Hände waren frei. Ein Mann machte sich an ihrem Fuß zu schaffen. Sie wollte schreien. Doch er tat ihr nichts, er verknotete nur mit peinlicher Sorgfalt jede einzelne Faser des Grasseils, das um ihr Fußgelenk lag. Grazia setzte sich auf. Sie war an die gefangene Frau gefesselt, diese an den Mann, und dessen Seil lag um einen aus der Felswand ragenden Block. Mit einem faszinierten Blick auf sie verließ der Herschede den Schatten des Felsens und kehrte zurück, einen Ziegenbalg unter dem Arm und einen ledernen Becher in der Hand. Jeden ließ er reichlich trinken. Auch Grazia trank, wenngleich das Wasser ockerfarben und viel zu warm war. Dann gesellte er sich zu den anderen unter die ausladende Plane, wo sie dösten oder zum Spiel beinerne Kügelchen warfen.
Grazias Magen war nicht mehr wie mit Steinen gefüllt. Auch ihr Rücken tat nicht mehr so weh, offenbar hatte ihr das Liegen hier auf dieser brüchigen Matte gut getan. Sie befingerte das blutende, dick geschwollene Ohrläppchen. Der Bronzehaken fühlte sich an, als habe sich ein Krebs an ihr festgezwickt. Sie sank auf die Seite und schloss die Augen, in der Hoffnung, es möge sich doch als Traum entpuppen, dass sie eine Gefangene, eine Sklavin war. Aber ihre von Angst verseuchten Gedanken kreisten, und sie konnte nicht aufhören, das wunde Ohr zu betasten. Was würde jetzt mit ihr geschehen? Zurück in Argad, würde man sie zu Fergo bringen, dem größten Sklavenhändler der Hochebene. Sicher würde der Meya von ihrem Schicksal erfahren und ihr helfen. Aber was hatte sie davon, wenn Anschar und die anderen starben, weil sie nicht mehr da war?
Glühender Stahl bohrte sich in ihren Brustkorb und umschloss ihr Herz. Verzweifelt sehnte sie Anschars Hand herbei, wie sie sich auf ihren Mund legte, damit sie keinen Laut von sich gab. Wie seine Augen, zwei dunkelbraune Edelsteine, über ihr schwebten und sagten: Ich befreie dich. Sie rollte sich zusammen, barg das Gesicht in der Armbeuge und ließ die Tränen laufen.
Ein Mann kam ins Lager. Er war noch jung, sein Ziegenbart kaum mehr als ein spitzer Flaum. Bis über beide Ohren strahlte er, als er federnd auf die Herscheden zuschritt. Vom Gürtel nestelte er ein Bündel, das sich, als er es hochhob, als vier tote Schlangen herausstellte. Stolz schüttelte er sie und ließ sie vorschnellen. Die Schlangen zuckten vor den lachenden Gesichtern der Männer.
»Endlich gutes Fleisch!«, rief einer, und Grazia wusste nicht, ob er das ernst meinte. Schlangen hatte sie oft gegessen, aber nur mit Widerwillen. »Als Schlangenfänger bist du wenigstens zu gebrauchen.«
Als der Jäger Grazia erblickte und ins Staunen geriet, vergaß er sein Spiel. Die Männer begannen die Viecher zu häuten, ließen sich über die Kargheit der Gegend aus und dass man tollkühn gewesen sei, auf der Suche nach Sklaven in den leblosesten Teil der Wüste vorgedrungen zu sein. Grazia spitzte das geschundene Ohr, in der Hoffnung, etwas herauszuhören, das ihren Standort verriet. Vielleicht war jener durchlöcherte Felsen ganz in der Nähe, vielleicht sogar gleich hinter diesem Hohlweg? Aber kein Wort fiel darüber, und schließlich wurde ihr klar, dass das nicht sein konnte, denn sonst wären Anschar und die anderen längst hier. Auch der Schlangenjäger, der sich in die Brust warf, während er von seinem Fang erzählte, schien diesen Felsen nicht gesehen zu haben. Ein Dreibein wurde aufgestellt, darauf ein Topf. Jemand schob bröselige Dungfladen darunter und entzündete ein Feuer. Wasser ergoss sich aus einem Beutel in den Topf, Felsengraswurzeln kamen hinzu, dann die in Stücke gehackten Schlangen.
»Schlangenfraß«, sagte Bedyadrur verächtlich, als er aus seinem Zelt kam und sich den Bauch kratzte. Seine Stirn warf sich in unzählige Falten, als er zur Sonne hochblickte, dann zum Horizont und zuletzt zu den Gefangenen. »Wir haben jetzt drei Sklaven, das ist keine schlechte Ausbeute. Und die Rothaarige ist nicht gerade robust, die können wir nicht am Rande des toten Landes herumschleppen. Also, Männer, machen wir uns auf, zurück in wirtlichere Gegenden, bevor wir hier vom Fleisch fallen. Der letzte von Fergos Außenposten dürfte eine Woche entfernt sein. Die Wasservorräte reichen sowieso nicht viel länger.«
Die Männer freute es. Mit einem Napf voller Schlangensuppe kehrte Bedyadrur in sein Zelt zurück, und sie überlegten, wie viel Erlös die Sklaven wohl brachten und was man in Fergos Dorf mit dem Geld wohl anstellen könnte. Fressen, Saufen, Huren. Grazia fand es erstaunlich, mit welcher Inbrunst und Ausdauer diese drei Themen erörtert werden konnten. Ihr graute es, in einem solchen von Sklavenfängern bevölkerten Dorf zu landen. Sie stellte es sich wie einen Sündenpfuhl im Wilden Westen vor, wo man sie zwingen würde, auf einem Tisch zu tanzen, während schaurige Musik gespielt wurde und Betrunkene sich schlugen.
Der junge Herschede verteilte drei Näpfe auf seinem Arm und trug sie heran. Die beiden Wüstenmenschen machten sich sofort über das Essen her, nur Grazia stellte ihren Napf neben sich auf die Matte.
»Du musst doch Hunger haben«, sagte der Schlangenjäger. »Nun iss schon.«
Grazia presste die Lippen zusammen. Sie würde essen, aber erst, wenn der Hunger den Ekel überwog.
»Das ist eine Schlangensorte, die wirklich schmeckt. Ich kenn mich da aus. Na, komm.« Er streckte die Hand nach ihr aus. Zurückweichen konnte sie nicht, denn ihr Rücken war schon am Fels. Vorsichtig, als berühre er eine Kostbarkeit, glitten seine Fingerspitzen über ihr Haar. Er hob es an die Nase. Erwartete er wirklich, dass es duftete? Zögernd kehrte er zu den anderen zurück. Als sie den Napf auf die Knie hob und ein Stück herausfischte, das sie mit spitzen Zähnen kostete, lächelte er.
Nein, wohlschmeckend war es nicht, aber der erste Bissen fachte den Hunger an, und so aß sie die Brocken und trank die Brühe.
Die beiden Gefangenen aßen mit abgehackten Bewegungen, als hätten sie den Willen längst verloren; allein die Körper taten, was getan werden musste. Ihre Blicke waren ins Leere gerichtet. Verstohlen wischte sich der Mann eine Träne aus den faltigen Augenwinkeln. Von ihm war keine Hilfe zu erwarten.
Als sich der Schatten des Felsens zurückzog, brachte jemand eine Decke. Sie kauerten sich in ihrem Schutz zusammen, und die Hitze begann alles zu lähmen. Die Gespräche verebbten. Grazia hörte nur noch, dass man den Tag verschlafen und in der erträglicheren Dämmerung aufbrechen wollte. Auch die beiden Sklaven rollten sich zusammen. Allerorten begann man zu schnaufen und zu schnarchen.
Sie versuchte ebenfalls zu schlafen, denn in der Nacht würde dazu vielleicht keine Gelegenheit sein. Doch ohne es zu wollen, gab sie sich Tagträumen hin. Darin sah sie Anschar, wie er auf einem Pferd durch die Straßen Argadyes ritt. Vor dem Palast wartete der Meya, umgeben von seinen vielen Frauen. Grazia bewunderte ihn, denn er war, wie ein König sein sollte, herrisch und stark. Sildyu war an seiner Seite, die Königin und Hohe Priesterin, wie stets in weiße, wallende Gewänder gekleidet. Fidya, das gelb geschmückte Vögelchen, das einen Säugling auf dem Arm hielt. Sogar Schelgiur, der Wirt aus der schwebenden Stadt, war dort, obwohl er tot sein musste. Er reichte Anschar, der vom Pferd gesprungen war, einen Becher kühlen Bieres, das dieser hinunterstürzte. Dann trat Anschar vor seinen Großkönig und gab ihm – was? Ein Schriftstück? Oder einen Gegenstand, der ohne Worte ausdrückte, dass der Frieden mit Temenon geschlossen war? Manchmal stellte sich Grazia vor, dass er einen Mann von dort mitbrachte, und dieser ähnelte Henon, seinem alten Sklaven, den er so geliebt hatte. Derselbe dünne, leicht gebeugte Körper, die wenigen grauen Haarsträhnen kaum in der Sonne zu sehen. Anschars Arm lag um seine schmalen Schultern, und er weinte, wie es nur Henon gekonnt hatte. Dann sah sie andere Menschen, und ihr Herz wollte zerspringen. Anschar ging auf ihren Vater zu. Beide Männer, von denen Grazia wusste, dass sie einander sehen wollten, musterten sich lange. Justus, ihr kleiner Bruder, stand dort, und sein Blick, der dem großen Krieger galt, war vor allem eines: bewundernd. Nur dem Gesicht der Mutter vermochte Grazia keine Gefühlsregung einzuhauchen, so sehr sie es auch versuchte. Der Vater tat, was er immer tat, wenn er nachdenklich war: Er nahm aus der Rocktasche eine Zigarre, befingerte sie endlos, hielt sie an die Nase und biss die Spitze ab. In diesem Fall war er wohl eher nervös. Da stand der Richtige vor ihm, und der war ein langhaariger Wilder mit nackten Beinen und bemalten Armen, wie die Mutter Anschar genannt hatte. Aus der Westentasche holte Carl Philipp Zimmermann sein Streichholzetui, aber er konnte kein Streichholz anzünden, zu sehr zitterten seine Hände. Schließlich nahm Anschar es an sich, und die Flamme loderte auf. Was eine Zigarre war, wusste er nicht, denn Grazia hatte bisher nie davon erzählt. Der Vater hielt Anschars Hand umfasst und neigte den Kopf vor. Die Zigarre brannte. Er lächelte.
Aber Grazia träumte nicht nur, sie erinnerte sich auch. »Der Tag wird kommen, da du mich hassen wirst, weil ich dich in die Wüste geschickt habe«, hatte Madyur-Meya ihr zum Abschied gesagt und dabei fast beschämt gewirkt. Aber dann hatte er wieder wie gewohnt die Stimme dröhnen lassen, während er die Reihe der Wüstenmänner abgeschritten war, jeden einzelnen gemustert und ihnen im Falle des Erfolges die Freiheit versprochen hatte. Was scherte ihn das entsetzte Raunen der Höflinge angesichts dieser Ungeheuerlichkeit? Aber der ganze Mann war ungeheuerlich. Er hatte einen Sklaven zu den Zehn, seiner Leibwache, hinzugefügt, und wenn er eine Frau in den Tod schicken musste – was scherte es ihn? Aber er mochte sie. Er hatte über ihr rotes Haar gestreichelt und ihr in die Wange gekniffen. Heute war wohl der Tag gekommen, da sie den Meya hassen musste. Was würde sie tun, sollte sie je wieder vor ihm stehen? Ihm aus lauter Verzweiflung ins Gesicht schlagen? Oder würde sie in sich zusammensinken, weil sie ihm sagen musste, dass Anschar gescheitert und sie die einzige Überlebende war?
Sie riss sich die Decke vom Kopf und blinzelte in die Helligkeit. Nein, sie würde es nicht hinnehmen, verschleppt zu werden. Anschar musste leben. Nicht er musste sie retten; das konnte er gar nicht, denn er wusste nicht, wo sie war. Nein, sie musste ihn retten, ihn und die anderen. Aber was vermochte sie denn zu tun? Ihre Gabe war hier nutzlos.
War das so?
Nur wenige Schritte entfernt lag der junge Schlangenjäger auf dem Bauch und schnarchte mit den anderen um die Wette. Grazia schälte sich aus der Decke und kroch auf ihn zu, bis sie den Zug des Seiles spürte. Sie musste sich auf dem Boden ausstrecken, um den Mann zu erreichen. Ihr pochender Herzschlag würde ihn wecken, dessen war sie sich sicher. Ihre Fingerspitzen berührten den speckigen Ledergriff seines Dolches. So verharrte sie endlose Minuten. Was, wenn der Mann erwachte? Ein anderer? Sie war versucht, zurückzukriechen. Aber dann ballte sie die Faust, um ihre zitternden Finger zu beruhigen, und zog langsam den Dolch aus der Scheide.
Das Gewicht in ihrer Hand beruhigte sie nicht. Sie setzte sich auf. Niemand war erwacht. Nur nicht nachdenken, ermahnte sie sich. Denn tat sie es, würde sie vor Angst nicht mehr vor und zurück wissen. Hastig säbelte sie das Seil durch und wankte auf die Füße. Der Sand verschluckte ihre Schritte; aber dort, wo nur eine dünne Schicht auf felsigem Grund lag, knirschte er. Langsam setzte sie einen Fuß vor den nächsten, und dann stand sie vor dem Wasservorrat, einem Berg gestapelter Beutel. Ihr war danach, zurück an ihren Platz zu flüchten. Nein!
Entschlossen stieß sie den Dolch in einen der Beutel.
Ein Strahl ergoss sich auf ihre Füße. Der Beutel gluckerte. Erschrocken fingerte sie daran herum, um die Geräusche einzudämmen. Da war er auch schon leer. Sie lauschte dem Schnarchen. Niemand war erwacht. Sie ging in die Hocke und schnitt einen der zuunterst liegenden Beutel auf. Laudos versickerte das Wasser im Sand. Alles musste fort, alles; dann wäre sie die Herrin über den Durst dieser Männer und konnte sie zwingen, sie freizulassen.
Ruckartig setzte sich ein Herschede auf. Grazia machte sich so klein wie möglich. Er rappelte sich auf die Füße, schlurfte ein paar Schritte in die Wildnis hinein und schlug sein Wasser ab. Schlaftrunken kehrte er zurück, ohne nach rechts oder links zu schauen. Nur wenige Augenblicke später lag er still.
Nun arbeitete Grazia eilig, ohne weiter auf die Männer zu achten. Ihr war, als sei es eine andere Person, die den Dolch ansetzte, in die Beutel stieß und möglichst leise Schnitte tat. Sie selbst stand daneben und kämpfte gegen Schwindel, Ohrensausen, tanzende Punkte vor ihren Augen an. Was war das? Angst vermutlich, nackte Angst. Nach einem weiteren Schnitt stieg ihr Biergeruch in die Nase, und ihre Hände wurden klebrig. Endlich, ihrem Gefühl nach war eine halbe Ewigkeit vergangen, war der Berg zu einem Lederlumpenbündel geschrumpft. Sie schlich zu einem weiteren Vorratslager; als sie auch dieses abgearbeitet hatte, sah sie ein Rinnsal auf einen der Männer zukriechen. Es verschwand unter seinem Rücken, doch er wachte nicht auf. Ein anderer wälzte sich herum, rieb sich die Augen und schlief weiter.
War es genug? Unter der Plane, bei den Männern, lagen ebenfalls halbvolle Beutel, dorthin würde sie sich gewiss nicht wagen. Was mochte im Zelt sein? Sie wünschte sich, vorhin besser aufgepasst zu haben. Dort nachzusehen, erschien ihr als das Höchste dessen, zu dem sich ihr Mut aufschwingen konnte, doch sie tat es. Der Anführer lag auf seiner Pritsche, mit dem Rücken zu ihr. Himmel, was tat sie hier? Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Diese Unordnung! Überall lagen Kleidungsstücke herum, Fetzen vielmehr; hingeworfene Essensreste, ein paar tönerne Flaschen. Sie rüttelte daran. Nichts war darin. Als sie darüber hinwegsteigen wollte, blieb sie mit der Sandale daran hängen. Das Behältnis kullerte mit sattem Klacken gegen das nächste.
Bedyadrur grunzte. Seine Hand langte auf die Schulter, und er kratzte sich. Grazia wünschte sich weit fort. Endlich entdeckte sie inmitten des Durcheinanders ein paar Beutel. Sie stakste zu ihnen und bückte sich. Als sie den Dolch ansetzte, warf sich Bedyadrur herum und schlug die Augen auf.
Anschar hatte das schmalste und wendigste Sturhorn gewählt, um seiner Ungeduld keine überflüssigen Zügel anlegen zu müssen. Nicht einmal an seinen Mantel hatte er gedacht, und so brannte die Sonne auf seine bloßen Arme und trieb ihm den Schweiß aus allen Poren. Mit dem Wasser musste er sparsam sein, aber er war ohnehin zu sehr auf seine Suche konzentriert, um ans Trinken zu denken. Wenn er Grazia fand, bekam er genug. Wenn er sie fand! Seine Sorge um sie jagte das Sturhorn vorwärts, zugleich ließ er den Blick abseits des Weges schweifen. Der Gedanke, unwissentlich an ihr vorbeizureiten, zerrte an seinen Nerven. Den anderen Gedanken, sie könne tief unter dem Sand vergraben und längst tot sein, verbot er sich.
Auch die Wüstenmänner waren unterwegs, doch in andere Richtungen. Zwei hatten sich auf Sturhörner geschwungen, die anderen suchten die Umgebung des Felsens ab. Jeder wusste nur zu gut, was es bedeutete, wenn sie ohne Grazia waren. Er schalt sich, ihr gestattet zu haben, so dicht am Ausgang der Höhle zu nächtigen. Aber wer hätte ahnen können, dass die Außenwand einem Sturm nicht standhielt? Zumindest diesem hatte sie nicht standhalten können, und er fragte sich, ob irgendein zorniger Gott den Sturm geschickt hatte. Waren sie unwissentlich auf verbotenem Gebiet gewesen? Hätten sie mehr opfern müssen? Aber sie besaßen ja nichts Gescheites. Die Wüstenmenschen verbrannten Samenkörner oder gruben für ihren Herrn des Windes ledrige Pflanzen aus, was Anschar entsetzlich erbärmlich fand. Sein letztes Tieropfer lag einige Zeit zurück, denn ein knurrender Magen ließ die Pflicht schnell vergessen. Und Grazias unverständlicher Gott? Der wollte nicht nur kein Blut, sondern nicht einmal dulden, dass fremde Götter sich daran erfreuten. Was man auch tat oder unterließ, irgendeinem Gott trat man auf die Füße.
Immer wieder stellte er sich in die Fußschlaufen, doch er sah nichts als hügeliges Gelände. Linker Hand schoben sich Sicheldünen über einen kniehohen Wald stachliger Gewächse, sonst fand sich hier nur mit Geröll übersäter Boden, der so fest war, dass man glauben konnte, er sei aus Stein. Sorgsam den fingerlangen Dornen ausweichend, lenkte Anschar das Sturhorn eine der Dünen hinauf. Ihr geriffelter Kamm war fest und trug das Tier. Er ritt durch eine tote Welt, wie ihm schien. Eine sanfte Brise ließ Körnchen über messerscharfe Grate wehen, sonst regte sich hier nichts, nur noch der flimmernde Horizont.
Das Sturhorn kam zum Stehen und verlangte mit tiefem Brummen Wasser. Anschar sprang ab und löste den Wasserbeutel vom Sattel. Die armlange Zunge suchte gierig die Öffnung. Während er es tränkte, sah er Parrad herantaumeln. Der Wüstenmann kämpfte sich breitbeinig durch den Sand, stützte sich vor ihm auf die Knie und atmete rasselnd.
»Dort ... dort ist ein Hohlweg, da ...«, er wedelte erschöpft mit einem Arm. Es fehlte nicht viel, und er würde zusammenbrechen. »Spuren!«
Anschar wandte sich in die angegebene Richtung. Ein Sandmeer, nichts Auffälliges. Doch dann meinte er eine dünne, dunkle Linie zu erkennen. »Da vorne, meinst du das?«
Parrad nickte heftig, konnte aber nur noch krächzen. Anschar hob den Beutel und ließ einen Guss auf seinen Kopf nieder. Japsend verrieb der Wüstenmann das Nass in seinem Gesicht. »Von einem Sturhorn und ... kleinen ... Füßen.«
Zwei Herzschläge später war Anschar im Sattel.
»Warte!«, krächzte Parrad. »Ich hole die anderen.«
Unwillig nickte Anschar. Kaum hatte der Wüstenmann kehrtgemacht und war ein paar wacklige Schritte gelaufen, trieb er das Tier den Dünenhang hinauf. Parrads Rufe missachtend, hielt er auf den Hohlweg zu. Hier wichen die Dünen felsigem Grund. Vielleicht hatte das Meer einst den Weg herausgeschnitten. Das Tier bockte, und er zwang es mit der Peitsche, den steilen Abhang zu nehmen. Geröll polterte unter den Tritten hinweg, dann war es unten. Widerstrebend schüttelte es das zottelige Haupt. Im knöcheltiefen Sand, der den Boden bedeckte, fand Anschar die Spuren, die großen eines Sturhorns und kleinere dazwischen. In der Tat war es kein Mann gewesen, der einem Sturhorn hinterhergelaufen war. Diesen Abdruck kannte er. Sie lebte. Wenn ihn die Götter nicht narrten, lebte sie.
Er hörte Stimmen hinter sich, die seiner Begleiter, die auf Parrad warteten. Aber waren nicht auch voraus Stimmen? Er spitzte die Ohren, denn die Laute waren schwach; es mochte der Sand sein, der manchmal seltsame Geräusche von sich gab. Aber dann hörte er Geschrei. Fremde Wüstenmänner? Da Grazia hinter diesem Sturhorn hatte herlaufen müssen, befürchtete er anderes.
Keine Zeit, das Rollsiegel zu holen. Keine Zeit, auf Parrad und die anderen zu warten; sie waren ohnedies keine große Hilfe. Nicht hierbei. Heftig zerrte Anschar an den Zügeln, so dass das Reittier sich aufbäumte. Wie viele Männer warteten dort auf ihn? Sklavenjäger waren nie in kleinen Gruppen unterwegs, mit zehn musste er rechnen, eher mit zwanzig, deren Skrupel längst im Wüstensand versickert waren. Und sie mittendrin.
»Sie ist verrückt! Die Hitze hat sie verrückt gemacht«, schrie Bedyadrur. Er stand hinter ihr, hielt sie an den Schultern und schüttelte sie. Die Männer starrten sie an, mit vor Fassungslosigkeit entgleisten Gesichtern. Andere stapften planlos umher und kehrten das Unterste zuoberst, als glaubten sie, unbekannte Quellen täten sich auf. Grazia schaffte es nicht, sich in diesem Tumult bemerkbar zu machen. Niemand achtete auf ihre gestammelten Worte, und Bedyadrur schüttelte sie so heftig, dass ihr Hören und Sehen verging. Plötzlich drehte er sie zu sich herum und schlug ihr links und rechts ins Gesicht. Sie bekam keine Zeit, aufzuschreien; sie wurde in die Arme eines anderen Mannes gestoßen, der sie herumriss.
»Warum hast du das getan?«, brüllte er, dass sein Speichel ihr ins Gesicht flog. Seine Zähne waren gefletscht; gleich würde er sie in ihre Haut schlagen und aufreißen.
»Ich will ...«
»Warum? Warum? Inar soll dich dreimal verfluchen, du rothaarige Wahnsinnige!«
»Ich will es ja erklären!«
Aber sie schrien so laut und wild durcheinander, dass ihr armseliges Stimmchen verhallte. Wieder wurde sie herumgewirbelt, geschlagen, geschüttelt. Sie musste ihre Kunst zeigen, schnellstens, doch sie war viel zu benommen, um mehr als Rinnsale aus ihren Händen laufen zu lassen. Die jedoch hielt jemand hinter ihrem Rücken zusammen, und so sickerte das Wasser unbemerkt an ihren Beinen hinab. Die Männer griffen in ihr Haar, zerrten daran. Als Grazia ihr Unterkleid reißen hörte, begriff sie, dass sie eine Gewalt entfesselt hatte, die ihr völlig unbekannt war.
Nackt wurde sie umhergeworfen und unter die Plane gezerrt. Wölfe waren das, keine Menschen, die an ihr zerrten und sie zu Boden schlugen. Das Geschrei veränderte sich, wurde eine Spur leiser. Die Stimmen tiefer, gierig. Die Zeit für Worte war vorbei. Grazia konnte ohnehin nichts mehr sagen, denn ihre Kehle war durch einen lang anhaltenden Schrei verstopft, den niemand hörte, nicht einmal sie. Überall wurde sie gekniffen; jemand bekundete, niemals eine so schmale Taille gesehen zu haben. Finger bohrten sich in ihre Fußgelenke und zerrten ihre Beine auseinander. Ein Mann warf sich auf sie. Sein Gewicht presste die Luft aus ihren Lungen. Sie sah die Schweißtropfen auf seinem haarlosen Schädel; sie troffen an seiner Nase herunter, an den Kupferperlen in seinem Bart. Seine Lippen waren rissig und dick. Schaum saß in den Mundwinkeln. Er leckte ihn ab. Grazia drehte den Kopf weg. Ganz in der Nähe lugte der junge Schlangenjäger zwischen den erhitzten Leibern hervor. Er wirkte erschrocken.
Der Glatzköpfige nestelte an sich herum. Er grinste sie an. Sie sammelte Speichel, um ihn anzuspucken. Und als sie es tat, kam die Gabe in einem harten Strahl aus ihr heraus. Wie von einer Nadel gestochen, wich er zurück und wischte sich durch das nasse Gesicht. Nun, da plötzliche Stille herrschte, hörte sie ihr Herz schlagen; wild pumpte es das Blut in ihre Ohren. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt und die Hände zu Fäusten geballt, aus denen das Wasser floss. Aus ihren Mundwinkeln sprudelte es, aus den Augenwinkeln, dem Unterleib. Wie eine Gebärende drückte sie es aus dem Körper.
Was der Mann zwischen den Beinen hatte, wirkte weich und nicht länger bedrohlich. Beinahe hätte sie lachen können, wie er glotzte, aus runden Augen über einem ebenso gerundeten Mund, wie ein Fisch. Alle glotzten so. Es war ihr unbegreiflich, in dieser Lage, so entblößt, einen aufbrandenden Stolz auf ihre Gabe zu spüren, wie sie ihn zuvor nie empfunden hatte. Im Tempel von Argadye waren die Leute ehrfürchtig vor ihr und ihrem Wasser zurückgewichen, hatten sie eine Halbgöttin, eine Nihaye gerufen, die vielleicht imstande sei, mit dieser Gabe das Land vor der Trockenheit zu retten. Wie hatten sie sich gefürchtet – sollten diese Kerle es jetzt doch auch! Weit sperrte sie den Mund auf und stieß das Wasser hinaus, dass es wie eine Fontäne über ihr sprudelte.
Der mit dem Fischmaul sagte endlich: »Die ist nicht menschlich. Die bringt Unheil über uns.«
Einige wandten die Köpfe in Richtung des Anführers. Bedyadrurs bleicher Kopf bewegte sich zu einem abgehackten Nicken.
»Werft sie in die Erdspalte.«
Einige näherten sich und streckten zögerlich die Hände nach ihr aus. Erst als Bedyadrur lautstark befahl, sie sollten zupacken, fühlten sich Grazias Glieder wie von Schraubzwingen umklammert. Mit einem Mal stand sie wieder auf den Füßen, rings um sie die Herscheden. Feindselig wirkten sie nicht, erst recht nicht lüstern. Eher so, als hätten sie eine vor sich, die schon tot war. Zwei Männer zerrten sie mit sich, den Hohlweg entlang, fort vom Lager. Noch immer floss das Wasser aus ihr heraus, aber es begann mit ihrer wachsenden Angst zu versiegen. Wo war das Gefühl der Macht, das sie eben noch berauscht hatte? Willenlos stolperte sie dahin. Einer drehte ihr den Arm auf den Rücken und schob sie vor sich her. Es war nur ein kurzes Stück vom Lager fort; hier endete der Hohlweg abrupt. Sie drückte die Füße in den Sand, konnte aber nicht verhindern, zu einem breiten Riss gedrängt zu werden, der sich im Fels auftat. Schon schwebten ihre Zehen in der Luft. Unter sich sah sie nur Schwärze. Sand spritzte von ihren Füßen auf und verschwand im Nichts.
Sie warf sich herum und stieß einen Schrei aus, der ihr in den Ohren gellte. So schrie nur ein Mensch, der den Tod vor Augen hatte. Wild schlug sie um sich, suchte Halt an den Männern, riss ihnen Haare aus und zerfetzte ihre Kleidung.
»Macht schon!«, drängte Bedyadrur. Drei Männer waren bei ihr, um sie über den Rand zu schieben. Die Knie schlug sie sich an der Kante blutig, während sie ein fremdes Bein umklammerte.
»Ohne mich sterbt ihr auch!«, schrie sie. »Ich kann Wasser machen, ihr habt es doch gesehen! Warum begreift ihr das nicht?«
Ihre Schenkel rutschten über die Kante. Ihre Nägel bohrten sich in Beinmuskeln. Aus ihrer Kehle kam nur noch das unmenschliche Gellen.
Ein Schatten fiel auf sie, der die Männer zurückweichen ließ. Ein Arm schlang sich um ihre Mitte und zog sie fort von der Spalte. Einige Schritte entfernt fand sie sich auf dem Boden wieder, über sich ein vertrautes Hemd, in das sie die Finger krallte. Wild brandete ihr Herz gegen Anschars Brust.
»Erstaunlich, was man so alles in der Wüste findet«, hörte sie Bedyadrur sagen. Er klang unsicher, als überfordere ihn das alles. »Erst die Frau, aus der Wasser sprudelt, dann einer, der das Zeichen der Zehn trägt und zugleich einen Sklavenohrring. Vielleicht bilde ich mir das alles ja nur ein, weil mir nach all den Jahren die Sonne nun endlich das Hirn gesotten hat.«
»Anschar.« Sie hustete; ihre Stimme klang rau und gedämpft vom Rauschen ihres Blutes. »Ich habe versucht ... ihnen zu erklären ...«
»Steh auf, wenn du kannst.« Er klopfte ihr auf die Schulter und richtete sich seinerseits auf. Sein Hemd fiel in ihren Schoß. Nichts, außer ihm selbst, war ihr willkommener. In Windeseile schlüpfte sie hinein und zerrte es bis zu den Knien hinab. Aber das Aufstehen fiel ihr schwer, so sehr schlotterte sie am ganzen Leib. Dass Anschar bei ihr war, hatte sie noch nicht richtig begriffen. Breitbeinig stand er über ihr, seine Hand lag an ihrer Wange.
»Etwas ist in ihr«, sagte Bedyadrur. »Das ist keine Frau. Das ist ... irgendetwas. Aber wer bist du?«
»Der Gesandte des Meya, der in seinem Auftrag Temenon finden soll.«
»So etwas hat sie auch behauptet.« Ein Finger wies auf sie, dann auf Anschar. »Aber nur, weil du das sagst, wird’s ja auch nicht gleich wahr. Ein Sklave, den der Meya irgendwo hinschickt? Eher hast du dir diese Tätowierung selber verpassen lassen, um zu vertuschen, dass ...«
»Du irrst dich«, unterbrach Anschar ihn mit heiserer Ungeduld. »Ich meine, du irrst dich, wenn du denkst, ich wollte dich überzeugen. Sie wollte das. Ich nicht. Mir ist wirklich völlig gleichgültig, ob du es glaubst.«
Zischend glitt sein Schwert aus der Scheide. Grazia fühlte sich von Grausen und finsterer Freude zugleich ergriffen. Bedyadrurs Oberkörper schwang herum, als suche er bei seinen Männern die Erklärung, weshalb dieser Mann bereit war, allein gegen sie anzutreten. Er fletschte die Zähne und suchte rückwärtsgehend hinter seinen Leuten Schutz. »Mir reicht das jetzt. Tötet sie beide.«
Schwerter, Macheten, Dolche, ein wilde Mischung von Waffen wurde gezückt. Grazia wollte ihr Gesicht bedecken, aber Anschar ging neben ihr in die Hocke und hielt einen ihrer Arme fest. »Ich brauche deine Hilfe. Bist du bereit?«
»Zum ... zum Weglaufen? Ganz bestimmt!«
»Das darfst du auf keinen Fall.«
Er schnellte hoch; ein Klirren ertönte über ihr, dann ein Schrei. Ein Mann fiel vor ihr in den Sand, wälzte sich herum, die Hände auf eine blutende Wunde gepresst. Das Blut pulste aus seinem Leib und rötete den Sand unter ihm. Grazia warf sich herum und kroch von ihm fort; zum Aufstehen fehlte ihr die Kraft. Jemand packte ihren Fuß. Sie schrie, rollte auf den Rücken und trat aus, aber der Herschede ließ nicht los. In der freien Hand hielt er ein gewaltiges Messer. Er neigte sich vor – und zuckte würgend zusammen. Hinter ihm stand Anschar und riss beidhändig das Schwert aus seinem Rücken. Bevor der Mann auf sie fallen konnte, gab er ihm einen Tritt.
»Nicht weglaufen, habe ich gesagt.« Er sprach es noch aus, als er sich drehte und die Klinge schwang. Eine Hand flog durch die Luft, mitsamt dem Dolch, den sie hielt. Eine Gestalt sackte in sich zusammen, hielt den Stumpf und wälzte sich schreiend durch den Sand. Der Nächste starrte auf seine Brust, in der das Schwert steckte. Fast im gleichen Moment, als Anschar es herauszog, trieb er es in den Körper eines weiteren Angreifers. Nur wenige Schritte entfernt wütete er zwischen den Sklavenfängern, sprang einem Tänzer gleich hin und her und nutzte seine Waffe mit tödlicher Präzision. Sie hatten keine Zeit zu begreifen, dass es keinen gab, der ihm gleichkam, und so stellten sie sich ihm. Auch der junge Schlangenfänger. Von irgendwoher hatte er einen Spieß geholt, den er mit beiden Händen vorstreckte. Er schien der Erste zu sein, der begriff, welch ein Ding der Unmöglichkeit er versuchte, denn seine Beine zitterten, und seine Bewegungen waren behäbig. Anschar hatte keinerlei Mühe, mit der linken Hand den Schaft zu ergreifen. Ein kurzer Ruck, der Schlangenfänger stand mit leeren Händen da. Der junge Mann riss den Mund auf. Zu einem Schrei oder einem Flehen? Anschars Schwertklinge bohrte sich in seine Wange.
Grazia kniff die Augen zusammen. Dumpf schlug ein Körper dicht neben ihr auf. Sie wusste, dass er dem Sklavenfänger gehörte, und sie wusste auch, dass sie diese schreckliche Wunde nicht sehen wollte. Plötzlich stand sie. Ihr war, als bewegten sich ihre Füße ohne eigenes Zutun. Nicht hinsehen! Sie wankte über blutigen Sand hinweg, die Hände an den Ohren, die Augen auf die unschuldige Weite der Wüste geheftet.
»Grazia!«
Er packte ihre Schultern. »Anschar, ich ...«, stieß sie keuchend hervor. Und verstummte, als eine harte Hand in ihr Haar griff und sie zwang, sich zu drehen. Nicht Anschar stand vor ihr, sondern Bedyadrur. Dicht vor ihren Augen schwebte eine Dolchspitze.
»Aufhören!«, brüllte Bedyadrur, die Stimme schrill vor Furcht. »Aufhören, sonst stirbt sie!«
Er ging mit ihr in die Knie, als sei er der Erschöpfung nahe. Seine Hand zitterte so sehr, dass Grazia verzweifelt den Kopf gegen seine Hand presste, um Abstand zu der Klinge zu halten.
»Ja, ja!«, kreischte er. »Weg mit den Waffen!« Polternde Geräusche ertönten. »Ja, so ist es gut.«
Sie hörte Anschar ärgerlich knurren. Was war sie auch so dumm gewesen, sich aus seinem Schutz zu entfernen? Gleich würde sich diese scheußliche Dolchspitze in ihre Augen bohren, und dann würde sie nicht mehr erfahren, was mit ihm geschah. Sie gab sich einen Ruck und wagte es, den Kopf ein wenig zu drehen, so weit Bedyadrurs Griff es erlaubte. Aus dem Augenwinkel sah sie Anschar mit leeren Händen bei den letzten drei Herscheden stehen. Ein Mann hatte den fortgeworfenen Spieß an sich genommen; hinter Anschar stehend, drückte er die Spitze gegen seinen Nacken. Die anderen beiden standen zu seinen Seiten, einer hielt ein Schwert so, dass die Klinge auf der Schulter ruhte, als warte er nur darauf, sie hineinzuhacken. Der Dritte bückte sich rasch nach Anschars Schwert und deutete damit auf seinen schweißglänzenden, mit Blutspritzern übersäten Bauch.
»Sieht schon besser aus«, schnaufte Bedyadrur. Er leckte sich den Schweiß aus den Mundwinkeln. »Dafür ziehe ich euch beiden die Haut vom Leib.«
»Grazia!«, donnerte Anschar, so dass jeder zusammenzuckte. In seinem erhitzten Gesicht stand die blanke Wut. »Sieh nicht her!«
»Tötet ihn!«, brüllte Bedyadrur.
»Denk jetzt an dich!«
»So stecht ihn endlich ab!«
»Hast du verstanden?«
Das Geschrei wollte sie irremachen. Doch sie verstand. Anschar brauchte ihre Hilfe. Jedoch nicht für sich.
Sie versuchte sich auf Bedyadrur zu konzentrieren, seinen ekelhaften Mund mit Wasser zu füllen. Seinen Schlund, bis hinab in die Lunge. Er würde keine Luft mehr holen können und ersticken, und dann wäre sie frei. Mit aller Macht wollte sie das Wasser herbeizwingen. Sie ballte die Fäuste, dass ihre Nägel sich ins Fleisch bohrten. Ihr Kopf begann zu pochen. Tu es, tu es doch!, schrie sie sich stumm zu. Bedyadrur hob den Dolch. Sie riss die Hände hoch, umklammerte seinen Unterarm. Die Haut war glitschig, ihre Finger schwach, doch es genügte, ihn an seinem Tun zu hindern. Mit der anderen Hand versuchte er ihre Finger aufzubiegen. Blut sickerte unter ihren Fingerspitzen hervor. War es seines? Ihres? Er zeigte ihr seine gebleckten Zähne.
»Du tust mir weh«, spuckte er ihr entgegen. Seine Linke stieß sie zu Boden und schleuderte Sand in ihr Gesicht. Dann drückte er ihren Kopf nieder. Sie biss zu. »Verfluchtes Weib!« Er warf sich auf sie. Seine Dolchhand entschlüpfte ihrem Griff. Holte erneut aus.
Sie verschränkte die Arme vor dem Gesicht. Doch bevor sich der Dolch in ihren Leib bohren konnte, stieß Bedyadrur einen heiseren Schrei aus. Der Spieß steckte seitlich in seinem Hals. Er griff danach, rüttelte daran, bis das Blut in dünnen Bogen herausspritzte, und erschlaffte.
Anschar verpasste ihm einen Tritt, so dass er von ihr fortrollte. Grazia setzte sich auf, dem Sklavenjäger den Rücken zukehrend.
»Ist ... ist er tot?«, stammelte sie. An ihren Armen klebten Blutschlieren. Von wem? Sie schlug darauf, als wolle sie ein Insekt zerquetschen, und schrie.
»Ja, es ist vorbei«, sagte Anschar neben ihr und umfasste ihre Schultern. Als sie sich ihm zuwandte, wollte sie zurückzucken; an seiner Haut klebte so viel mehr Blut. »Es ist alles gut. Glücklicherweise waren sie schlecht bewaffnet, sonst hätte die Sache anders ausgehen können. Wenn nur einer einen Bogen gehabt hätte ... Komm.«
Er hob sie auf die Arme und trug sie ins Zelt. Bis hierher war das Grauen nicht gedrungen, und sie konnte aufatmen. Er setzte sie auf Bedyadrurs Pritsche und ging vor ihr in die Knie. Ihr Kopf sackte nach vorne, bis ihre Stirn auf seiner Schulter lag. Seine Hände glitten über ihren Rücken, ihre Arme, ertasteten vorsichtig die schmerzenden Stellen, wo die Männer sie geschlagen hatten. Ihrerseits berührte sie seine staubbedeckten Haare. Konzentrierte sich darauf, das Wasser fließen zu lassen. Aber ihre Hände zitterten nur. Sie begann am ganzen Leib zu schlottern. Anschar hielt sie fest.
»Du weinst nicht«, sagte er. »Das passt überhaupt nicht zu dir.«
»Aber du weinst auch nicht.«
»Ob ich meiner argadischen Angewohnheit nachkomme, ist ja auch nicht wichtig. Dein Gesicht ist übrigens fast so rot wie deine Haare.«
Sie fasste sich an die Nase. In der kurzen Zeit, in der sie unbedeckt gewesen war, hatte sie sich einen heftigen Sonnenbrand eingefangen. Nun merkte sie, dass auch ihre Schultern und Arme brannten. Und dass sie Durst hatte. Sie leckte sich über die trockenen Lippen und betrachtete ihre dreckigen Hände.
»Feuerköpfchen, warum kannst du kein Wasser machen?«
»Ich weiß nicht ...« Sie wollte sagen, dass ihr wohl der Schreck zu sehr in den Gliedern saß, aber es auszusprechen, hätte diesen Schrecken vielleicht zurückgeholt. An die gierigen Blicke dieser Kerle, an ihre groben Finger und das, was beinahe mit ihr geschehen war, wollte sie nicht denken. Sie wollte es ausmerzen. Flehendich sah sie Anschar an, dass er nicht fragte, aber er tat es doch.
»Haben sie ...«
»Nein! Nein, haben sie nicht, und bitte sprich nicht mehr davon.«
Er nickte langsam, stemmte sich hoch und schritt durchs Zelt. Im Durcheinander fand er einen ledernen Becher. Grazia nahm ihn entgegen und starrte hinein. Dann legte sie eine Hand darüber und schloss die Augen. Wartete auf das Gefühl der Kälte, die über ihre Haut strich, bevor das Wasser kam. Aber da war nichts, nur Schweiß und Angst, die ihr in der Kehle steckte. Als sie die Hand wegnahm, blickte sie auf einen trockenen Grund. Anschars Miene zeigte keine Regung, doch seine Stimme war belegt. »Sag, hast du wirklich sämtliche Wasservorräte vernichtet?«
»Nein, hier hab ich noch welche gesehen.«
Er drehte eine neue Runde durchs Zelt, schob mit dem Fuß ein paar Lumpen und Decken beiseite und befingerte die Beutel. Als er vor ihr in die Hocke ging, lag auf seiner geöffneten Hand die Heria. An ihr Schmuckstück hatte Grazia von dem Moment an, als sie auf dem Rücken des fremden Sturhorns aufgewacht war, nicht mehr gedacht. Harasch musste sie ihr abgenommen haben, als sie bewusstlos gewesen war. Sie schob das Kettchen über den Kopf und zuckte unwillkürlich zurück, als Anschar ihr helfen wollte, die Haare hindurchzuziehen. Aber das war ja Unfug, das Ohr ließ sich ohnehin nicht verbergen, also hielt sie still. Es schmerzte sie, mit anzusehen, wie Anschars Augen sich voller Entsetzen weiteten. Unentwegt schüttelte er den Kopf, während er über die Kante ihres Ohres strich.
»So schlimm ist das ja nicht«, murmelte sie. »Bei uns ...«
»Ja, ich weiß, bei euch entstellt das eine Frau nicht. Aber du bist nicht dort. Und ich kann darin niemals Schmuck sehen. Es ist eine Schande.« Eine steile Falte stand zwischen seinen Brauen, und er rieb sich nachdenklich über den Mund; er schien zu überlegen, wie sich der Schaden begrenzen ließe, aber das war ja etwas, das unmöglich war und über das er wohl schon tausendmal nachgedacht hatte. »Ein Sklavenmal«, sagte er noch einmal, als könne er es nicht begreifen.
»Es tut weh. Kannst du den Haken entfernen?«
Er zog seinen Dolch. Sie presste die Augen zusammen, und so behutsam er auch war, er konnte das Ding nicht aufbiegen, ohne ihr Leid zuzufügen. Blut rann an ihrem Hals hinab, und er wischte es mit der Handkante herunter. Endlich war es geschafft; voller Verachtung schleuderte er den Haken durchs Zelt. Grazia befingerte das dick geschwollene Ohrläppchen. Diese Löcher waren nicht klein, das wusste sie ja, trotzdem zuckte sie zusammen, als sie spürte, wie sich die Kuppen von Daumen und Zeigefinger berührten. Nein, auch daheim wäre dieses Ohrloch alles andere als eine Zierde. Ihre Mutter würde vermutlich in Ohnmacht fallen. Mit der Hand wischte Anschar das Blut von ihrem Hals. »Sie können froh sein, dass sie tot sind«, sagte er gepresst. »Ruh dich aus. Ich sehe nach, wo die anderen bleiben; Parrad hat gesehen, in welche Richtung ich ritt.«
Sie kroch auf die Pritsche. Der Gestank des Sklavenfängers stach ihr in die Nase, aber das erschien ihr jetzt denkbar unwichtig. Mit einem Lumpen, den Anschar vom Boden auflas, rieb er sich notdürftig die angetrockneten Blutspritzer von den Armen. Vor dem Zelt entfuhr ihm ein überraschter Laut; offenbar hatte er die beiden Sklaven entdeckt. Grazia versuchte sich zu entspannen, überzeugt davon, kein Auge schließen zu können. Doch der Schlaf kam schnell und traumlos.
Gemurmel weckte sie. Mit klopfendem Herzen fuhr Grazia hoch. Erleichtert schlug sie sich auf die Brust, als sie die Stimmen der Wüstenmänner erkannte. Ralaod kam ins Zelt und brachte ein weißes Gewand. Unter der Achsel hatte sie ein Bündel. Sie sagte nichts, und ihr Schweigen war wohltuend. Aus dem Bündel nahm sie einen Tiegel und öffnete ihn. Grazia schlüpfte aus Anschars Hemd, schob es unter die Achseln und ließ sich Schultern und Gesicht mit einer fettigen Paste einschmieren, die den Sonnenbrand und die Spuren der Schläge milderte. Dann schlüpfte sie in das unförmige Gewand. Es war wie alle, ein riesiges Viereck, das um die Taille Löcher aufwies, durch die man einen Schal oder eine Schnur ziehen konnte. Ralaod half ihr, die Fransen unter den Handgelenken zu verknoten, damit es nicht aufsprang. Das Gewand besaß eine Kapuze, aber Grazia widerstand dem Drang, sich zu bedecken, damit niemand das Ohrloch sah. Stattdessen band sie die Haare im Nacken zusammen. Nun erst begriff sie, was es hieß, derart gezeichnet zu sein, und auf eigenartige Weise fühlte sie sich dadurch Anschar noch näher verbunden. Ralaod wiegte nur den Kopf, als sie es sah, und strich bedauernd über ihre Wange. Sie ging vor ihr in die Hocke und knüpfte das Bündel auseinander. Auf dem Tuch lagen Theodor Fontanes Roman, die Kaloderma-Dose, die Bronzeklinge und das Streichholzetui.
»Das ist alles, was wir von deinen Sachen fanden«, sagte die Wüstenfrau. »Alles andere hat der Sturm sonst wohin getragen.«
Grazia hob das Buch auf. Effi Briest. Es war zerschlissen wie ein alter Dachbodenfund. Sie blätterte darin und blies Sandkörner aus dem Falz. »Meine Kleider ... die Bücher, die Uhr...«
»Alles weg.«
Sie wollte jammern, aber dann schlug sie entschlossen das Buch zu. Was sollte sie das kümmern, nachdem der Tod hier gewütet hatte und es vielleicht noch tun würde? »Wisst ihr schon, dass ich ... also, das Wasser ... ich ...«
Ralaod schob fragend die Brauen aneinander. Da flogen draußen erregte Worte hin und her. »Warum fragst du nach dem Wasser?«, rief Parrad. »Hier ist wenig, und selber hatten wir kaum noch etwas.«
Grazia raffte das Gewand und lief vors Zelt. Die Männer standen im Kreis, zwischen den Füßen die letzten unbeschädigten Wasserbeutel. Ein armseliges Häuflein. Mittlerweile dämmerte es, und einer war damit beschäftigt, das Lagerfeuer der Herscheden wieder in Gang zu setzen. Sie schielte dorthin, wo der Kampf gewütet hatte, aber nur noch dunkle Flecken im Sand erinnerten daran. Anschar hatte die Toten offenbar im Felsspalt versenkt. Sie riss sich von den Erinnerungen los.
»Ich kann kein Wasser machen«, sagte sie mit vorgerecktem Kinn, und sie fuhren auseinander und starrten sie an. »Und ich bin daran schuld, dass kaum noch etwas da ist.«
»Mir war die Sache ja von Anfang an nicht geheuer«, murmelte Parrad. Er neigte den Kopf und kniff die faltigen Lider zusammen, als sei er sich nicht sicher, dass der Anblick ihres blutigen Ohrläppchens keine Täuschung war. »Warum hattest du die Vorräte nicht erneuert?«
Anschar ging sofort dazwischen. »Weil ich ihr sagte, das sei nicht nötig! Wir sind leichtfertig geworden, weil es ihr die ganze Zeit so einfach gelungen ist.« Er sah sie an, und sie glaubte zu wissen, dass er an jenen Moment dachte, als er den von ihr gefüllten Becher achtlos beiseite geworfen hatte. »Ich trage allein die Schuld, denn mir obliegt die Verantwortung für das Unternehmen. Nun werde ich den Meya und ganz Argad enttäuschen, nur dass ich nicht mehr erleben werde, wie er mich ansieht. Inar verfluche mich dreimal, warum konnte ich nicht verhindern, dass sie in die Fänge dieser Leute geriet, da ich doch weiß, dass sie für so eine Reise nicht geschaffen ist?« Aus seinen heiseren Worten glaubte sie die Furcht um sie herauszuhören, die sich seiner im Nachhinein bemächtigte. Er baute sich vor Parrad auf »Es steht dir nicht zu, ihr irgendetwas vorzuwerfen. Vergiss nicht, was du bist.«
Grazia fand, dass Parrads Frage nicht vorwurfsvoll geklungen hatte, aber der Wüstenmann nickte nur. »Ich nehme an, wenn wir in ein paar Tagen tot sind, spielt es keine Rolle mehr, welchen Völkern wir angehören oder ob wir Sklaven sind.«
»Wenn wir den nächsten Außenposten der Sklavenjäger finden ...«, fing Oream an, doch Parrad schüttelte den Kopf.
»Und wo sollen wir den suchen?«
»Genug davon«, sagte Anschar. »Wir bleiben hier, sparen unsere Kräfte und trinken so wenig wie möglich. So bleiben uns ein paar Tage, die Grazia Zeit hat, sich wieder zu erholen. Vielleicht braucht sie ja nur das.«
Seine Augen, als er sich ihr zuwandte, waren ein einziges Flehen: Lass es so sein. Sie kaute am Daumennagel und wandte sich ab. Warum nur fühlte es sich an, als hätte sie diese Gabe nie empfangen?
Ihr Blick fiel auf die beiden Gefangenen. Noch immer, wenngleich losgebunden, hockten sie beieinander am Fels. Die Frau hatte die Finger in die Schulter des Mannes gebohrt und redete leise auf ihn ein. Er schüttelte den Kopf, doch sie ließ nicht ab, ihn zu was auch immer überreden zu wollen. Der Wortwechsel war kaum zu verstehen, aber nun waren auch Anschar und die anderen darauf aufmerksam geworden. Als die Wüstenfrau sichtlich verzweifelt ihrem Gefährten auf die nackte Brust klatschte, ging Anschar zu ihnen.
Die Frau sah zu ihm auf. »Wir wissen, wo Wasser ist.«
»Du wirst schweigen!«, rief der Mann. Der terrakottafarbene Ton seiner Haut, der den Wüstenmännern zu eigen war, hatte sich verändert, war fast grau geworden.
»Sag es ihm«, drängte sie, die Hände wieder auf der Schulter des Gefährten.
»Sag du es«, fuhr Anschar dazwischen. Doch nun schüttelte sie ihrerseits den Kopf. Fassungslos warf er die Hände hoch. »Was soll das? Wir drohen hier zu verdursten! Redet schon!«
»Nein«, beharrte der Wüstenmann.
»Weshalb nicht?«
Verstockt kauerte er sich zusammen und umschlang die Knie. Die Frau tat nichts mehr, ihn umzustimmen. Anschar machte einige unschlüssige Schritte; alle wichen vor ihm zurück. Sein Blick streifte Grazia, und sie sah die Ratlosigkeit darin.
Er stapfte zu einem der Sturhörner. Vom Sattel riss er die Peitsche, und während er zu dem Mann zurückkehrte, schüttelte er sie aus. »Steh auf. Steh auf und sieh mich an.«
Der Mann gehorchte. Einen Kopf kleiner als Anschar, wirkte er, als wolle er sich vor Furcht in die Spalte stürzen.
»Rede!«
»Ich kann nicht. Du wirst uns zwingen, euch zu begleiten, aber ich will nicht dorthin zurück.«
Grazia glaubte nicht, dass Anschar es tun würde. Wusste er nicht selbst am besten, wie es war, gepeitscht zu werden? Es konnte nichts als eine Drohgebärde sein, aber eine Sekunde später knallte das Leder auf die Brust des Wüstenmannes, der schrill aufschrie, die Arme hochwarf und in die Knie ging. Weitere Schläge folgten. Blutige Spuren zogen sich über den Bauch des Mannes, dann über die Schultern, denn er warf sich nach vorn und vergrub das Gesicht im Sand. Die Frau hatte die Hände hochgerissen. Alle waren wie gelähmt, und über der für Grazia gänzlich unwirklichen Szenerie lastete bleischwere Stille. Nur die Peitsche sprach.
»Anschar!«, stieß Grazia endlich den Schrei hervor, der ihr die Kehle verstopfen wollte. »Wie kannst du das tun? Ausgerechnet du?«
Er hielt inne. Seine schweißfeuchte Brust hob und senkte sich. Die Peitsche sprang hoch, als er fortfahren wollte.
»Hör endlich auf!«, rief nun auch Parrad. Anschar wirbelte zu ihm herum. Sein Freund starrte an sich herab. Eine rote Linie zog sich quer über seine Brust.
»Habt ihr elendes Wüstenpack vergessen, dass ihr nichts anderes als das seid?«, schrie Anschar in die Runde, die Peitsche erhoben. Alle wichen zurück. Als er Anstalten machte, sich wieder dem am Boden Liegenden zu widmen, hob dieser die gespreizten Hände.
»Ich sage es«, wimmerte er, unter Tränen kaum verständlich. Anschar keuchte auf, wischte sich den Schweiß aus den Augen und wankte in Richtung des Zeltes. Die blutige Peitsche entglitt seiner Hand. Mit einer heftigen Bewegung, aus der noch sein Aufruhr sprach, warf er die Plane zurück und verschwand darin. Während Parrad sichtlich fassungslos den Striemen betastete, zog Oream den Fremden auf die Knie. Ein anderer reichte ihm einen Wasserbeutel, den er gierig an die aufgebissenen Lippen setzte. Er zitterte wie ein Gebüsch im Wind, und sein schäbiges Hüfttuch sah aus wie eingenässt.
»Wir flohen aus einem Dorf.« Er deutete in eine Richtung.
»Im toten Land?«, fragte Oream.
»Es ist nicht tot. Es ist eine Sklavenjägerstadt. Hundert Hütten voller Sklavenjäger. Das Leben eines Wüstenmenschen ist dort nichts wert.«
Im Zelt fand sie Anschar am Boden kniend, den Rücken dem Eingang zugewandt. Sie wollte auf ihn zustürmen, ihn umarmen und trösten; und noch viel mehr wollte sie ihm ins Gesicht hauen, weil er etwas so Schreckliches getan hatte. Doch sie riss sich zusammen. Vorsichtig näherte sie sich ihm. Die Peitschennarben unter seinen halb aufgelösten Zöpfen glänzten auf der gebräunten Haut. Für gewöhnlich fielen sie ihr nicht auf, jetzt aber stachen sie ihr förmlich ins Auge. Ausgeprägt waren die hellen Linien nicht, und nur, wenn man darüber strich, spürte man ihre Erhabenheit. Konnte man ein Sklavenleben einfach abwerfen? In einer solchen Lage? Ein Ruck ging durch ihn, als Grazia seinen Rücken berührte.
»Mach mir keine Vorhaltungen«, sagte er matt. »Ich weiß, was ich getan habe. Ich bin einer, der aufsässige Sklaven tötet, wenn sie den Meya bedrohen. Und dieser tat das ganz eindeutig.«
Sie kniete an seiner Seite. Er hielt ein blutiges Messer in der Hand. Aus der anderen, zur Faust geballt, troff Blut. Es klebte in seinem Gesicht. Die Frage, was er geopfert hatte, lag ihr auf der Zunge, als er die Faust öffnete und einen roten Strich offenbarte. Dass auch eigenes Blut als Opfer galt, war ihr neu; andererseits mangelte es an Opfertieren. Und ihr mangelte es an Wasser, mit dem er sich das Blut abwaschen konnte. Plötzlich war nichts mehr richtig. Vorsichtig entwand sie das Messer seiner schlaffen Hand und legte ihre hinein. Sie wünschte sich die vergangenen Monate zurück, die zwar anstrengend, aber ungetrübt gewesen waren.
Tränen begannen Furchen durch das Blut zu ziehen. »Wie hieß noch der aus deinen Geschichten? Der sich nicht anders zu helfen wusste, als mit dem Schwert auf die Zugseile eines Kampfwagens zu schlagen?«
»Alexander.«
Er legte den Kopf in den Nacken, kniff die Lider zusammen und ließ die Tränen versiegen. »Ist der Knoten wenigstens auf? Hat der Mann geredet?«
»Die beiden flohen aus einer Siedlung von Sklavenjägern. Es scheint ein übler Ort zu sein.«
»Wir müssen dorthin; uns bleibt keine andere Wahl.« Er kam auf die Füße, raffte einen herumliegenden Lumpen auf, mit dem er den Dolch säuberte. Sie folgte ihm, wie er vors Zelt trat. Wer noch dort stand, starrte ihn erschöpft an. Parrad schien sich nicht von der Stelle gerührt zu haben. Dass sein Herr blutverschmiert aus dem Zelt kam, entlockte ihm ein ermattetes Kopfschütteln. Wo war der fremde Wüstenmann? Grazia entdeckte ihn abseits kauernd, bei ihm die Frau und Oream, der eine Wundpaste angerührt hatte. Anschar würdigte ihn keines Blickes.
»Parrad«, sagte er tonlos. »Ich hätte mich nicht gehen lassen dürfen. Nicht dir gegenüber.«
Parrad nickte nur. »Wir sind alle nicht mehr ganz beieinander.«
»Macht euch aufbruchbereit. Wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir es mit dem bisschen Wasser schaffen wollen.«