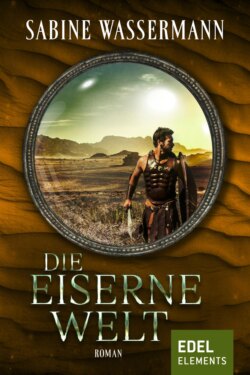Читать книгу Die eiserne Welt - Sabine Wassermann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеAnschar entzündete am Lagerfeuer einen Span und hielt ihn an den Docht einer Tonlampe. Grazias kleinen Vorrat an Feuerhölzchen sparten sie auf, so gut es ging. Als er gefragt hatte, weshalb sie aus ihrer Welt keine der Lichtkugeln mitgebracht hatte, war sie in hakloses Gekicher ausgebrochen. Inzwischen wusste er, dass eine Lichtkugel so wenig aus sich allein heraus leuchtete wie diese Flamme. Trotzdem blieb alles, was Grazia erzählte oder ihm in ihren Papierbündeln zeigte, unfassbar. Menschen, die über weite Entfernungen miteinander sprechen konnten? Straßen, in denen jedes Haus größer als der Palast des Meya war? Er hatte sogar ein Bild gesehen, auf dem ein Schiff größer als ein Palast war. Ein Schiff! Und diese Frau, die all das kannte, geriet in Verzückung, wenn sie ein zerbrochenes Tongefäß fand, das irgendwelche Wüstenwanderer vor Jahrhunderten vergessen hatten. Auch jetzt, da sie den abschüssigen Weg vom Höhleneingang herabkam, blickte sie sich neugierig um. So ängstlich sie oft war, ihre Neugier ließ sich nicht bändigen.
»Sieh mal.« Ralaod eilte auf sie zu. »Die Höhle wurde früher als Rastplatz genutzt. Das lag in der Asche.«
»Eine Messerklinge! Sie muss alt sein, der Griff ist verrottet.« Wie einen Schatz drückte Grazia das Fundstück an sich, während sie zwischen den um das Feuer versammelten Wüstenmännern hindurchschritt. Einer der Männer neigte ehrerbietig vor ihr den Kopf und zeigte ihr eine blutende Schramme am Arm, die er sich irgendwann am Nachmittag zugezogen hatte. Zierlich ging sie vor ihm in die Hocke und hob eine Hand über der Wunde. Ihr Wasser wusch den Schmutz heraus. Er wagte nicht, Grazia anzusehen, und murmelte einen Dank; auch die anderen blickten unsicher drein, wenn sie so etwas tat.
Anschar hatte neben sich für sie ein paar Felle ausgebreitet; dort ließ sie sich nieder und hielt die Klinge ans Licht.
»Wenn wir je wieder zurückkehren, haben wir einen Beutel mit Geschenken des Herrschers von Temenon und säckeweise Zeug, das du unterwegs aufgesammelt hast«, spottete er.
»Aber es ist alt! Und es zeigt uns vielleicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind.«
»Wieso?« Parrad rückte näher, um einen Blick auf diese bemerkenswerte Klinge zu werfen.
»Sie ist aus Bronze. In deinem Volk gibt es kaum jemanden, der etwas von Metallverarbeitung versteht, deshalb ist sie vermutlich nicht von Wüstenmännern vergessen worden. Es könnte natürlich Tauschware sein. Aber hier am stumpfen Ende sind Löcher, siehst du? Sie sind halbkreisförmig angeordnet. Ich glaube, dass Nieten darin waren; sie haben den Griff gehalten. Aber das ist nicht bezeichnend für Argad. Stimmt’s, Anschar?«
Anschar nickte nur, über die Karte gebeugt, die er aus ihrem Futteral genommen hatte, um sie im Schein der Lampe zu begutachten.
»Und deshalb könnte er aus Temenon stammen«, fuhr sie fort. »Woher sonst? Vielleicht haben hier Leute gerastet, die vor langer Zeit ausgeschickt worden waren, Argad zu erreichen.«
Hier? Anschar hob den Kopf und betrachtete das Höhlengewölbe mit neuen Augen. So hoch wie zwei Männer war es, und um ein Vielfaches lang. Das Feuer verlor sich darin; sein Licht reichte kaum bis zu den Sturhörnern, die an einer Wand Seite an Seite kauerten und dösten. Auch hier gab es kleine Öffnungen in der Höhlendecke, die jetzt nichts als den nachtschwarzen Himmel zeigten, und schmale Seitenkammern. Er stellte sich vor, dass einstmals Siraia, seine Mutter und Gesandte Temenons, und Henon, ihr Gefolgsmann, hier gewesen waren. Vor sechsundzwanzig Jahren hatten sie als einzige Überlebende einer vielköpfigen Reisegruppe erfolgreich die Wüste durchquert, um Temenons Bitte um Frieden zu überbringen, damit der Fluch endlich ein Ende fand – und in Argad versklavt zu werden, wie jeder Mensch, der sich dem Hochland näherte. Niemand hatte ihnen zugehört, Siraia war gewaltsam geschwängert worden, und so tat der Fluch unaufhaltsam seine Wirkung. Vielleicht hatten sie genau dort gesessen, wo Grazia jetzt saß und die Klinge sorgsam neben sich auf das Fell legte.
»Wie kann sie das alles wissen?«, riss Parrad ihn aus seinen Gedanken. »Sie stammt ja nicht einmal von hier.«
Anschar hob die Schultern. »Dass du dir immer noch solche Fragen stellst? Sie weiß das, weil sie aus einer anderen Welt kommt.«
Grazia lächelte, und er genoss Parrads kaum verhohlene Bewunderung. Dann schüttelte er über sich selbst den Kopf und entfaltete das Papier. War es nicht völlig gleich, was ein Wüstenmann empfand? Aus einem Zeichenkästchen nahm er ein Stück Graphit und vervollständigte die Karte. Wann immer sie einen markanten Punkt erreicht hatten, tat er das und notierte dazu, wie viel Zeit sie von der letzten Wegmarke bis hierher benötigt hatten. Jenseits davon war das Papier leer, das tote Land begann. Man sagte, es berge nichts, nicht die kleinste brackige Quelle, nicht die dornigste Pflanze, nicht das geringste Insekt. Sie wussten nicht, wie weit Temenon noch entfernt war. Sie wussten nicht einmal, ob die Richtung stimmte. Die Klinge mochte ein wichtiger Hinweis sein, doch was fehlte, war ein Mensch, der ihnen bestätigte, dass sie auf dem richtigen Weg waren.
Er verstaute das Papier in einer ledernen Tasche. Darin lag auch das Geschenk des Meyas an Temenon, ein Wandteppich, wie er kostbarer nie gefertigt worden war. Auch das königliche Rollsiegel aus schwarzem Gestein war darin; es hatte ihnen mehrmals geholfen, lästige Sklavenjäger abzuschütteln. Mittlerweile hatten Ralaod und Oream getrocknete Graswurzelkugeln in Ziegenbälge gestopft und knieten nun vor Grazia, um sie mit Wasser auffüllen zu lassen. Die Beutel hängten sie an ein kupfernes Gestänge über dem Feuer. Auf einem flachen Stein breiteten sie die Beute des Tages aus: zwei gehäutete und ausgenommene Echsen; ein Korb mit Früchten, schwarz und winzig wie Kieselsteinchen; ein Bündel Felsengraswurzeln. Dazu die getrockneten Fleischreste eines älteren Fanges. All dies zerrieben sie unter Steinen zu Brei, mischten es und formten Kugeln daraus. Anschar verzog das Gesicht, denn an die hauptsächlich aus Wurzelbrei bestehende Nahrung der Wüstenmenschen würde er sich nie gewöhnen. Die anderen hingegen umstanden das Feuer, stocherten im Beutel, damit die Kugeln aufquollen, und freuten sich sichtlich, ihre Mägen zu füllen. Auch Mehl hatten sie, und das daraus gebackene Fladenbrot war eine Kostbarkeit. Anschar brachte Grazia das größte, in Fett getränkte Stück.
Vorsichtig nahm Grazia es entgegen. »Immer kriege ich die besten Stücke, das ist mir peinlich.«
»Du bist von uns allen die Wichtigste, das weißt du.«
»Trotzdem. Ich will nicht ...«
»Iss!«
Sie blies darauf und biss hinein. Anschar ließ sich seitlich auf einen Ellbogen sinken und betrachtete das armselige Brotstück in seiner Hand. Die Vielfalt der mitgeführten Vorräte und Schlachttiere war längst wie ein weit zurückliegender und umso begehrlicherer Traum. Nahrhafte Felsengraswurzeln fanden sich häufig, aber das Glück der Jagd fiel sehr unterschiedlich aus. »Wir werden alle dürr in Temenon ankommen, wenn die Gegend weiterhin so kärglich bleibt. Wenn wir es denn finden.«
Bald hatten sie gegessen; die Männer gingen dazu über, sich die Zeit mit Geschichten und Liedern zu vertreiben und die mitgeführten Bronzemesser zu schärfen. Er bemerkte, wie Ralaod etwas Wurzelbrei mit einem ockerfarbenen Pflanzenpulver verrührte und in eine Schlangenhaut stopfte. Ein Stück davon band sie ab und löste es mit den Zähnen vom Rest der Haut. Das winzige Kügelchen hielt sie Grazia hin, doch die rümpfte die Nase und schüttelte sich. Leise lachend drehte sich Ralaod weg, spreizte die Schenkel und machte sich an ihrem Unterleib zu schaffen. Tief errötet senkte Grazia den Kopf. Anschar lächelte in sich hinein. Die Argaden, seines Wissens auch die Wüstenmenschen, glaubten, dass der weiße Saft des Mannes das Leben schenkte. Die Frauen ihrer Welt jedoch, so hatte sie ihm stotternd versichert, konnten nur schwanger werden, wenn sie mit dem Mann vermählt waren. Ralaod wischte ihre Finger am zerschlissenen Gewand ab, winkte Oream zu sich und huschte mit ihm in irgendeine verborgene Ecke.
Grazia ließ sich einen glimmenden Span reichen und machte sich auf den Weg hinauf in ihre Schlafhöhle. Sie hatte ihn während dieser vier Monate nicht allzu oft an sich herangelassen, denn sie hasste es, dass jeder hören konnte, was er dann mit ihr tat. Und da er sich sagte, dass alle Männer, von Oream abgesehen, darben mussten, bedrängte er sie nicht. Wie jeder Sklave hatte er lernen müssen, enthaltsame Zeiten durchzustehen – umso kostbarer waren ihm diese Nächte, umso drängender jetzt der Wunsch, sich von Grazias Körper umhüllt zu wissen. Aber sie brauchte Zeit, sein übereilter Vorstoß hatte ihm dies wieder einmal gezeigt. Sie war wie eines der hauchdünnen, durchschimmernden Glasgefäße im Palast des Meya: Es zwang einen, behutsam zuzufassen, achtsam zu sein. Andernfalls zerbrach es.
Er folgte ihr. Sie hatte das sandfarbene Wüstengewand abgestreift. Am Eingang lehnte er sich an die Wand, um sie in Ruhe zu betrachten, ihren eng geschnürten Leib und das einstmals weiße Kleid darunter. Sie entzündete eine Kerze und wedelte mit der anderen Hand, damit der Span erlosch. In einer Felsnische ließ sie Wachs niedertropfen und steckte die Kerze darauf. Dann schenkte sie ihm ein verlegenes Lächeln und lockerte das feuchte Haar. Mit den Fingern fuhr sie hindurch, bis die rote Pracht ihren Oberkörper umwallte. Das Berückendste an ihr war zweifellos, dass ihr immer noch nicht bewusst war, welche Wirkung diese Geste in ihm hervorrief. Aus dem Kasten nahm sie eine Dose; die öffnete sie, steckte den kleinen Finger hinein und drückte sorgfältig wieder den Deckel darauf. Bedauernd betrachtete sie den weißen Klecks auf der Fingerspitze.
»Bald leer. Ich hätte sparsamer sein müssen.«
Sie verrieb die Salbe auf den Wangen, bis sie glänzten. Auch die Lippen schürzte sie und fuhr sich darüber. Ihm war genug des Wartens, er ging zu ihr und legte eine Hand auf ihre Hüfte. Mit der anderen nahm er die Dose an sich.
»Du hast mir nie erklärt, was Kaloderma heißt.«
»Das ist Griechisch. Da muss ich auch erst überlegen ... schön ... schöne Haut.«
Er wusste, dass es in ihrer Welt viele Sprachen gab, nicht nur eine, wie in dieser. Seine Sprache hatte Grazia mit Leichtigkeit gelernt, und sie beherrschte noch einige weitere, während es ihm unendliche Mühe bereitete, fremde Wörter zu lernen. »Schöne Haut«, wiederholte er, während er die Dose in den Fingern drehte. Immerhin, nun kannte er ein Wort in einer weiteren Sprache, auch wenn er dafür nie Verwendung haben würde. »Und weshalb steht das da?«
»Die Dose heißt so.«
»Ihr gebt euren Dosen Namen?«
Grazia kicherte und ließ sich auf das mit Decken und Fellen gepolsterte Podest fallen. »Anschar, du bist manchmal komisch. Ich vergesse immer wieder, wie anders ein Argade denkt. Sieh mal.« Sie streckte ihm einen Fuß entgegen. »Meine Sommersprossen sprießen hier in der Wüste wie verrückt. Sogar da.«
»Wie schrecklich.« Er setzte sich und ergriff den Fuß, als wolle er sich das genauer ansehen. Die Dose warf er irgendwohin. Seine Finger fuhren zwischen ihre Sohle und die Sandale und holten die Sandkörnchen heraus. Grazia quiekte, aber unbarmherzig hielt er sie fest. Ihr großer Zeh verschwand in seinem Mund. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie sich ihre Lippen geöffnet hatten. Er kroch über sie und leckte ihr Fleckengesicht. Mittlerweile liebte er die Sonnenflecken. Gab es irgendetwas an ihr, das er nicht liebte?
»Du bist fröhlicher, seit du kein Sklave mehr bist«, murmelte sie. »Ich mag das so sehr.«
War er fröhlicher? Wenn man endgültig Willkür, Peitsche und den uringetränkten Becken der Papierwerkstätten entronnen war, sollte es leicht sein, selbst wenn jeder Tag dieser Reise, da ihr Ziel so unklar war, ihm mehr zur Last wurde als der vorige. »Sprich jetzt nicht davon«, raunte er in ihr Ohr.
»Ja, jetzt ... jetzt würde ich gerne ...«, wisperte sie und schlang nervös eine Strähne um ihren Finger. Ihre Lippen röteten sich, als sie verschämt an ihnen knabberte.
»Was denn?« Anbeißen wollte er diese Lippen, ihre Wangen, wie sie sich erhitzten, weil er sie zwang, es auszusprechen. Die ganze Frau wollte er essen, denn sie schmeckte nach Sonne, Unschuld, Trotz, Schöner Haut.
»Bitte! Du bist gemein.«
»Nicht schmollen, Feuerköpfchen. Sag es.«
»Nein.«
»Sag es.«
»Nein!«
Er lachte sie an. Ja, in ihrer Gegenwart war es so viel leichter zu lachen. Fremde Sprachen konnte sie, aber die einfachsten Dinge in den Mund zu nehmen, war für sie undenkbar. Ihr anschmiegsamer Körper war dafür umso beredter, und ihre Hände zupften an seinem Hemd, bis es aus dem Bund seines Wickelrocks heraus war und sie darunter schlüpfen konnten. Seine Bauchmuskeln zogen sich zusammen, als ihre Nägel, längst nicht mehr so abgenagt wie früher, darüber strichen. Sie tat es in einer fordernden Weise, die für sie ungewöhnlich war, wenngleich schüchtern – und deshalb umso erregender. Seine Hände glitten über ihren Hals, schoben das Kettchen mit der silbernen Blume von Heria, seinem alten Sklavenzeichen, beiseite, wanderten über den Ansatz ihrer von dem Korsett angehobenen Brüste. Dass sie davon nicht lassen wollte, war eines jener Dinge, die er an ihr wohl nie begreifen würde. Er öffnete es, wie den Deckel eines Kastens, der eine Kostbarkeit enthielt. Durch das Unterkleid drückten sich ihre Brustspitzen. Er konnte nachempfinden, warum die preußischen Männer ihre Frauen in viele Stoffschichten zwängten. Wenn sie denn fielen, wirkte das, was zum Vorschein kam, umso nachhaltiger. Diese kleinen Brüste, wie sie sich hoben und senkten, zwangen ihn dazu, sich niederzubeugen und sie mitsamt dem Stoff zwischen die Zähne zu nehmen und ihrer Besitzerin die Laute eines balzenden Vogelweibes zu entlocken. Zögerlich befingerte Grazia seine Schenkel, glitt suchend unter seinen Rock. Aber er wusste schon, dass sie nicht mutig genug sein würde, ihn dort anzufassen, und er enthielt sich eines Schmunzeins, als sie die Hände zurückzog.
»Grazia.« Er streckte sich neben ihr aus und schob einen Arm unter ihren Nacken. »Mir will der Gedanke, dich hier verlieren zu können, nicht aus dem Kopf. Du bist ein Wunder. So etwas ist unberechenbar und nicht zu halten, und überhaupt ist das Leben viel zu widrig.«
»Das Wasser ist ein Wunder. Aber ich doch nicht.«
»Auch du.« Er hob ihren Kopf, um sie zu küssen. Seine andere Hand kämpfte mit ihrem Kleid und schlüpfte in den Spalt ihres Unterzeugs. Kurz hielt er inne, um sicher zu sein, dass es ihr gefiel. Aber die Nässe, in die seine Finger eintauchten, verriet sie. Er hob sich auf die Knie, um das einengende Kleidungsstück von ihrer Hüfte zu streifen, aber mit einem Mal bemächtigte ihn das Verlangen so sehr, dass er nicht länger warten konnte. Er sank nieder, spreizte ihre Beine und glitt in sie. Ihr Gesicht war seinem so nah, dass er ihren warmen Atem einsog. Schweißperlen standen auf ihrer Oberlippe. Ihr Mund, aufgeworfen und voll, berührte zitternd den seinen. Ihre Augen waren weit geöffnet, aber nicht vor Furcht. Langsam hob er den Unterleib und ließ ihn wieder sinken. Ein Wimmern entglitt ihr, und ihre Augen wurden schmal. Es gefiel ihr. So weit es möglich war, entblößte er ihr Gesäß und liebkoste es. Ihn beschlich das Gefühl, nicht mehr viel Zeit zu haben. Da war etwas, das ihn drängte, ihn gemahnte, dass das Leben widrig war – ein Geräusch? Ein dumpfes, anschwellendes Brausen. Er hörte die Sturhörner in der Tiefe stampfen und schnauben. Dann war es still, doch diese Stille ließ ihm die Haare zu Berge stehen.
Das Brausen kehrte zurück. Schwoll zu einem Donnern an. Seine Ohren wollten bersten. Grazia schrie. Mit einem Knall zerbarst die Felswand und stürzte auf ihn nieder.
Für einen langen Augenblick vermochte er nicht zu atmen. Er griff über sich, erspürte den Fels. Die Wand war dünn gewesen, aber welche Macht hatte sie zu Fall bringen können? Seine Finger fuhren über eine bröckelnde Kante. Dann kehrten alle seine Sinne zurück. Er presste das Gesicht auf Grazias und schirmte ihren Kopf mit den Händen ab. Wie spitze Pfeile drang der lebendig gewordene Sand auf ihn ein, schlug gegen seine Haut und beschwerte die Felsplatte, so dass jeder Atemzug eine schwer zu bewältigende Anstrengung war. »Grazia ...«, keuchte er. »Grazia!«
Sie lebte; er konnte unter den Fingern spüren, wie sie die Augen zusammengepresst hatte und vor Entsetzen zitterte. Sehen konnte er nichts, denn das Licht war erloschen. Es drängte ihn danach, die Hände von Grazias Gesicht zu nehmen, um sich abzustützen, damit der Fels ihn nicht mit seinem Gewicht erstickte. Mit aller Kraft wölbte er den Rücken, doch er bekam das Ding nicht herunter.
»Grazia«, presste er zwischen den vor Anstrengung zusammengepressten Zähnen hervor. »Du ... musst ... hier weg.«
Sie konnte ihn nicht hören, er hörte sich selbst kaum; das Tosen des Sturms riss ihre Schreie mit sich. Sie hustete und verspritzte in ihrer Not Wasser, was nichts half. Geh, dachte er, geh! Endlich zwängte sie sich unter ihm hervor und wankte fort, gepeitscht von stürmischem Sand. Er glaubte zu erkennen, wie sie auf alle viere sackte. Inar und alle Götter, dachte er, helft ihr!
Sich selbst glaubte er verloren. Er hatte die Hände gegen das Podest gestemmt, um wenigstens noch atmen zu können. Seine Schultermuskeln fühlten sich an, als seien sie selbst zu Felsgestein geworden. Seine Bemühungen, unter der Platte hervorzukommen, waren sinnlos. Ihm schwanden die Kräfte. Hart prallte ein Stück der Wand gegen seinen Schädel, und die Dunkelheit wurde zu Schwärze.
In seinem Kopf dröhnte und toste der Sturm. Die metallschweren Lider zu öffnen, war ihm fast unmöglich. Er zwang sich dazu, denn er erkannte, dass das Dröhnen nur noch eine Erinnerung war. Er hob den Kopf und lauschte. Der Wind heulte noch, jedoch gedämpft. Wasser tröpfelte. Grazia? Mit einem gewaltigen Schrei warf er sich hoch und erkannte, dass er in der großen Höhle war. Als er auf den Knien herumfuhr, sah er die Ursache jenes vertrauten Geräusches: Parrad hatte einen Lappen in eine Wasserschale getaucht und drückte ihn aus. Das Wasser war sandig und blutig.
»Beruhige dich«, sagte Parrad. »Dir ist nichts passiert. Du hast nur einen aufgeschürften Rücken und am Kopf etwas abbekommen.«
Anschar ertastete einen Verband, der um seine Stirn geschlungen war. Irgendwo am Hinterkopf war eine schmerzende Stelle, er fühlte blutverkrustetes Haar. Entsetzen brandete über ihn hinweg, als ihm vollends klar wurde, was geschehen war. Er packte Parrad an den Schultern und schüttelte ihn.
»Grazia! Was ist mit ihr? Wo ist sie?«
Sein Blick glitt suchend an den Männern vorbei, die ihn umstanden. Da war das Feuer, da der Stein, auf dem Ralaod das Brot gebacken hatte. Jetzt hatte sie die Knie angezogen und wiegte sich im geflüsterten Gebet an ihren Windgott. Die Sturhörner kauerten wie zuvor beisammen, nur ihre Schwanzspitzen zuckten nervös. Anschar kam auf die Füße und stieß die Männer beiseite, weil er es nicht glauben konnte. Nicht glauben wollte. Sein Leib zitterte, als er die ersten Schritte machte. Schließlich wandte er sich wieder Parrad zu. Der schlaksige Kerl wirkte im fahlen Lichtschein wie einer jener Sandgeister, die das Wüstenvolk anbetete. Sein Gesicht war zerfurcht, sein Bart von weißen Fäden durchzogen. War er wirklich so alt? Er senkte den Kopf, bis seine Augen unter den buschigen Brauen verschwanden.
»Wir haben sie nicht gefunden«, murmelte er und deutete auf ein Stoffbündel. Ihr Beinkleid. »Nur dies.«
»Nicht gefunden«, wiederholte Anschar gedehnt. Sand knirschte zwischen seinen Zähnen. Er fuhr sich durch die Haare und merkte kaum, dass der Verband an seinen Fingern hängen blieb. Fahrig schüttelte er ihn ab. »Sie ist aus der Kammer gekrochen. Ich habe es gesehen! Sie muss hier sein!«
Parrad kaute auf seinen trockenen Lippen. »Als der Sturm losbrach und wir das Krachen hörten, liefen ich und Oream gleich zu dir und zerrten dich unter der Felswand hervor. Grazia war nirgends zu sehen. Sie muss den falschen Weg genommen haben: den Weg hinaus.«
»Und ihr seid ihr nicht gefolgt?«
»Doch, natürlich, aber ...«
Anschar stürzte zum Feuer, riss ein brennendes Scheit heraus und rannte den Weg hinauf. Die letzten Schritte bis zum Ausgang musste er sich durch kniehohen Sand kämpfen, dazu Schutt, der zuvor nicht da gewesen war. Hinter ihm riefen die Männer, aber das hielt ihn nicht zurück. Erst der Wind, der ihm mit Wucht ins Gesicht fegte und ihm den Atem raubte, ließ ihn innehalten. Er kniff die Augen zusammen, und als er sie wieder öffnete, war das Scheit erloschen. Rings um ihn herrschte tiefste Dunkelheit. Dennoch stapfte er weiter, und als er sich umwandte, sah er die Felswand nicht. Nur Parrads Ruf ließ ihn den Eingang wiederfinden. Er wankte in die Arme des Wüstenmannes, spuckte Sand und brüllte seine Verzweiflung hinaus.
»Du kannst jetzt nichts tun!«, schrie Parrad gegen den Wind an. »Entweder sie hat irgendwo Schutz gefunden, oder sie ist tot.«
»Parrad, schweig, sonst prügele ich dich durch.«
»Das willst du dauernd. Aber, mein Freund, das ändert nichts. Komm zurück.«
Gemeinsam rutschten sie den Abhang zurück in die Höhle. Anschar ließ sich fallen und bohrte die Finger in den Sand. Die Furcht um Grazia drohte ihn zu überwältigen. Grazia – dort draußen! Warum war er zu schwach gewesen, sich gegen die Felswand zu stemmen? Warum waren die Götter, obschon nicht mehr in dieser Welt, so grausam?
Jemand reichte ihm einen Wasserbeutel. Er setzte ihn an die Lippen und trank. Sein Herz schlug heftig gegen den Brustkorb, hinter seiner Stirn klopfte es wie von Hammerschlägen. Tief atmete er durch, immer wieder, bis er die Furcht gebändigt hatte. Aber sie zerrte in seinem Innern wie ein wildes Tier, das an losen Fesseln hing.
»Sobald man die Hand vor Augen sehen kann, gehen wir hinaus«, sagte er heiser.
Das Erste, das sie wahrnahm, war ein warmer Luftzug, der über ihre nackten Unterschenkel strich. Das Zweite ein behäbiges Schaukeln. Noch bevor sie die Augen öffnete, begriff sie, dass sie bäuchlings auf einem Sturhorn lag. Ihre Schulter drückte gegen den schweißglatten Schenkel eines Reiters. Unter sich rötliches Geröll, Sand. Eine Eidechse floh vor dem riesigen Tier. Grazia blinzelte gegen die Helligkeit an. Eine Landschaft, so gottverlassen wie alle zuvor, zog an ihr vorüber. Niedrige Felsen, die einen breiten Hohlweg bildeten. Überall Rot. Selbst der Himmel war von rötlicher Färbung, als hinge noch der Sand in der Luft. Aber der Sturm hatte sich gelegt. Fast war es ihr, als hätte sie das Toben des Windes und das Beißen des Sandes nur geträumt, und langsam wurde sie gewahr, dass es wirklich geschehen war – ein Sandsturm, wie sie nie zuvor einen erlebt hatte. Doch wohin hatte er sie geweht?
Das Sturhorn, auch wenn es stank wie jedes, war ihr fremd, ebenso der Mann. Niemals hätte Anschar es zugelassen, dass sie so unbequem gelagert wurde, mit nichts als ihrem Unterkleid auf dem Leib. Unangenehm brannten die Sonnenstrahlen auf ihre nackte Haut.
»Ah, du bist wach.« Die Stimme über ihr klang amüsiert. »Gleich gebe ich dir zu trinken.«
Zu trinken? Ihr? Eine Hand klatschte auf ihren Hintern. Sie warf sich nach vorn und rutschte kopfüber in die Tiefe. Schreien wollte sie, aber ein Knebel verhinderte dies; sie konnte nur keuchen, als sie schmerzhaft auf dem Rücken landete. Ihre Hände waren hinter ihr gefesselt. Fluchend sprang der Mann herab und bohrte die Finger in ihre Wangen, da sie den Kopf wild schüttelte.
»Mach doch nicht solche Sachen! Ich befreie deinen Mund, aber du bist still, ja? Vorhin hast du wie am Bratspieß gebrüllt, da blieb mir nichts anderes übrig, als dir den Mund zu stopfen.«
Daran konnte sie sich nicht erinnern, aber das war ihr auch gleich. Heftig nickte sie. Er löste das Tuch und zog ein zweites aus ihrem Mund. Grazia japste und hustete. Sie bekam kaum Zeit, zu Atem zu kommen, da drückte der Fremde ihr den Stopfen eines Lederbeutels zwischen die Lippen. Sie schluckte das abgestandene Wasser, denn sie war viel zu verwirrt, sich zu sträuben. Über den Beutel hinweg musterte sie den Mann. Fast nackt und gefesselt, fühlte sie sich entsetzlich schutzlos. Was war nur mit ihr passiert?
»Das reicht jetzt aber, sonst habe ich ja nichts mehr.« Er zog ihr den Stopfen aus dem Mund und setzte ihn selbst an die Lippen. Sein mit bronzenen Perlen besetzter Ziegenbart wippte, als er trank.
»Bist du ein Sklavenfänger?«, fragte sie vorsichtig. Mit seinem strähnigen, schweißdurchtränkten Haar wirkte er so wild wie jeder Wüstenmann, aber nur Herscheden trugen solche Bärte. Ein Kittel aus einstmals vielfarbigen Flicken bedeckte seinen kräftigen Körper. Er ließ den Beutel sinken und rülpste. Belustigt hob er die Brauen.
»Was sollte ich wohl sonst sein? Und du? Siehst ja nicht gerade wie eine Wüstenfrau aus.« Mit rissigen Fingern, in denen der Sand klebte, fuhr er ihr durchs Haar. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Und deine Haut ...«
»Ich bin krank.«
»Krank?«
»Ja, die Flecken, das ... das ist etwas Ansteckendes«, stotterte sie sich zurecht, noch ganz benommen von der Erkenntnis, die Gefangene eines fremden Mannes zu sein. Rasch blickte sie um sich, aber da war sonst niemand. »Du solltest dich besser von mir fernhalten!«
Ihm klappte der Kiefer herunter, und Grazia hoffte, obwohl ihre Stimme äußerst zittrig geklungen hatte, dass er auf sein Sturhorn stieg und davonjagte.
Er warf den Kopf zurück und entblößte gelbe Zähne zu einem herzhaften Lachen. »Ich glaube dir kein Wort.«
Sie wollte darauf beharren, begriff aber, dass es sinnlos war. So oft hatte man geglaubt, ihre Sommersprossen seien ein gefährlicher Ausschlag, und nun war sie an den einen geraten, der sich nicht davon beeindrucken ließ. Er fasste unter ihre Achseln und zog sie auf die Füße.
»Ich bringe dich zu Bedyadrur, meinem Herrn; solche Beute wird ihn freuen. Inar und allen abwesenden Göttern sei Dank, dass ich dich gefunden habe.«
Sie schluckte schwer. »Wann hast du mich gefunden?«
»Heute früh, als dieser verfluchte Sturm abflaute. Hast halb unter Sand begraben dagelegen. Jetzt aber hinauf mit dir.«
Grazia starrte auf das über ihr aufragende Sturhorn. Der Gedanke, dass ihr der Herschede mit seinen groben Händen hinaufhelfen würde, erschreckte sie, und sie machte sich steif. Als er sich bückte und nach ihrem Schenkel griff, sprang sie von ihm weg.
»Ich tue dir nichts, du dumme Einhornziege!«, schimpfte er. »Bilde dir nicht ein, dass ich dich losbinde, nur weil du allein aufsteigen willst. Jetzt komm, ich bin ja ganz friedlich.«
Er streckte die Hand aus. Sie schüttelte den Kopf.
»Na schön.« Von der Seite des Sturhorns wickelte er ein langes Bündel geflochtenen Felsengrases ab. Das Ende in der Hand, ging er um sie herum und schlang es um ihre Fesseln. »Dann läufst du halt. Aber wenn du nicht mehr kannst, rufe und lass dich nicht einfach fallen. Wäre schade, wenn du dich verletzt.«
Er tätschelte ihre Wange, dann stapfte er zu seinem Reittier und schwang sich hoch. Mit dem Hieb einer Gerte und kräftigem Zügelzug brachte er es dazu, sich in Bewegung zu setzen. Das Seil spannte sich, und Grazia wurde herumgewirbelt. Sie schaffte es so eben, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und hüpfte dem Tier hinterher. Schnell musste sie sein, damit das Seil locker blieb, und sie war nur froh, dass sie ihre Sandalen trug. Irrwitzig war es, einfach irrwitzig, wie sie, die Hände auf dem Rücken, hinter dem furzenden Sturhorn herlief, stets darauf bedacht, Anschluss zu halten. Der Herschede beachtete sie nicht mehr, als habe er vergessen, was er da im Schlepptau hatte. Sie hingegen blickte sich verzweifelt um. Aber rings um sie waren nur diese Felswände, und dahinter offenbar nichts als wellenförmige Hügel. Wenn der Herschede mit ihr tatsächlich schon Stunden unterwegs war, mochte die Höhle sonst wo sein; wahrscheinlich entfernte sie sich von ihr mit jedem Schritt.
»Hilfe! Anschar! Anschar!«
Sofort war der Sklavenjäger bei ihr, verpasste ihr eine Ohrfeige und verstopfte wieder ihren Mund. Sie wollte seinen ebenso verstopfen, mit Wasser, aber was würde ihr das bringen, außer weiteren Schlägen? Ein paar Sekunden später saß er wieder im Sattel, als sei nichts geschehen. Blind vor Tränen wankte sie weiter. So ging es sicherlich zwei Stunden, in denen sie sich Schritt um Schritt vorwärts kämpfte, ihre Rückenschmerzen zu missachten versuchte und sich immer wieder umwandte, in der Hoffnung, Anschar käme auf seinem Sturhorn angeprescht. Aber nichts dergleichen geschah. Vielleicht lebte er nicht mehr. Sie erinnerte sich an seinen erhitzten Körper auf ihrem. Ein Dröhnen, ein ohrenbetäubender Knall, und dann war sie gelaufen, blind vor Furcht.
Von Anschar so brutal getrennt worden zu sein, ließ sie sich unendlich verlassen fühlen. Vielleicht war er tot. Nein!, dachte sie und ballte entschlossen die gefesselten Fäuste. Schon einmal hatte sie geglaubt, dass er tot sei, und sie war durch die Hölle gegangen. Diesmal wollte sie davon nichts wissen. Er lebte.
»Da wären wir!«
Grazia prallte gegen das Sturhorn. Die Beinhaare, hart wie Draht, kratzten über ihre Haut, als sie niedersank. Dicht vor ihr sprang der Herschede herab, zückte ein Messer und schnitt die Leine durch. Auch den Knebel entfernte er, aber noch immer blieben ihre Hände gefesselt. Grazia schnaufte und ersehnte ihr Korsett herbei, da ihr Rücken wie aus glühendem Metall gegossen zu sein schien. Der Herschede zog sie hoch und klopfte den Sand von ihrem Körper. Die Hand fest um ihren Arm gelegt, führte er sie mit sich. Ein anderer kam herbeigelaufen, sich um das Sturhorn zu kümmern. Weitere hockten unter einer Plane um ein Kochfeuer; sie alle hatten herschedische Bärte, in denen kupferne Perlen glänzten.
»Ho, Harasch! Wen bringst du denn da?«
»Ein Fundstück aus der Wüste.« Stolz schritt er mit ihr näher. »Ist Bedyadrur wach?«
Ein Mann nickte und deutete über die Schulter zu einem Zelt, das denen der Wüstennomaden ähnelte, mit ausgeblichenen Quasten und Schnüren behängt, an denen tönerne Perlen hingen. Sehr viel größer schien das Lager nicht zu sein. Da kauerten acht, neun Sturhörner, und die Zahl der Männer um das Feuer war groß, zwanzig vielleicht. Am Rande des Hohlweges hockten ein Wüstenmann und eine Frau. Gefangene?
Dann war sie auch schon im Innern des Zeltes. Ein Mann erhob sich von einer Pritsche.
Er war groß und schlaksig, der Bart besonders lang und kunstvoll mit Perlen verziert. Das einstmals blau und rot gewebte Gewand klebte an seinem Körper, als er auf sie zuwankte. Vom Boden raffte er einen Lederbeutel auf, wickelte die Schnur von der Öffnung und setzte an. Während er trank, näherte er sich ihr und zog sie mit den Augen aus. Haraschs wenigen erklärenden Worten hörte er scheinbar gelangweilt zu. Andere Männer waren gefolgt, sie bildeten einen Halbkreis um Grazia und befingerten ihr Haar. Sie warf den Kopf hin und her, vergeblich.
Bedyadrur drehte den Kopf zur Seite und spuckte Wasser auf den sandigen Boden. »Wie ist dein Name?«
Grazia schob das Kinn vor, auch wenn es zitterte. »Fräulein Zimmermann.«
»Kommst von weit her, was?«
»A-Argad. Ich bin aus Argad!«
»Dort gibt es keine Frauen, die so aussehen wie du. Oder so heißen.«
»Woher sollte ich denn sonst kommen?«
»Was weiß ich? Vielleicht haben dich ja die Sandgeister von irgendwo hergetragen.« Ein Herschede sprach von Sandgeistern? Er ahnte wohl, was sie verwunderte, denn er nickte langsam. »Wir ziehen durch die Gegend, auf der Suche nach Wüstenmenschen. So abscheulich das Geschmeiß ist, man lernt doch einiges von ihnen. Schau her«, er hob eine kleine Figur, die an einer speckigen Lederschnur von seinem Hals hing. »Ein Geschenk meiner letzten Sklavin. Ich hatte sie sicher ein Jahr, und ich mochte sie. Und den Herrn des Windes, von dem sie mir ständig erzählte, gibt es so sicher wie die abwesenden Götter. Vielleicht hat er den Sandsturm verursacht.«
Grazia blickte in die Richtung, aus der sie gekommen war. »Ich war nicht allein, da ist eine Reisegruppe, angeführt von Anschar, einem der Zehn. Du weißt doch sicher, wer er ist?«
»Anschar?« Gedehnt sprach er den Namen aus. »Keiner von uns war in den letzten zehn Jahren in Argad; wir kennen nur Fergos Stützpunkte, aber mit den Männern dort, denen wir die Sklaven verkaufen, unterhalten wir uns nicht großartig. Nein, ich kenne diesen Namen nicht. Was die Zehn sind, weiß ich natürlich: die Leibwächter des Meya. Aber das hieße ja, dass der König hier wäre. Und so einen Unsinn wirst du mir sicher nicht erzählen wollen?«
»Madyur-Meya hat Anschar ausgeschickt, Temenon zu finden ...«
Bedyadrur kicherte in sich hinein, während er an den Füßen seines aus weißem Gestein gefertigten Sandgottfigürchens nagte. »Temenon, das Land des alten Feindes! Und du meinst, das alles klingt glaubwürdiger, als dass du vom Himmel gefallen seist?«
»Aber es ist so!« In ihren Augen kribbelte es. Jedes Wort, das sie herausbrachte, bevor sie endgültig in Verzweiflungstränen ausbrechen würde, kostete sie große Kraft. »Schick jemanden aus, um nachzusehen.«
»Wohin denn?«
»Da war ein großer Felsen, darin eine Höhle. Irgendwo da, wo mich dein Mann aufgelesen hat.«
»Irgendwo da«, wiederholte er unbeeindruckt. »Nun ja, Mädchen, es mag stimmen, denn von irgendwoher musst du ja kommen. Aber ich werde dem nicht nachgehen, denn du bringst eine Menge Geld.«
Er trat dicht an sie heran, und ihr Herz setzte aus. Auch er stank nach Schweiß, aber nie hatte sie solchen Ekel verspürt. Seine Hand ruhte auf ihrer Schulter. Langsam schob er einen Träger ihres Unterkleides herunter und entblößte eine Brust. Sie hoffte auf eine gnädige Ohnmacht, doch der Gedanke, dass sie dann inmitten dieser Männer niedersinken würde, ließ sie hellwach bleiben. Als Nächstes hob er das Kleid an. Grazia würgte vor Scham, als die Luft über ihren bloßen Unterleib strich. Niemals war so etwas mit ihr getan worden.
»Da unten treibst du’s mit den Flecken nicht so schlimm. Und dieses kupferfarbene Vlies ist entzückend. Fergo wird es freuen. Er hatte schon immer eine Schwäche für Sklavinnen, die anders als gewöhnliche Wüstenweiber sind.« Er schlug das Kleid herunter und sah sie an. »Vielleicht behält er dich ja? Harasch?«
Der Angesprochene trat neben sie. Ein weiterer Name fiel, ein weiterer Mann kam. Bedyadrur hängte sich einen Beutel um den Hals und kramte darin. Grazias Furcht wuchs wie ein Geschwür, das ihr die Luftröhre zu umschlingen drohte, noch bevor sie das Instrument in seiner Hand sah.
Er hielt es dicht vor sein Auge, strich mit dem Daumen darüber und nickte. »Zum Ausstanzen noch scharf genug.«
»Wofür? Nein, bitte ... wofür? Das ist nicht nötig, nein«, stammelte sie, ohne recht zu erkennen, was es damit auf sich hatte. Nur eines wusste sie: Schärfe. Schmerzen. Bedyadrur klapperte mit dem Ding herum, es mochte eine Zange sein. Der Wunsch, sich zu erbrechen, drohte Grazia zu überwältigen. Dass die beiden Männer sie an den Oberarmen packten, nahm sie kaum wahr. Aber Bedyadrurs Geruch, als er wieder vor ihr stand, war ihr jetzt schlimmer als zuvor. Sie sah seine schweißfeuchte Hand, die sich mit dem bedrohlichen Ding hob. In den Rillen seiner Finger klebte dunkler Schmutz. Die andere Hand tätschelte ihre Wange und strich sorgfältig Strähnen hinter ihr Ohr zurück.
»Geht ganz schnell. Halt nur still.«
»Nein! O Gott, nein, bitte nicht. Ich bin keine Sklavin!«
»Stillhalten, Mädchen. Gleich bist du eine.«
»Bitte nicht!« Wild warf sie den Kopf hin und her. Aber das konnte einen Sklavenfänger, der diese Tätigkeit sicher im Schlaf beherrschte, kaum beeindrucken. Er kniff seine Finger in ihr Ohr, dass sie glaubte, er wolle es ihr vom Kopf reißen. Sie hielt still. Wie die Zange in Richtung des Ohres verschwand, sah sie nicht mehr, denn Tränen machten alles trüb. Ein wuchtiger Schmerz durchfuhr sie.
»Das war’s doch schon, Mädchen.« Aus dem Beutel, der vor seiner Brust wippte, zog er einen Lumpen, mit dem er an ihrem Ohr herumwischte. Dann holte er einen bronzenen Haken hervor. Der Schmerz loderte wieder hoch, als er ihn einsetzte und mit der Zange festdrückte. Grazias Kopf dröhnte. Sie gab den Kampf gegen die Übelkeit auf und sackte nieder.