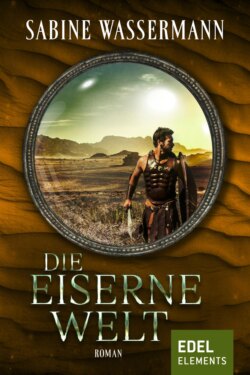Читать книгу Die eiserne Welt - Sabine Wassermann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеDie Nacht brach herein, und die Dorfbewohner verschwanden in ihren Behausungen. Längst war der Wasserbeutel geleert, aber niemand kam, ihn noch einmal zu füllen. Grazia konnte sich nicht darauf besinnen, wann sie das letzte Mal etwas gegessen hatte. Jetzt war ihr wieder übel, aber vor Hunger. Sie hielt die Arme vor dem Bauch verschränkt und sah zu, wie hier und da Lichter entzündet wurden, deren Schein durch Zeltritzen schimmerte. Doch auch diese erloschen bald wieder. Nur das erhöht stehende Zelt war verschwenderisch erhellt.
Grazia drückte sich an die Felswand, um sich an ihr zu wärmen. Anschar hatte die Arme auf die Knie gelegt, darauf den Kopf, und schien zu schlafen. Doch jäh fuhr er auf. Jemand näherte sich ihnen. Ein langes Messer blitzte im Schein des fernen Lichts auf. Die Schnüre, mit denen das Gatter geschlossen war, fielen ab, und es schwang auf.
»Unser Herr will euch sehen«, sagte ein Mann. »Folgt mir.«
Das seltsame, erhöhte Zelt mit seinen Lücken, durch die der Lichtschein fiel, wirkte in der Nacht erst recht, als entstamme es einer Schauergeschichte. Die Fenster, Löcher vielmehr, sahen aus wie die erleuchteten Augenhöhlen eines Totenschädels, und dass die Leute ihnen eine Gasse frei machten, weckte in Grazia den Eindruck, als ginge es aufs Schafott. Ein schwarzer Schemen tauchte an einem der Fenster auf. Grazia unterdrückte ein Aufkeuchen. Aber es war nur eine Frau.
Die Gasse mündete in eine schräg in den Fels gehauene Treppe. Grazia zählte neun unregelmäßige Stufen, als sie hinter Anschar hinaufstieg. In der Zeltwand öffnete sich ein Spalt, und Licht strömte heraus. Mit großen Augen lugte ein Knabe hervor, so klein und nackt wie jener, der am Tage das Wasser gebracht hatte; vielleicht war er es. Schief lächelte er Grazia an und drückte sich an die Seite, damit sie eintreten konnten.
Die Frau wandte sich vom Fenster ab und wich zu einer Wand aus Bastmatten zurück, die den Raum trennten wie Tücher an einer Wäscheleine. Auch diese waren mit Lederstücken, Knochenschnitzwerk und Muscheln verziert und strahlten die Düsterkeit einer steinzeitlichen Völkerschaukulisse aus. Als die Frau jedoch eine der Matten anhob und einladend winkte, fand sich Grazia in einem Raum wieder, der sich an Pracht und Farbigkeit mit jedem Zimmer im Palast des Meya messen konnte. Auch hier hingen überall Matten, doch in kunstvollen Verschlingungen gewebt und geknotet, in Türkisblau und einer ganzen Palette von Gelb- und Grüntönen gefärbt und mit Halbedelsteinen jeglicher Farbe und Beschaffenheit verziert – ein Feuerwerk von Mustern und Farben, von herabhängenden Öllampen entfacht. Einige dieser Pretiosen hätten sogar dem Dresdner Grünen Gewölbe gut zu Gesicht gestanden, dachte Grazia erstaunt. Auch Anschar stockte in seinem Schritt und sah sich um.
»Wenn es nicht stimmt, dass ihr aus Argad seid, lasse ich euch die Haut abziehen und sie als Trockenleine quer durch die Schlucht spannen.«
Ein Mann sprach dies so gelassen aus, als ordne er dergleichen täglich an. Aber kaum hatten sie den Raum betreten und Grazia ihre Kapuze zurückgeschoben, funkelten seine Augen vor Neugier.
»Sieht so eine aus, die in die Wüste gehört?«, fragte Anschar.
»Nein. Tretet näher, setzt euch, aber beschädigt mir hier nichts. Und ihr«, der Herr des Dorfes wedelte mit der Hand. »Ihr verschwindet!«
Seine ungeduldige Geste galt zwei in ein Spiel vertieften Kindern. Sie ließen die rundgeschliffenen Edelsteine fallen und hasteten geduckt zum Ausgang, wo sie sich auf allen vieren niederkauerten. Der Mann erhob sich, präsentierte einen massigen Leib, der im Licht viel zu bleich für jemanden war, der in so einer Gegend hauste, und bückte sich nach den Steinchen, wobei sein Bauch mächtige Ringe bildete und fast zur Hälfte den mit zahllosen Edelsteinen besetzten Wickelrock verdeckte. Auf dem mit ebenso kunstvollen Matten belegten Boden stand eine Schale, voll mit Halbedelsteinen. Dort warf er sie hinein und ließ sich aufstöhnend wieder in seinen Baststuhl sinken, der unter seinem Gewicht ächzte.
»Habt ihr Mehl?«, fragte er.
»Wir haben Mehl, sofern ihr für uns Wasser habt.«
»Du redest, als sei es völlig abwegig, dass ich einfach meine Leute schicke und alles holen lasse, was ich haben will.«
»Es wäre ja auch nicht so einfach, wie du es dir vielleicht vorstellen magst. Meine Sklaven verstehen es, sich zu verteidigen, und genau das habe ich ihnen erlaubt.«
Grazia brach der Schweiß im Nacken aus. Wer sollte denn das glauben? Für jemanden, der eine blutige Nase und Stunden in einem Käfig zugebracht hatte, nahm Anschar den Mund recht voll. Der Mann wirkte gereizt. Aber mit einem Mal entspannte sich seine Miene, und er lächelte. Es war jedoch ein recht kühles Lächeln, dachte Grazia.
»Setzt euch.«
Er wies auf eine Reihe zierlich wirkender Stühle, deren Beine aus getrockneten Echsenleibern bestanden. Grazia schauderte es, aber sie gehorchte. Dicht neben ihr ließ sich Anschar nieder, von dem sie spürte, dass er sich ähnlich unwohl fühlte.
Die Frau kam mit einem hölzernen Krug und drei Bechern. Einen Tisch gab es hier nicht, also kniete sie abwartend vor ihnen, nachdem sie eingeschenkt hatte, und hielt dabei den Krug an die Brust gedrückt. Auffällig war seine Schlichtheit. Vermutlich galt er als sehr wertvoll. Mochte das Felsgestein edel sein – Holz fand man hier keines.
Anschar stürzte das Wasser hinunter; die Frau schenkte ihm sofort nach. Auch den zweiten Becher trank er so hastig, dass es ihm auf die Brust rann. »Mir kommt es immer noch so vor, als sei ich kurz vor dem Verdursten. Es ist eine Wohltat.«
Und das war es. Grazia, die gesitteter trank, dachte im Stillen, dass die Abwesenheit ihrer Gabe jedes Wasser in höchsten Genuss verwandelte.
»Trinkt, so viel ihr wollt.« Der Mann breitete die Arme aus. Das Fett an seinen Armen quoll über edelsteinbesteckte Reife. »Biyu, mir scheint, in meinem Magen läuft ein Nagetier herum und zwickt mich.«
Die Frau stellte den Krug auf den Boden und hastete zwischen den Matten hindurch. Von irgendwoher erklangen die geschäftigen Stimmen von Frauen, Kindern. Rasch kehrte sie mit einer Schale zurück, die wohl aus Bein gefertigt war, kniete neben ihm und hielt sie hoch.
»Vergessen wir, was geschehen ist«, sagte er leutselig. Die Aussicht auf den Happen, der in der Schale auf ihn wartete, schien seine Laune zu bessern. Grazias Magen meldete sich missgestimmt. »Aber ich will Mehl, das vergesst nicht! Ich bin Veynaydro.«
»Mein Name ist Anschar, und die Frau heißt Grazia.«
»Und ihr kommt wahrhaftig aus Argad?« Veynaydro hielt ein längliches Stück Fleisch hoch. Zumindest vermutete Grazia, dass es Fleisch war. Eine schwarze Soße troff herab. Er schüttelte es wie einen Fisch, legte den Kopf in den Nacken und ließ es in Windeseile in der Kehle verschwinden. Drei weitere folgten, dann hielt er Biyu die Soßenfinger hin; sie schleckte sie ab und trug die Schale hinaus. »Neuigkeiten von dort kamen zuletzt vor einigen Jahren. Von Trockenheit war die Rede, aber ansonsten ging alles seinen gewohnten Gang, hieß es. Jedenfalls war sehr lange von keinem Krieg und keinem Umsturz zu hören, wie es in früheren Zeiten üblich war. Wie geht es Mereschayagur?«
»Mereschayagur? Wen meinst du?«
Veynaydros Gesicht rötete sich. »Du weißt nicht, wer Mereschayagur ist?«, bellte er. Sein Kinn wackelte vor Empörung. »Hast du mich doch belogen? Ich werde euch ... nein.« Er berührte seine Schläfen. »Ich vergaß ...«
Sein Kopf sackte zur Seite, sein Körper erschlaffte. Grazia erschrak. Was bedeutete das? Ein Kreislaufzusammenbruch? »Er stirbt!«, flüsterte sie.
»Das sollte nicht ausgerechnet jetzt passieren.« Anschar stand auf und reckte sich nach ihm, da drang ein blubbernder Schnarchton aus Veynaydros Kehle. »Allmächtiger Inar. Er ist mitten in seiner Rede eingeschlafen.«
»Er ist mir nicht geheuer.«
»Ganz und gar nicht.« Auf die Knie gestützt, warf Anschar ihr einen fragenden Blick zu. »Soll ich ihn jetzt wecken?«
Eines der Kinder räusperte sich und schüttelte den Kopf. Da schlug Veynaydro mit einem lauten Grunzen die Augen auf. Anschar zuckte zurück.
»Ihr beide seid ja gar kein Traum.« Er gähnte. Sein Kopf, gänzlich kahl, wirkte wie eine Teigkugel, in die man zwei dicke Rosinen gedrückt hatte. »Wo waren wir stehen geblieben?«
»Bei Mereschayagur«, antwortete Anschar, der wieder saß.
»Oh. Möge seine Seele auf der Insel der Toten ewige Verehrung finden. Wer ist sein Nachfolger?«
»Madyur. Madyur-Meya.«
»Bei Inar«, murmelte Veynaydro sichtlich erstaunt. »Er trägt den Namen des alten Helden Meya? Ist er ein großer König oder nur anmaßend?«
»Du bist anmaßend, wenn du seine Größe anzweifelst«, erwiderte Anschar düster. »Ich verstehe nicht, wie du nichts von ihm wissen kannst. Du hast vor einigen Jahren zuletzt etwas von Argad gehört, sagst du?«
Veynaydro schürzte die vollen Lippen, als überlege er, ob er seinen Gast zurechtweisen solle. »Vor einigen, ja. Es können auch einige mehr gewesen sein. Ich weiß das wirklich nicht mehr genau. Man vergisst so schnell die Zeit, wenn sie so eintönig verläuft wie an diesem Ort. Was hat euch hierher verschlagen?«
»Wir sind auf der Suche nach Temenon.«
»Traumjäger, das seid ihr wohl ...«
»Mag sein.« Anschar ließ den Blick schweifen. »Ist dies hier nicht erst recht ein Traum? Was ist das hier? Eine Stadt, sagten die beiden Sklaven, auf die wir trafen. Wie kann es sein, dass hier Menschen siedeln? Was für Landsleute seid ihr überhaupt? So tief im toten Land muss man ja fast glauben, ihr wäret ein Stamm von Wüstenmenschen?«
Der Herr des Dorfes spuckte fast in seinen Becher. Auf seiner Miene spiegelte sich das gleiche Entsetzen, das Anschar bemächtigt hätte, wäre ihm jemand mit einem solchen Verdacht gekommen. »Was redest du da! Wir halten sie uns als Nutztiere, was sie ja auch sind. Wir stammen aus Argad.«
Grazia war danach, Anschar einen fragenden Seitenblick zuzuwerfen, so verwirrend klang all dies. »Man glaubt in Argad im Allgemeinen nicht, dass ein Mensch die Wüste so weit durchqueren könne«, sagte sie. »Geschweige denn ins tote Land vordringen.«
»Das glauben wir hier auch nicht. Aber hin und wieder gelangen versprengte Sklavenjäger hierher. Die kann man ohnehin kaum noch als Argaden oder Herscheden bezeichnen, denn es sind die Zähesten, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, umherzuziehen und Wüstenmenschen zu fangen. Solche wagen sich weit in die Wüste vor, manchmal zu weit: Sie irren umher, sterben dann, und selten, ganz selten, gelangen welche hierher.«
»Zwei Tagesritte von hier trafen wir auf Sklavenjäger. Sie hatten eure zwei entlaufenen Sklaven eingefangen. Vielleicht wären sie bald auf dein Dorf getroffen.«
»Innerhalb so kurzer Zeit ein weiterer Besuch?« Veynaydro rollte die Augen. »So viel Trubel brauche ich nun auch wieder nicht.«
»Sie werden nicht kommen. Sie sind tot.«
»Ah, seht ihr? Es schaffen wirklich nur wenige. Weit öfter, so vermute ich, fristen solche Kreaturen bei den Wüstennomaden den Rest ihres Daseins, wo sie ebenso wie Nutztiere gehalten werden. Aber dass jemand von Argad in der Absicht aufbricht, die Wüste zu durchqueren, nein, das kann kaum gelingen. Genauso wenig, wie man von hier aus zurückfindet. Also bleibt hier!«
Erneut erhob er sich, langte in die Edelsteinschale und neigte sich Grazia zu. Das Dorf stank, aber er roch süßlich.
»Für dich.« Ein Stein von der Farbe einer Orange und mit roten Einsprengseln versehen fiel auf Grazias Handfläche. Er war so groß wie ein Markstück.
»Danke«, sagte sie höflich. Von all den Dingen, die sie zusammengetragen hatte, war dies gewiss eines der schönsten. Samtig rollte der Stein zwischen ihren Fingern.
»Frau, eine wie dich habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Gesprenkelt wie dieser Blutstein. Es wäre mir eine Freude, wenn du bei uns bliebest. Frisches Blut kann unsere Gemeinschaft gut gebrauchen. Ich werde dafür sorgen, dass du es hier so bequem wie möglich hast. Ihr beide natürlich.«
Frisches Blut? Sie begriff nicht. Anschar legte eine Hand auf ihren Schenkel. »Wir wollen so bald wie möglich wieder aufbrechen. Unser Ziel ist Temenon.«
»Das sagtest du.« Enttäuschung machte sich auf Veynaydros Mondgesicht breit. »Ihr Götter, man weiß ja gerade so eben, dass Temenon existiert! Aber wer bin ich, euch von eurem Vorhaben abzuhalten, so aberwitzig es sein mag?«
»Gewähre uns nur ein Nachtlager. Und lass unsere Sklaven bewirten. Sie lagern oben, einige Wegstunden entfernt.«
»Du hast Recht, es ist spät. Auch ich bin müde. Aber morgen, da erzählt ihr mir alles. Hier gibt es so wenig zu hören. Biyu, hilf mir.«
Die Frau hatte am hinteren Eingang gestanden, nun kam sie zu ihm und schob ihre Schulter unter seine Achsel. Mit einer Hand kraulte er in ihrem Haar, mit der anderen machte er in Richtung des Eingangs ein Zeichen. Einer der Knaben hastete fort; wenige Augenblicke später betrat ein Mann den Raum und empfing die Anweisung, die Sklaven zu holen.
»Ihr könnt ruhig schlafen, ihr habt nichts zu befürchten«, sagte Veynaydro. »Komm, meine Distelblüte, hilf mir ins Bett.«
Seine Fersen schlurften über den Boden, während er mit Biyus Beistand in einen angrenzenden Raum tappte. Dort, Grazia sah es durch den Spalt der schwingenden Matten, ließ er sich auf einen Stuhl sinken, der an Seilen hing. Ein Schaukelstuhl? Nein, zwei kräftige Männer packten die Seile und zogen. Der Stuhl schwebte in die Höhe. Veynaydros Füße pendelten vor und zurück und verschwanden.
»Absonderlicher Kerl«, befand Anschar, der sich ebenfalls vorgeneigt hatte, um Veynaydros eigenartigen Abgang zu beobachten. »Isst uns etwas vor und gibt uns nichts. Aber seinen Worten ist zu trauen, denke ich. Etwas anderes bleibt uns ohnehin nicht übrig.«
Ein Junge räusperte sich. Wortlos wies er in die andere Richtung und lief voraus. Sie durchquerten mehrere solcher von Matten begrenzte Räume, dann blieb er vor einer aus dicken Bastschnüren gefertigten Leiter stehen. Die Decke knarrte, als Anschar sich durch eine Luke hinaufzog. Grazia ergriff seine Hand. Sie gelangten in eine niedrige Kammer.
»Erinnert ein bisschen an Schelgiurs Hütte«, meinte Anschar.
»Mich erinnert’s an deine. So hattest du deine Wände auch bemalt.« Sie wies auf die Felswand, die den Raum begrenzte. Über und über war die hellbraune Oberfläche mit Zeichnungen von Menschen bedeckt: Frauen und Männern, die sich an den Händen hielten und vielleicht einen Tanz aufführten. Der Stil ähnelte dem argadischen. Die Kleider in blassem Blau und Türkis verwiesen auf eine Welt, welche die hiesigen Bewohner nicht kannten.
»So ähnlich.« Er kauerte vor der Wand und bedeckte eine der Frauenfiguren mit der Hand, dann ließ er sich auf den knarrenden Boden sinken.
Von der Decke hingen Schnüre, an denen Muscheln baumelten. Grazia stupste sie an, bis sie alle schwangen. »Wenn man eine Muschel findet, soll man an das verschwundene Meer denken und somit an den Fluch der Trockenheit. Aber hier dienen sie offenbar nicht als ständige Mahnung – wenn man sie einfach so aufhängt. Alles hier ist seltsam. Veynaydro vor allem. Er war sehr unhöflich, uns nichts zu essen anzubieten! Er redet seltsames Zeug, nicht wahr?«
»Sagt dir der Name Mereschayagur etwas, von dem er glaubte, dass er noch regiert?«
»Nein, den habe ich zum ersten Mal gehört. Ich habe es so verstanden, dass Mereschayagur Madyurs Vater war.«
Anschar schüttelte den Kopf. »Er war der Großvater seines Vaters. Seine Regierungszeit liegt mehr als fünfzig Jahre zurück.«
»Wirklich seltsam.« Grazia schmiegte sich an ihn und schob den Stein in ihren Ausschnitt. Sie war viel zu müde, um darüber nachzusinnen.
Als sie erwachte, war es Tag. Das ungewohnte Stimmengewirr des Dorfes drang ins Zelt. Oder war es Anschars Stimme, die sie geweckt hatte, da sie sich über alle anderen erhob? Grazia fuhr auf. Er war nicht bei ihr; stattdessen schrie er dort draußen herum. Furcht packte sie. Welche Gefahr forderte er diesmal heraus? Sie schwang sich über die Luke, tastete nach der wackligen Leiter und mühte sich hinab. Schon am nächsten Fenster, nichts als eine hochgeworfene und an Deckenschnüren befestigte Plane, sah sie die Frau und den Jungen stehen. Sie machten Platz, als Grazia über den federnden Bastboden eilte. Unten, vor dem Käfig, stand Anschar.
»Es sind meine Sklaven!«, herrschte er die umstehenden Dorfbewohner an. »Also lasst sie heraus, oder ich reiße das Ding in Stücke.«
Sie traute ihm zu, dass er sich irgendein Werkzeug suchte und seine Drohung in die Tat umsetzte. Im Käfig standen seine Wüstenmänner dicht gedrängt. Sie umklammerten hilflos das Geflecht, nur Oream hielt die zitternde Ralaod an sich gedrückt.
»Der Herr hat angewiesen, sie herzuschaffen«, sagte einer der Dorfleute. Tunlichst hielt er sich mehrere Schritte von Anschar entfernt, wie alle anderen. Ihr Respekt war groß, offenbar waren die Bogenschützen diesmal nicht in der Nähe. »Das haben wir getan. Wenn er befiehlt, sie freizulassen, dann tun wir auch das.«
Anschar schüttelte sich vor Zorn, so dass seine zerzausten Zöpfe flogen. Er trat dicht an den Käfig, wechselte mit Parrad einige Worte und drehte sich auf der Ferse herum. Dann war er auch schon an der Felsentreppe und stürmte herauf. Grazia freute es, dass ihm das Wohlergehen seiner Gefährten so sehr am Herzen lag, dennoch atmete sie erleichtert auf, als er ins Zwielicht des Zeltes trat, ihren Kopf umfasste und sie küsste. Das genügte, ihn zu beschwichtigen.
»Ich will mit Veynaydro sprechen«, sagte er zu Biyu, die Kehle noch immer rau vor Empörung. Sie beugte sich zu dem Jungen nieder und gab ihm einen Schubs; er hastete in Richtung des Raumes, in dem der Herr des Dorfes gestern gesessen hatte.
»Ja, ja, schick die beiden her«, erschallte da die noch vom Schlaf kratzige Stimme Veynaydros. Grazia fuhr sich mit den Fingern durch das zottelige Haar, während sie Anschar folgte, und band es rasch mit ihrem Tuch im Nacken zusammen, um nicht völlig zerzaust vor dem Herrn des Dorfes zu erscheinen.
»Was ist denn das für eine Unruhe?«, beklagte er sich. Er saß in seinem Sessel wie dorthin gepflanzt. Biyu schob sich an Anschar und Grazia vorbei, holte eine Schüssel und hielt sie vor ihn hin. Er warf nur einen ungeduldigen Blick hinein. Mit einem Tuch, das sie darin nässte, wischte sie ihm sanft den Schweiß des Schlafes aus dem Gesicht.
»Deine Männer haben meine hergebracht«, sagte Anschar. »Aber die Anweisung, sie einzusperren, hatten sie gewiss nicht.«
Veynaydro wirkte ratlos. »Es sind doch nur Sklaven.«
»Sie haben nichts zu trinken bekommen!« Wieder war Anschar laut geworden, und Grazia legte eine Hand auf seine Schulter. Seufzend presste Veynaydro die Hände an die Schläfen.
»Vergiltst du mir meine Gastfreundschaft, indem du mich anschreist? Sie werden Wasser bekommen. Du, erledige das.«
Er nickte einem Mann zu, der in der Nähe stand, und schickte ihn mit erhobener Hand hinaus. »So, ist es jetzt gut? Ein solches Geschrei um Sklaven ist mir ja in den letzten hundert Jahren nicht untergekommen.«
Die Jungen kamen, trugen aus Tierschädeln gefertigte Schalen, in denen Brei dampfte, dazu einen Teller mit dünnen Fladenbroten. Alles stellten sie auf den Boden. Veynaydro entfuhr der Laut tiefsten Genusses, als er sich über den Teller beugte. »Setzt euch und esst, aber vom Brot lasst die Finger, das ist meins.«
Diese Aufforderung galt nicht den Kindern, denn die krochen eilig wieder davon. Anschar schien unsicher, ob er es damit vorerst auf sich beruhen lassen sollte, doch dann setzte er sich. Grazia nahm an seiner Seite Platz. Biyu kniete vor ihrem Herrn, eine Schale in den Händen. Als sich Grazia fragte, worauf hier das Essen serviert wurde, kamen zwei Kinder herbeigekrochen und ließen sich auf Knie und Ellbogen nieder. Zwei andere stellten auf ihren Rücken einige Schalen und Becher ab. Sie taten es nicht mit Widerwillen, sondern mussten sogar ein Kichern unterdrücken, dennoch war es Grazia unangenehm, auf so würdelose Art bedient zu werden.
Schwarze Körner, wie Pfeffer, dazu dunkle Fleischstücke, waren mit Graswurzelbrei vermengt. Anstelle von Löffeln gab es flache Knochensplitter. Grazia neigte sich vor und tauchte einen hinein. Der Junge hielt still. Sie kostete mit spitzen Lippen. Nein, nach Pfeffer schmeckten die Körner nicht. Scharf waren sie dennoch und knirschten unangenehm zwischen den Zähnen. Aber Grazias Hunger war so groß, dass sie nicht einmal Schuhsohlen verschmäht hätte.
»Wie alt bist du?«, fragte Anschar. »Älter als hundert?«
»Hundertneunzig«, erwiderte Veynaydro ungerührt. »Können auch ein paar Jahre mehr sein.«
Grazia fiel der Splitter in die Schale. Sie starrte erst Anschar, dann Veynaydro an. »Du bist ...«
»Ein Nihaye.«
»Donnerlittchen«, murmelte sie, während sie blind nach dem Splitter fischte und sich dabei fast die Finger verbrannte.
»Was sind denn das für seltsame Klänge?« Nun war es Veynaydro, der erstaunt hochschaute. Da hatte sie vor Schreck Deutsch gesprochen, ohne es zu merken. Hastig schleckte sie die heißen Finger ab.
»Ist mir nur so herausgerutscht. Du kannst doch nicht allen Ernstes so alt sein?«
»Das frage ich mich auch manchmal«, seufzte Veynaydro. »Ich bin sicher, anderswo vergehen zwei Jahrhunderte schneller als hier in dieser Einöde.«
Erneut wollte Grazia widersprechen, doch sie verstummte. Die Geschichten, die sie von Anschar gehört hatte, waren ihr in guter Erinnerung. Vor langer Zeit waren die Götter der Dreiheit auf dieser Welt gewandelt – die Götter des Wassers, der Luft und der Erde, die drei Kinder des Götterpaares Inar und Hinarsya. Sie hatten die von ihren Eltern geschaffene Welt geliebt und es genossen, sich ab und zu mit Menschenfrauen zu vereinigen. Und die Kinder dieser Liebesnächte waren Halbgötter: die Nihayen, gesegnet mit der Kraft ihrer Väter, über die Elemente zu gebieten, und verflucht mit einem langen Leben. Doch da vor etwa tausend Jahren das Götterpaar die Dreiheit zu sich befohlen hatte, um die Menschheit zu verlassen und sie einem langsamen Tod durch Dürre zu überantworten, gab es auch keine Halbgötter mehr. Oder jedenfalls nur sehr wenige. Geeryu war eine davon. Und Veynaydro ein anderer.
»Die Schüssel!« Grazia sprang so heftig auf, dass ihre Knie gegen den Jungen stießen, der ins Wanken geriet. Die Schalen glitten herunter, das Essen ergoss sich auf die Matten. »Oh, das tut mir leid! Gott, wie peinlich ...« Sie wollte sich bücken, doch Anschar hielt sie am Arm zurück und bedeutete ihr mit einem Blick, sich wieder zu setzen. Die Kinder machten sich sofort daran, das Malheur zu beseitigen. Nur der Junge, auf dessen Rücken Wasserbecher standen, bewegte sich nicht.
Grazia deutete in eine Ecke des Raumes, wo die Schüssel stand, in die Biyu das Tuch getaucht hatte. »Du hast sie gefüllt, mit der Kraft deines Willens!«
Veynaydro hatte ein Fladenbrot gerollt und an den vor Gier feuchten Mund geführt. Nun hielt er inne. »Ihr seid beide Schreihälse. Und ja, das habe ich getan.«
»Dein Vater ist ... ist ...« Sie schnappte nach Luft. Ob sie von dieser Erkenntnis entsetzt oder erfreut sein sollte, wusste sie nicht. »Er ist der Gott des Wassers, der Gott ohne Namen, der letzte Gott, der in dieser Welt weilt. Deshalb könnt ihr hier überleben. Deshalb schmeckte das Wasser, das wir bekamen, so gut. Du machst für das Dorf Wasser. Ich ... ich ...«
»Beruhige dich.« Anschar drückte erneut ihren Arm, und das keineswegs sanft. Vielleicht wäre es nicht klug, jetzt mit ihrer eigenen verlorenen Fähigkeit herauszuplatzen. Sie schlug die Hand vor den Mund. Wieder konnte sie Veynaydro nur anstarren. Dieser Mann war ein Sohn jenes Gottes, der sie an der Havel geküsst, sie mit seinem Wasser überschwemmt hatte, so dass – wie auch immer – die Gabe auf sie übergegangen war. Die Gabe, die sie so dringend benötigte. Dort saß einer, der besaß, was sie verloren hatte. Und das seit hundertneunzig Jahren.
»Das muss dich nicht erschrecken, Frau. Genieß es lieber.« Er machte eine Geste, und ihr Becher war gefüllt. Sie hob ihn vom Rücken des Jungen und führte ihn an die Lippen.
»Es ist wunderbar«, hauchte sie wehmütig. »Darum bist du wirklich zu beneiden.«
»Warum sind deine Augen nicht silbern?«, fragte Anschar.
Natürlich! Weshalb hatte sie nicht daran gedacht? Geeryus Augen waren wie silberne Ringe um die Pupillen gewesen, Veynaydros hingegen waren von dunklem Braun, wie die fast aller Argaden oder Herscheden.
»Weil sich das mit der Zeit verliert«, erklärte Veynaydro. »Die Augen eines Nihaye sind nach der Geburt besonders hell. Viele der von Göttern geschwängerten Frauen begruben ihre Kinder lebendig, weil sie so entsetzt davon waren. Oder sie setzten sie aus. Götterkinder sind ja nicht gegen gewaltsame Tode gefeit. Sie sind nicht dazu geschaffen, gottgleich zu sein. Je älter sie werden, desto schwächer wird die Augenfarbe. Es heißt, wenn sie ganz schwindet, ist auch der Tod nicht mehr allzu fern.«
Wie sachlich er das alles aussprach ... Er biss in das Brot. Seine wulstigen Lippen verzogen sich vor Widerwillen.
»Das schmeckt nach nichts! Höchstens danach, dass es verbrannt ist.« Er kratzte einige schwarze Stellen herunter. »Zuletzt aß ich vor vielleicht dreißig Jahren Brot. Richtiges Brot, ein Sklavenfänger hatte es bei sich. Ich habe den Geschmack noch genau auf der Zunge.«
»Ralaod kann Brot backen«, warf Anschar finster ein. »Würde sie nicht im Käfig stecken.«
»Also gut!« Veynaydro warf das angebissene Stück auf den Teller. »Es wäre ja eine Schande, euer Mehl für sinnlose Versuche zu verschwenden. Die Wüstenmenschen sollen herausgelassen werden.«
Ein Junge gab die Anweisung weiter. Biyu wirkte unglücklich, als sie den Teller beiseite stellte und stattdessen die Schale mit dem Brei hob. Veynaydros Hände ruhten auf den Lehnen, während sie ihn futterte. Seine Laune besserte sich; offenbar mochte er den Frühstücksbrei, auch wenn er tagein, tagaus das Gleiche aß. Seit hundertneunzig Jahren. Dies erschien Grazia noch immer schwer vorstellbar.
»Warum lebst du hier?«, wagte sie zu fragen. »Warum nicht in Argad? Du hast doch Wasser unbegrenzt zur Verfügung, um die Wüste zu überwinden.«
Veynaydro verschluckte sich fast. »Hier weggehen? Ich höre gern Geschichten von Argad, aber das heißt doch nicht, dass ich deshalb dorthin wollte!« Eilends spülte er seinen Schrecken mit Wasser herunter. Dies schaffte er so selbstverständlich, als halte er es für undenkbar, dass sich seine Gäste darüber erschrecken könnten. »Mag sein, dass es schönere Orte als diesen gibt, aber hier war ich schon immer, hier gehöre ich her. Und allein der Gedanke an die Anstrengung, die es kosten würde, macht mich müde.«
»Aber wie bist du hergekommen? Falls die Frage gestattet ist.« Sie versuchte sich an einem entwaffnenden Lächeln. »Denn Geschichten höre auch ich sehr gern.«
Er lächelte belustigt und schob Biyus Hand mit der Schale beiseite. »Kennst du die Geschichte von dem letzten Gott, der diese Welt nicht im Stich lassen wollte und daraufhin von seinen Eltern gefangen gesetzt wurde? Immer wieder bricht er aus seinem Gefängnis aus, flieht durch die Welten und wird von seinem Bruder, dem Herrn über die Luft, doch wieder eingefangen, denn er ist der schwächste der Dreiheit und muss sich stets der Kraft der Luft unterwerfen.«
»Ja, die kenne ich.« So lange der Fluch der Trockenheit auf der Welt lasten sollte, versuchte das Götterpaar ihren Sohn in seinem Wüstengefängnis festzuhalten. Sein Gesicht war in ihr Gedächtnis eingebrannt. Auf jenem Steg an der Havel war er ihr zuerst begegnet. Dort hatte er sie geküsst. Ihr ein Geschenk gemacht. Geweint. Dann in Mallayurs Garten, in einer Säule aus Luft und nicht weniger verzweifelt. Ein schöner Gott, aber schwach. Es schnitt ihr jetzt noch ins Herz, wenn sie an seinen ängstlichen Blick dachte. Bei ihrer dritten Begegnung, nach dem Feuerinferno in Heria, hatte Erleichterung seine Züge entspannt. »Zuletzt war er wieder frei.«
»Nein, er ist gefangen, denn der Fluss fließt wieder.«
»Bitte? Was meinst du damit?«
»Der Reihe nach, Frau. Willst du nun wissen, wie ich hierherkam?«
»Aber er kann doch nicht schon wieder gefangen sein?«
»Wir wussten, dass er nicht die Kraft hat, lange zu fliehen«, bemerkte Anschar.
Ihr war das alles zu viel, und sie sank seufzend in sich zusammen. Veynaydro warf ihr einen bedauernden Blick zu, während er rasch ein paar Mundvoll Brei schluckte und dann nickte.
»Es war, als der Gott durch die Wüste streifte. Man sagt, er weiß nicht, wo er hin soll, denn nirgends gibt es für ihn eine Zuflucht, doch er versucht ständig zu flüchten, da er die Gefangenschaft nicht erträgt. So zieht er hierhin und dorthin, mal mit seinem Schoßtier, dem Ungeheuer Schamindar, mal allein. Ewige Verzweiflung umgibt ihn. Damals kam er durch diese Gegend und traf auf eine Menschenfrau. Er beschlief sie, und sie gebar mich. Nein«, er wedelte mit dem Finger. »Kommt nicht auf den Gedanken, es sei eine Wüstenfrau gewesen. So einer hätte er sicher nicht seine Gunst geschenkt.«
»Was war sie dann?«, fragte Anschar.
»Weiß ich nicht!«, schnaubte Veynaydro so heftig, dass sich Grazia aufrichtete. »Sie lebte lange genug, mir von dem Gott zu erzählen, aber über ihre Herkunft verlor sie kein Wort. Ich kann mich nur erinnern, dass ich unter Argaden aufwuchs, versprengten Sklavenjägern, die verdurstet wären, hätte ich ihnen nicht Wasser gegeben. Damals existierte diese Stadt noch nicht. Manchmal setzen sich Dornenranken an einem Stein oder einem aufragenden Fels fest und überwuchern ihn, bis er nur noch ein Teil davon ist, wenn auch der entscheidende Teil, der alles zusammenhält. So ist es mit mir und diesem Dorf.«
Grazia fing einen Seitenblick von Anschar ein. Vermutlich dachte er das Gleiche: dass Veynaydros Mutter sehr wohl eine Wüstenfrau gewesen war, eingefangen von jenen Sklavenjägern. Da galt es, nicht zu widersprechen. Trotzdem kam Grazia nicht umhin, Biyu einen Blick zuzuwerfen.
Veynaydro entging es nicht. Er neigte sich vor und hob das Kinn der Frau. »Ja, sie stammt von mir ab. Biyu, wie viele Generationen liegen zwischen uns?«
»Sechs, Herr«, erwiderte sie. Es war das erste Mal, dass Grazia sie sprechen hörte. Was Veynaydros seliges Lächeln wohl bedeuten mochte? Dass er anderes in ihr sah als ihre Ururenkelin? Dass er mit ihr ... etwa ...
»Verzeihung, mir ist schlecht«, presste Grazia hervor, schob sich an dem Jungen vorbei und lief aus dem Raum. Wehende Tücher versperrten ihr den Weg. Sie wischte sie beiseite. Dieses so düstere und doch so prunkvolle Gebäude barg ja wirklich scheußliche Geheimnisse! Aber draußen war es auch nicht angenehmer, also suchte sie die Strickleiter, die hinauf in die Gästekammer führte. Sie fand stattdessen eine aus Ästen gefertigte Stiege, die weiter hinaufführte. Grazia überwand zwei niedrige Stockwerke und fand sich vor einer Öffnung in der Zeltwand wieder, die ihr einen Blick auf die rückwärtige Seite der steinernen Brücke gewährte. Neugierig steckte sie den Kopf zwischen die Bastmatten. Hier wölbten sich die Wände der Schlucht und spendeten Schatten. Unten, in einem Meer von sich wiegendem Felsengras, standen dicht gedrängt Einhornziegen, von einem Verschlag getrennt, in dem echsenartige, mit schwarzen Hornplatten besetzte Tiere kauerten, groß wie Gänse. Sklaven verteilten klein gehäckseltes Futter. Einer saß am Fuß der Felswände und flocht Matten, während ein anderer auf allen vieren kauerte und wimmerte, da er von einem Mann gezüchtigt wurde. Seine Arme und Beine waren rot. Grazia befürchtete schon, es sei sein eigenes Blut, aber dann erkannte sie, dass es Farbe war. Die Frage, woher sie stammen mochte, beantwortete sich sogleich, als ein Mann mit einem Korb auf der Schulter herankam und unter der Brücke verschwand. Rötliche Gesteinsbrocken hatten darin gelegen.
Grazia wollte das Elend nicht länger mit ansehen und sich zurückziehen, als zwei Männer das Gatter öffneten. Eines der seltsamen Tiere trieben sie zu einem schwarzen Felsblock inmitten des Grasfeldes. Plötzlich hatte einer der Männer eine Keule in der Hand. Das Tier quiekte auf. Drei Schläge waren nötig, bis es verstummte. Sie hoben es auf den Block und begannen es auszuweiden. Einem Sklaven wurde befohlen, die Eingeweide zu einem mit Geflecht bespannten Rahmen zu schleppen, der an der Felswand lehnte, und sie darin aufzuhängen. Er beeilte sich, dennoch trieben sie ihn mit Schlägen an. Unwillkürlich musste Grazia an die beiden entflohenen Sklaven denken, die solcher Quälerei den Tod vorgezogen hatten.
Noch immer zuckten die Hinterläufe des Tieres. Erst als die Schlachter die seltsamen Panzerplatten abbrachen, lag es still. In den blutigen Händen drehten sie die Platten hin und her, betasteten sie und nickten. Was immer sie daraus herzustellen gedachten, das Material schien zufriedenstellend zu sein. Der Mann, der den Sklaven antrieb, hob das Herz aus dem Gestell und reckte es in die Höhe. Grazia zuckte zurück, als sie begriff, dass er sie anstarrte. Er rief etwas, das sie nicht verstand, aber es hatte sich beinahe so angehört, als wolle er es ihr zum Geschenk machen.
Grazia schüttelte sich. »Ich will nach Hause«, flüsterte sie in sich hinein. Sie zwang sich, über die Schlachter hinweg in die Ferne zu schauen. Und dort, nur wenige Schritte hinter dem Gräsermeer, entdeckte sie ...
»Bäume! O Gott, da stehen ja Bäume!«
Zwei Hände packten sie an den Fußgelenken und zerrten sie von der Öffnung weg. Entsetzt schrie sie auf. Sie versuchte sich am Bastboden festzuhalten, doch vergebens. Sie fand sich im harten Griff eines Mannes wieder.
»Was kletterst du hier herum?«
Das Entsetzen kehrte zurück. »Finger weg!«, kreischte sie und schlug ihm ins Gesicht. Er hob eine Hand, doch der Hieb blieb aus. Anschar umschloss sein Handgelenk, zwang ihn herum und stieß ihn weg.
»Anschar, dort hinten haben sie junge Bäume stehen!«, sagte sie aufgeregt. »Einen ganzen Wald.«
»Wo sollen denn hier Bäume herkommen?«, fragte er ungläubig. »Die paar Dinge aus Holz – ich dachte, die hätten Männer bei sich gehabt, die sich hierher verirrt hatten.«
Statt einer Antwort zog sie an seinem Handgelenk und zwang ihn, ihr zu folgen. Sie eilte durchs Haus und die Treppe hinab, tauchte unter der Brücke hindurch und hastete ins Grasfeld. Die mit ihrem blutigen Handwerk beschäftigten Männer waren ihr jetzt gleichgültig, auch wenn der Blutgeruch ihr auf den Magen schlug. Die Gräser kratzten über ihre bloßen Waden, denn sie hatte das Wüstengewand gerafft. Es sah ja niemand. Ihr fiel auf, wie anders es war, so schnell zu laufen und dabei kein Korsett zu spüren. Ihre Brüste hüpften, doch es fühlte sich gut an. Schon tauchte sie in das Wäldchen ein. Dicht an dicht standen die Stämme, glatt und hart.
»Das sind keine Bäume«, sagte Anschar hinter ihr. »Es sind Gräser.«
Sie musste ihm recht geben. Allerdings waren die Stängel gewaltig, mehr als drei Meter hoch und dick wie ihr Handgelenk. Büschelige Kronen aus schmalen Blättern, ähnlich Papyrusstauden, berührten sich, so dass sie ein dichtes Dach bildeten. Winzige schwarze Nussfrüchte hingen darin. »Sie duften so schön. Fast so wie Zedern.« Sie schloss die Augen und nahm einen tiefen Atemzug. »Mach das auch! Mach die Augen zu. Dann ist es, als wären wir zurück im Zedernwald, in unserer Hütte. Damals hat es geregnet, weißt du noch? Ach, Regen, der fehlt jetzt noch.«
Sein Blick war milde, und sie kam sich vor wie ein Kind, das mitten in einer Salzwüste um eine Süßigkeit flehte. Lachend drang sie weiter in das Wäldchen vor, versuchte sich nach den Früchten zu strecken und fand schließlich eine auf dem Boden. Auf einer Lichtung stapelten sich mehrere abgeschlagene Stängel, diese waren von bräunlicher Farbe. Grazia betastete die Schnittkante.
»Man könnte das wirklich für Holz halten. Wie kann denn so etwas hier wachsen?« Sie versuchte, die glatte, hartschalige Frucht aufzubeißen.
»Da fragst du noch? Nur die Kraft des Nihaye vermag dies. Und ob die Frucht essbar ist, weißt du nicht.«
Anschar griff danach, aber sie hielt die Frucht mit den Zähnen fest. Er rüttelte daran und neigte sich vor, als wolle er ebenfalls die Zähne zu Hilfe nehmen.
Bau mir hier ein Lager, und ich gebe dir alles, was du willst, dachte sie erregt.
Ein Mann kam schimpfend angelaufen und erinnerte sie daran, wo sie war. Unter den Füßen spürte sie wieder den Sand; der Gräserduft war vom Gestank des Schlachtens überlagert, und die Sonne brannte wie eh und je viel zu heiß hernieder.
»Weg da, weg! Nur ausgesuchte Männer dürfen den Hain betreten, und wenn der Herr hört, dass ihr hier den Sandboden schmutzig macht, ertränkt er euch. Gib das her!« Auffordernd streckte er die Hand aus.
Empört sah Grazia an sich hinab, denn sie war weiß Gott nicht schmutziger als all diese Dorfbewohner. Sie schleuderte ihm die Frucht entgegen. Anschar packte sie am Ellbogen und zog sie mit sich.
»Schauen wir, was Ralaod macht. Ihr Brot wird ihn schon besänftigen.«
Sie fanden Ralaod in einer Höhle, unmittelbar neben dem hohen Zelt. Schräge Säulen aus Sonnenlicht erhellten den Raum, während die schwarzen Schwaden eines geheizten Steinherdes sich bemühten, ihn wieder zu verdunkeln. Ralaod kniete vor einem flachen Stein, auf dem sie Teig knetete. Bei sich hatte sie einige Gewürzsäckchen aus ihrem Vorrat.
»Mach es gut«, sagte Anschar. »Der Herrscher dieses Dorfes muss bei Laune gehalten werden.«
Sie hob nur kurz den Kopf und begrüßte ihn und Grazia mit einem Nicken. Schweiß troff ihr von den Schläfen. »Wer sind diese Leute? Sie haben uns Angst gemacht.«
»Nachkommen eines Mannes, dem sie dienen wie ein Insektenstaat seiner fetten Königin. So sieht er aus, und so verhält er sich.« Er lachte verächtlich auf. »Er hat seinen Rock gehoben und in ein Gefäß gepinkelt, das diese Biyu ihm hinhielt! Und sie hat es fortgetragen wie eine wertvolle Opfergabe an die Götter. Wahrscheinlich tut er nichts, als zu essen, Biyu und wer weiß wen noch zu beschlafen und dem Wachsen seiner Gräser zuzusehen.«
»Anschar, wenn dich jemand hört.« Grazia blickte zum Eingang zurück, aber der Mann, der sie hergeführt hatte, war wieder verschwunden.
Anschar hob nur die Schultern. Es war nicht zu übersehen, dass er dieses Aufenthaltes ebenso überdrüssig war wie sie, obwohl sie erst einen Tag hier waren. Während sich Grazia auf einem Tontopf niederließ, durchmaß er mit verschränkten Armen die Höhle. »Er hat angeboten, uns mit so viel Wasser zu versorgen, wie wir tragen können. Ich kam nicht dazu, ihm zu sagen, dass wir keinesfalls wieder nach Argad zurückwollen, denn dann hast du geschrien.«
Verlegen räusperte sie sich. Die beiden Schlachter kamen und trugen in blutigen Körben das zerlegte Tier zu einer Bodengrube. Mit Bewegungen, die verrieten, dass sie dies oft taten, holten sie glühende Steine aus dem Herd, warfen sie in die Grube und schichteten das mit Grünzeug vermengte Fleisch darüber. Dazwischen kamen weitere erhitzte Steine, und zuletzt deckten sie alles mit steinernen Platten ab. Ein Mann verschwand durch eine senkrechte Felsspalte im hinteren Teil der Höhle und kehrte kurz darauf mit einem prallen Lederbeutel zurück. Über einer Bodenrille wuschen sie sich die Hände und verließen den Raum.
Anschar ging zu der Felsspalte. Sein überraschter Laut ließ Grazia neugierig zu ihm eilen. Vor ihr tat sich eine weitere Höhle auf, um vieles größer. Ein mächtiges Gewölbe – eine Grotte, von Menschenhand geschaffen, wie an den von Meißelspuren übersäten Wänden zu erkennen war. Eine aus dem Fels gehauene Treppe führte zu einem See hinab. Spärliches Licht floss durch einen seitlichen Ausgang auf die glasklare Wasseroberfläche. Ein Sklave stand dort, bis zu den Knien im Wasser, tauchte einen Beutel hinein und schleppte ihn bis zum Rand gefüllt ins Freie.
»Es muss Jahrzehnte gedauert haben, diesen Raum aus dem Fels zu schlagen«, überlegte Anschar. »Wie auch die Brücke.«
»Es duftet«, murmelte Grazia. »Genau wie meins.«
»Es ist eine Zisterne. Sie soll sicherlich verhindern, dass sein Dorf dürsten muss, wenn er krank ist. Oder zu faul, was vermutlich öfter vorkommt.«
Sie stieg die Stufen hinab. Tief sog sie den Duft ein. »Ist das herrlich! Es ist bestimmt wunderbar kühl.« Ehe sie es sich versah, saß sie auf einer der Stufen und schnürte ihre Sandalen auf.
»Dich sollte man festbinden!«, rief Anschar, dass es von den Wänden widerhallte. »Komm her.«
»Ich wollte doch nur die Füße hineinstecken.« Grazia wandte sich um. Er hielt die Hand nach ihr ausgestreckt. Sie ließ sich hochhelfen. Ralaod hatte zugesehen, nun widmete sie sich wieder ihrer Arbeit. Auch für das Brot war eine Felsplatte erhitzt worden, darunter glühte das Geröll. Sie klatschte einen Teigklumpen darauf und strich ihn mit einer jener Hornplatten glatt, die von den echsenartigen Tieren stammten.
»Ich vermisse es so sehr«, sagte Grazia.
Beschwichtigend strich Anschar über ihren Nacken. »Es wird wiederkommen, daran darfst du nicht zweifeln. Ralaod, wie sieht es mit dem Brot aus?«