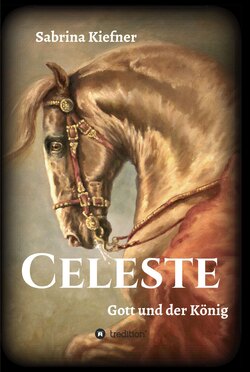Читать книгу Celeste - Gott und der König - Sabrina Kiefner - Страница 13
ОглавлениеVI
An diesem Abend, in der einsamen Stille des Waldrands, machte der Ire einen sehr nervösen Eindruck. Nachdem er ein paar Höflichkeiten von sich gegeben hatte, erwies er sich als äußerst gesprächig. Er berichtete stolz von einem seiner Onkel, dem ehemaligen Oberst des Walsh-Regiments, der im Heer des Königs zu Ehren gekommen war. Mit seiner Hilfe und der eines illustren Verwandten namens Richard Butler war er mit neunzehn Jahren in der Elitetruppe des Grafen von Serrant aufgenommen worden. Ich erfuhr, dass die Offiziere seiner Garnison von den besten, großteils noblen Familien Irlands abstammten. Seine Vorfahren hatten der britischen Krone den Dienst verweigert und die Briten unter den Ordern des Marschalls von Sachsen auf der Schlacht von Fontenoy bekämpft. Die sechshundert Soldaten des in früheren Zeiten genannten Bulkeley-Regiments hatten seit dem Jahre 1753 an allen Kampagnen der französischen Krone teilgenommen. Ich lächelte, ohne meine Ernte zu unterbrechen. Nach einem Augenblick des Schweigens entschuldigte er sich, mich gestört zu haben und hob den Kopf seines grasenden Pferdes an, um ihm die Zügel überzustreifen.
„Sie haben mich nicht im Geringsten gestört“, antwortete ich, „sehen Sie doch, mein Korb ist voll.“
Er grüßte mich und machte sich im Trab auf den Pfad, der am Wald entlangführte.
Ich sah ihm nach. War es möglich, dass er mein Geburtsjahr kannte oder hatte er es aus Zufall erwähnt? Diese und andere Fragen schossen mir durch den Kopf, als ich den mit Grünzeug gefüllten Weidenkorb nach Hause trug. Ich wollte nicht mehr an den Iren denken, der sehr viel jünger war als ich selbst. Doch sein Abbild und seine Worte bevölkerten bereits meine Erinnerungen, so sehr ich mich auch darum bemühte, sie zu verjagen. Meine diversen Beschäftigungen ließen die nächsten Wochen wie im Flug vergehen.
Im Juli brachte ein Bote die traurige Mitteilung vom Tod meines Schwagers, René de Sapinaud. Ich schrieb Jeanne einen langen Beileidsbrief; ich konnte es mir nicht erlauben, ihr einen Besuch abzustatten: Meine Tochter litt an einem Husten, den unser Arzt falsch behandelt hatte. Es stand außer Frage, mit ihr zu verreisen, noch meiner Amme die Pflege meines kranken Kindes zu überlassen, zumal Lacoudre oft müde aussah in letzter Zeit. Ich konsultierte einen Heilkundigen in La-Roche-sur-Yon, der ein Mittel verschrieb, das die Hustenanfälle etwas milderte, aber Aminte war abgemagert und wies fette Speisen zurück. Erst den Mönchen der Fontenelles-Abtei gelang es, meine Tochter mit ihren Heilpflanzen von ihrer Krankheit zu erlösen: Nach einer Woche Behandlung war der Husten endlich abgeklungen.
Ich wollte mich bei Vater Mornac für die wertvollen Ratschläge seiner Anhänger bedanken und fand ihn im Keller vor, wo er seinen Holunderlikör kostete. Das angebotene Gläschen nahm ich ausnahmsweise an – alkoholische Getränke bekamen mir schlecht. Er verkorkte das Behältnis mit einem Holzzapfen, nachdem er einen Krug mit der dickflüssigen, purpurnen Flüssigkeit gefüllt hatte. „Der Likör ist schon seit zwei Jahren unter Verschluss“, klärte er mich auf, „das Fass darf nicht von oben geöffnet werden, sonst würde uns der Troussepinette* binnen kurzem vergären. Das Rezept wird seit dem Mittelalter von unserem Orden gehütet. Wohl bekomms!“
Der dunkle Likör hatte einen delikaten Geschmack nach Waldbeeren, den ich dem Geistlichen gegenüber lobte. Dieser hatte mir einen Hocker zugewiesen und kam ins Plaudern, während er sein Glas nachschenkte. Wenig später lenkte er wie zufällig das Thema auf seinen Neffen und vertraute mir an: „Ich befürchte, dass William im Begriff steht, einen Irrtum zu begehen, den er vielleicht sein Leben lang bereuen wird.“
Trotz der kühlen Kellerluft spürte ich eine Woge der Hitze über meine Wangen gleiten. Der Pater schilderte, dass sein Verwandter, der so wichtige Merkmale wie Mut, Loyalität, Treue und weitere christliche Werte in sich vereinigte, sich zu einer Frau hingezogen fühle, deren Namen er nicht preisgäbe. Und dass er unter seiner Liebe litt, da er davon überzeugt war, die Dame stehe weit außerhalb seiner Reichweite, was sowohl ihren Rang anging, als auch ihre Kultiviertheit. Der Priester legte eine kurze Pause ein, bevor er fortfuhr: „Mein Neffe ist aus diesem Grunde sehr unglücklich und denkt daran, zur Marine zu gehen, in die Fremde. Ich frage mich, ob der junge Mann für das Leben auf See geeignet ist. Ich werde ihm meinen Segen geben, aber ich befürchte, ihn nicht wiederzusehen.“
Er zögerte einen Augenblick, während ich versuchte, mir eine angemessene Antwort zurechtzulegen.
Schließlich erläuterte er: „Meine Schwester hat mir Irland geschrieben. Sie macht sich Sorgen um ihren Sohn und bat mich, meinen Einfluss geltend zu machen, um ihn zur Räson zu bringen. Es ist schon vorgekommen, dass Gemeindemitglieder mich mit dieser Art Konflikt betrauen, doch bei meiner Familie fühle ich mich befangen. So sehr ich William auch schätze: jetzt, wo sein Schicksal in meinen Händen ruht, bin ich ratlos. Was würden Sie an meiner Stelle tun, werte Madame Chappot?“
Ich war so verblüfft über seine Worte, dass ich nichts entgegnen konnte, noch seine Seelennot lindern. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ein Pfarrer mir eine Beichte ablegte! Vater Mornac war für mich ein wertvoller Freund, den ich keinesfalls mit meiner Antwort enttäuschen wollte. Diese konnte nicht ohne Hintergedanken ausfallen..
So blieb ich eine Weile still, während sein Gebräu begann, mir den Geist zu vernebeln. Trotz meiner Zerstreuung gelang es mir, mit fester Stimme zu verkünden: „Das ist eine schwierige Frage, mein Vater. Ich denke, ich würde M. Bulkeley raten, sich zunächst an die betreffende Person zu wenden, um ihr seine Gefühle zu offenbaren. Schließlich kann man nie wissen, wie die Antwort auf eine Frage lautet, die niemals gestellt wurde.“
Der Prior nickte ernst und bot mir ein weiteres Glas an, das ich ablehnte. Ich kaufte ein kleines Fässchen seines Tranks, das er unter dem Sitz des Kabrioletts verstaute und er bedankte sich für meinen Besuch mit einer Güte, die einem Diener des Herrn würdig war.
Noch am Abend sann ich lange nach über dieses Gespräch, nachdem ich Aminte umarmt, nach den Pferden gesehen und die Rosen um den Brunnen gegossen hatte.
* * *
Im August, kurz nach der Ernte, fanden die Viehmärkte statt. Die Stadt Cholet hatte dabei immer im Zentrum meiner Aufmerksamkeit gestanden, aber in diesem Jahr fuhr ich mit meiner Tochter nach La Rochelle und zeigte ihr die Stadt, wie mein Vater mir es damals gewährt hatte. Der Jahrmarkt, auf dem zwei Vertraute meine Jungpferde feilboten, wurde im Hochsommer abgehalten. Wir waren schon früh mit der Postkutsche angereist.
Wir betraten die Stadt durch die „porte royale“, die Königspforte. In dem Gemenge konnte ich den vormals verschlafenen Stadtkern, der sich rund um die Kathedrale in winzige Gassen aufteilt, kaum wiedererkennen. Ich dachte an meinen Vater und hielt Amintes Hand, die sich wegen ihrer geringen Größe darüber beklagte, nichts als Schuhe zu sehen. Ich erklärte, dies sei der wichtigste und beliebteste Markt der Region. Die Hafenstadt bot vielfältige Transportmöglichkeiten über Flüsse und das Meer; die Zufahrtswege waren breit und gut befahrbar, was eine hohe Anzahl Käufer aus der Umgegend anlockte. La Rochelle war durch den Kolonialhandel zu einer wichtigen Stadt geworden, die Hälfte aller Schiffsladungen aus der Neuen Welt trafen in ihrem Hafen ein.
Ein schwacher Seegang begünstigte die Landungen – die vorgelagerten Inseln, vor allem die langgezogene Ile de Ré, schützte den Hafen vor den mächtigen Wellen des Atlantischen Ozeans, ein Umstand, den sich gewisse Verfrachter zunutzen machten und bald schon beträchtliche Reichtümer anhäuften. Die königliche Seilerei des nur wenige Meilen südlich gelegenen Rochefort trug ebenfalls dazu bei. Sie war das längste Industriegebäude der Welt – das Aushängeschild eines Visionärs: des verblichenen Sonnenkönigs. La Rochelle öffnete sich dem Meer, das die Einwohner mit seinen Früchten versorgte. Die ungebändigte Stadt, die sich stolz ihres Widerstands gegen den König und seinen roten Kardinal erinnerte, hatte sich über Jahrhunderte hinweg einen Freihandelsstatus erhalten. Sie bezahlte weder Steuern an den König von Frankreich, noch führte sie irgendwelche Beiträge an die Kontorgemeinschaft der Hanse ab, auf deren Handelsabkommen sie sich berief.
Ihre grausame Belagerung hatte der Freiheit der Geschäftsleute von La Rochelle ein jähes Ende gesetzt. Doch die Konterbanden der Salzsieder machten sich schon bald wieder auf ihre versteckten Pfade durch die Moore, um die Landstraßen des Königs zu umgehen, wie sie dies schon immer getan hatten. Die Stadt begann, eine neue, tiefere Hafenzufahrt auszubauen, und konnte fortan die Windjammern der Admirale empfangen, die kostbare Kolonialwaren bis zu den Landungsstegen lieferten. Und La Rochelle lebte wieder auf. Die Stadtverwaltung verlor nie den Kopf, außer beim alljährlichen, großen Viehmarkt!
In den Gassen herrschte ein buntes Durcheinander, unter den altertümlichen Arkaden drängten sich die Menschen. Die befahrbaren Straßen waren hoffnungslos verstopft, Passagiere schoben sich an stehenden Fuhrwerken vorbei, und ein Lieferant versuchte verzweifelt, seinen Handkarren unter dem Bauch eines schwitzenden Zugpferds hindurch auf die andere Straßenseite zu zerren. Man hatte mich vorgewarnt, was die wirren Bedingungen, die auf diesem Markt herrschten, anging. Zu Tausenden warteten die Tiere, vom Küken bis zum Ackergaul, auf zahlende Kundschaft, die gut beraten war zu wissen, wo genau sie fündig würde. Händler, die Geflügelkäfige schleppten, kamen uns entgegen, andere trugen Wasserkübel oder Hafergarben. Das Hin und Her der Reisenden und der Matrosen im Schatten der antiken Wachtürme am Hafen war ermüdend. Entlang der Landungsstege machten Sklavenhändler ihr schmutziges Geschäft. Wir sahen Bankiers, Hundedressierer und Spekulanten, Hufschmiede und Falkner, Bauern, Pferdehändler, Verkäufer und reiche Damen, deren Wangen unter ihren enormen Hüten mit Rouge geschminkt waren. Ein Mann führte einen Bären an einer Kette. Es gab Magier und Jongleure, Bettler und Gelehrte, Freudenmädchen, Scharlatane und Diebe, kurzum, eine unerträgliche Menschenmenge. Es war heiß und wir hatten Durst.
Als wir an einer Schankbude inmitten dieser Flut von Farben und Gerüchen ankamen, bestellte ich uns Limonade. Überrascht beobachtete ich meine schüchterne, gut erzogene Tochter einen Musikanten anstarren, der soeben auf einem der Podeste erschien. Er trug ein merkwürdiges Musikinstrument, dass einem Kartoffelsack ähnelte, an dem eine Art Flöte angebracht war. Ich war drauf und dran, meine Tochter zurechtzuweisen, anstatt sie mit Limonade zu belohnen, als ich ihn erkannte…William Bulkeley in all seiner Pracht! Mein Erstaunen war auf dem Gipfel angelangt: er stand aufrecht auf der kleinen Bühne und blies in sein bizarres Instrument – einen Dudelsack. Der Ire entlockte ihm eine klagende Weise fremdländischer Harmonien und spielte eine berückende Melodie, die mich ins Träumen brachte.
Ein zweites Lied in schnellerem Takt ließ seine Kameraden auf Fiedeln, Gitarren und Trommeln einstimmen und ihre exotische Melodie klang fremdartig, ganz anders als alle Musik, die ich bisher gehört hatte. Einige Soldaten tanzten mit jungen Mädchen, die im steigenden Tempo des Liedes um sie herumwirbelten, wieder andere rekelten sich trinkend auf den niederen Bänken des Ausschanks. Ich ertappte mich dabei, den keltischen Pfeifer genauso unverhohlen anzustarren, wie es meine kleine Tochter getan hatte. Abrupt drehte ich mich um zum Schanktisch, wo unsere Limonade bereitstand. Aminte bedankte sich für die deliziöse Erfrischung, die sie ungeachtet ihres großen Dursts in kleinen Schlücken trank, wie es sich für Mädchen aus gutem Hause gehörte.
Dann fragte sie mich: „Maman, ist das irische Musik? Wenn ich doch nur tanzen dürfte !“
Auf dem Rückweg dachte ich im Stillen an dieses seltsame Zusammentreffen. Wieder fragte ich mich, ob es sich um eine Zufälligkeit handelte, als meine Tochter sich erkundigte: „Wohnt der Kommandant Bulky in La Rochelle, Maman?“
„Aber nein, Aminte“, gab ich gereizt zurück, „ich habe nicht die geringste Idee, wo dieser Bulkeley wohnt, nebenbei bemerkt ist er erst Unteroffizier. Er ist noch jung und weit vom Rang eines Kommandanten entfernt und…und er wohnt in einer Kaserne.“
„Ach so“, sagte sie.
Es war ihre bevorzugte Antwort seit einigen Wochen, mit der sie die Erwachsenen imitierte, die sich auf diese Weise ausdrückten, ohne darüber nachzudenken.
Die Ile d'Oléron, auf der Bulkeleys Garnison eingesetzt war, lag La Rochelle um Einiges näher als unser Haus. Allerdings hatte ich nie davon gehört, dass Unteroffiziere Ausgang erhielten, um am hellichten Wochentag als Jahrmarktsmusikanten einzuspringen! Diesen ausländischen Armeekorps fehlte es offenbar an Disziplin und Strenge, sagte ich mir. Und doch war Monsieur Bulkeley schön anzusehen, als er seine seltsame Melodie spielte, die mir noch in den Ohren klang. Er hatte die Blicke aller Frauen auf sich gezogen, aber seine Augen hatten auf mir geruht und am Ende des Konzert zwinkerte er Aminte zu, was sie schwer beeindruckte. War es die Vorsehung, die uns immer wieder aufeinander stoßen ließ? Dann schien sie auf seiner Seite zu sein..
* * *
Es war Ende August. Wir ernteten Birnen, um sie für den Winter in Sirup einzulegen und Marmelade einzukochen, als ich einen einsamen Reiter hinter den Feldern des Flachlands erspähte. Wir hatten schon mehrere Kisten und Körbe gefüllt und breiteten eine längliche Wolldecke aus, um uns auszuruhen und unser mitgebrachtes Brot und Käse zu essen. Die Guten Luisen* waren frühzeitig gereift und von goldgelber Farbe. Sie schmeckten zuckersüß, Aminte aß zwei davon zum Ziegenkäse, was mich besonders freute: endlich waren ihre Backen wieder rosig und rund geworden.
„Schau, Maman, da kommt der Ire!“ Mein Kind hatte mich aus meinen Gedanken aufgeschreckt und ich hob den Kopf und erkannte Monsieur Bulkeley. Die gelben Knöpfe seiner Weste blitzten im Sonnenlicht, seine rot-weiße Uniform hob sich vom Gold der Ähren ab. Meine Tochter hatte ihre Angst vor dem Hünen überwunden, dessen Gruß sie in der Vergangenheit nur selten erwidert hatte. Seit uns das Los des Zufalls auf dem Jahrmarkt in La Rochelle miteinander konfrontiert hatte, sprach sie oft von dem Kelten; sie hatte sich sogar sein Land auf dem Globus zeigen lassen.
Doch jetzt traute ich kaum meinen Augen, als das Kind unser sommerliches Picknick abrupt verließ und auf den Reiter zurannte, ohne mich um Erlaubnis gebeten zu haben. Er war sicherlich genauso überrascht wie ich über ihr impulsives Verhalten. Ich sah ihn absteigen und meine Tochter streckte ihre Arme nach ihm aus, als wäre er ein Vertrauter. Er hob sie hoch und setzte sie auf sein riesiges Pferd, das er an der Kandare hielt. So kamen die beiden lachend auf uns zu. Lacoudre hatte sich im Gras ausgestreckt und war im Schatten eines Birnbaums eingeschlafen. Sie hatte das Mädchen nicht wegrennen sehen, sonst wäre sie zweifellos eingeschritten.
Meine Amme hielt sich mit mehr Strenge als ich an die Prinzipien des epochalen Theologen Fenelon. Was mich betraf, so verspürte ich nicht den geringsten Drang, meine Tochter zurückzuhalten, als sie auf den einzigen Mann zustürmte, den ich mir an der Stelle ihres Vaters vorstellen konnte. Dieser Gedanke war mir sogleich unangenehm, aber wie hätte ich etwas anderes als glücklich sein können in diesem Augenblick, als ich in meiner tristen, schwarzen Witwentracht die beiden Menschen miteinander scherzen sah, die mir am meisten bedeuteten.
William Bulkeley begrüßte mich auf seine herzliche Art und Weise, nachdem er seinen Rappen an einen Baumstamm gebunden hatte. Ich gab ihm eine Birne zu kosten und unser Gelächter weckte Lacoudre auf, die sich stammelnd erhob und, peinlich berührt vom plötzlichen Auftauchen des Soldaten, ihre Schürze glattstrich. Dann machte sie sich mit meiner Tochter wieder an die Obsternte und ließ uns allein.
Die Spannung, die sich sogleich zwischen uns aufbaute, ließ meinen Puls schneller schlagen. Der Leutnant musste seine Sätze vorbereitet haben: seine Liebeserklärung klang so elegant und wortgewandt wie das Werk eines Poeten. Er zählte eine ganze Liste Stärken auf, die er in mir sah, bevor er um meine Hand anhielt. Ich sah ihm tief in die Augen und genoss jeden Einzelnen dieser romantischen Momente inmitten der Natur. Ich verlangte keine Bedenkzeit, bevor ich meine Antwort aussprach: sie war positiv. Ich bestand nur auf das Einverständnis meines Bruders und dem seiner Eltern.
* „troussepinette“ ist eine lokale Spezialität. Der Likör wird aus Wildpflanzen zubereitet, insbesondere Weißdorn und Schlehen, denen Holunder, Waldbeeren und Pflanzentinkturen zugefügt werden. Bis zum XIX. Jahrhundert wurde er als „épine“ (Dorne) bezeichnet.
* die Louisenbirne (Louise Bonne d'Avranches) ist eine zu dieser Zeit verbreitete, sehr alte Birnensorte