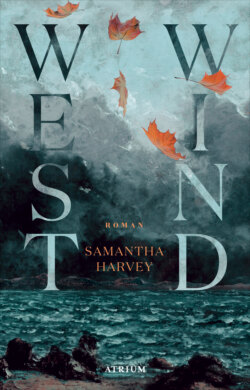Читать книгу Westwind - Samantha Harvey - Страница 7
Kleine dunkle Kiste
ОглавлениеRobert Tunley. Niemand füllte den schmalen Spalt zwischen Trennwand und Vorhang so massig aus, bei keinem entwich der Atem so laut, wenn er sich niederließ. Die Glocke schlug eins. Ich bemühte mich, Klänge von draußen zu hören – vielleicht eine Citole, Trommeln, John Greens durchdringenden Dudelsack, mit dem er Tote zum Leben erwecken konnte, das fröhliche Zwitschern der Fiedel, das an eine betrunkene Singdrossel erinnert, dazu die Geräusche schneller Tanzschritte. Aber außer dem einzelnen halb verwehten Glockenschlag hörte ich nichts.
»Was ist draußen los?«, fragte ich, ehe Tunley mit seiner Beichte beginnen konnte. »Wird schon gefeiert?«
»So eröffnen Sie neuerdings die Beichte, Pater?«
»Ich wusste gar nicht, dass Konventionen dir so wichtig sind.«
»Sie sind der erste Priester, der zugibt, dass er etwas nicht weiß.«
Ich musste lächeln. Tunley lachte, doch mit geschlossenem Mund – was schade war, denn sein Lachen war normalerweise so derb und warm wie eine Pferdedecke. »Um Ihre Frage zu beantworten: Ja, ich denke, es wird gefeiert«, sagte er. »Oben in New Cross. Jedenfalls wird getrunken, und man schreit sinnlos die Spatzen an. Wenn Sie das mit Feiern meinen.«
»Ich weiß nicht, wie man Spatzen sinnvoll anschreien sollte.«
»Dann gibt es heute schon zwei Dinge, die Sie nicht wissen.«
Tunley stieß etwas zwischen einem Gähnen und einem Seufzer aus. Ich wusste, wie er sich hinkniete: mit rundem Rücken, die Hände zwischen den Schenkeln und dem Bauch gefaltet. Die Augen tanzten in seinem fülligen, blassen Gesicht.
»Wirst du auch nach New Cross gehen und feiern?«, fragte ich.
»Nein«, sagte er. »Mein Bein schmerzt. Ich werde zu Hause sitzen und den Herrn verfluchen, weil wir wieder die Fastenzeit durchstehen müssen.«
Er spulte routiniert sein Ave ab. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Schon der Klang trieb mich tief in mein Inneres, an einen Ort, der zugleich dunkel und licht war – mit seiner Stimme hätte Tunley eigentlich für die Kirche arbeiten müssen. Dann, ohne sich auch nur zu räuspern, sagte er: »Sie kennen den Hund von Mary Grant, den schwarzen. Ich habe ihn gestern Abend getötet.«
Selbst das klang melodiös, wie aus einem Lied, und die Wörter kamen aus seinem enormen Bauch. Niemand wusste, wie er es schaffte, so dick zu sein. Beneide den Mann, der im Herbst fett ist, und misstraue dem, der es im Frühling ist – so sagt man bei uns. Tunley jedoch war das ganze Jahr über dick, und er wurde das ganze Jahr über beneidet und misstrauisch beäugt.
»Mary Grants Hund?«, lautete meine unnütze Frage, denn genau das hatte er ja schon gesagt.
»Richtig, Pater, Mary Grants Hund.«
Das war natürlich der Hund, den Carter und ich am Morgen neben dem Weg gesehen hatten. Oder? Wenn ich es recht bedachte, wusste ich nicht, was für einen Hund Mary Grant hatte – oder gehabt hatte. Ich hatte ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Es war überraschend genug, dass ich wusste, wie Mary selbst aussah, so selten, wie sie zur Messe kam. Wahrscheinlich ähnelte sie ihrer Tochter, die ich jeden Tag sehe. Allerdings sieht Janet Grant hübscher aus, so viel weiß ich dann doch.
»Wie hast du ihn getötet?«, fragte ich. Man fängt mit der leichten Frage an, dadurch ist es einfacher, die schwierigere Frage zu stellen: die nach dem Warum, dem Weshalb.
»Etwas Eisenhut in seinem Futter.«
»Eisenhut?« Dann murmelte ich: »Das ist kein schöner Tod.«
»Ich habe noch keine wirklich schöne Todesart gefunden.«
Der arme Hund. Ich stellte mir seine letzten Minuten vor, würgend und mit gekrümmtem Rücken, der Brustkorb, der sich hob und senkte wie die Flügel eines sterbenden Schmetterlings.
»Du weißt, dass der Hund Mary Grants einziger Gefährte war?«
»Jetzt nicht mehr.«
»Sag mir, warum du es getan hast.«
»Er hat gebellt und gejault, und ich konnte nie richtig schlafen.«
»Es liegt in der Natur eines Hundes zu bellen und zu jaulen …«
»Es liegt in der Natur eines Menschen zu schlafen.«
Ich sah zu den Dachsparren hoch, wie immer, wenn ich entmutigt war, und sagte: »Man kann ein Geschöpf nicht dafür töten, dass es tut, was in seiner Natur liegt.«
Der Hund, wie er dalag, die Zunge wie ein vertrocknetes rosafarbenes Blütenblatt aus dem Maul hängend. Mary war eine alte Frau. Ohne Freunde und ohne Gesellschaft, wenn man von ihrer Tochter absah, die mehr aus Pflicht als aus Liebe zu ihr ging.
»Ich will Ihnen sagen, was nicht in der Natur eines Hundes liegt«, entgegnete Tunley lebhaft. »Bei jedem Wetter draußen angebunden zu sein, ohne jede Freiheit, und Tag und Nacht wie eine blutrünstige Bestie jaulen zu müssen, während sein Herr – oder in diesem Fall seine Herrin – auf ihrem knochigen Arsch sitzt und jammert. Während ihr einziger Nachbar – ihr guter Nachbar, der ihr Brennholz bringt und ihr das Feuer anzündet und ihr Dach flickt – angespannt wie ein Dreschflegel ist und im Kopf selbst schon zu jaulen beginnt und fast verrückt wird vor Schlafmangel. Es ist eine Erlösung, dass der Hund jetzt tot ist. Für uns alle. Wenn ich nicht den Hund getötet hätte, dann Mary selbst. Ich bin also nicht gekommen, weil ich um Vergebung bitten will, sondern um Dank.«
»Du musst verrückt sein, wenn du zur Beichte gehst und Dank erwartest.«
»Verrückt bin ich, Pater – das sagen alle Frauen.«
»Und grausam. Du hast eine alte Frau in Verzweiflung gestürzt.«
»Diese dreiste Ziege war sowieso schon verzweifelt.«
Typisch Tunley; für ihn ging es bei der Beichte nicht um Vergebung, sondern darum, der Notwendigkeit von Vergebung zu entkommen. Man sagt es, und dann ist es raus, aus und vorbei. Er ist ein groß gewachsener Mann, und er sagt, dass der Teufel sich gut in ihm verstecken könne. Deshalb bringt er seine Untaten ans Tageslicht, ehe der Teufel sie findet. Aus diesem Grund weiß ich mehr über ihn, als mir lieb ist: von seinen Reisen nach Bourne, um die ganze Nacht mit zwei Frauen Unzucht zu treiben, die er dort beeindruckt zu haben scheint – eine verheiratet und eine verwitwet. Kein anderer Mann im Dorf hat solchen Erfolg bei Frauen wie er. Liegt es an seiner musikalischen Stimme, den Liedern, die er ihnen vorsingt, den langen, innigen Küssen auf den Hals? (Er beschreibt mir diese Küsse so detailliert, dass ich mich fühle, als ob ich selbst von ihm geküsst worden wäre.) Daran, dass er zwischen den Beinen so großzügig ausgestattet ist? (Auch da hat er meiner Vorstellungskraft ausgeholfen.) Ich habe einmal meine Schwester gefragt, ob sie wisse, was Tunley so reizvoll macht, ob es Frauen gefällt, wenn ein Mann das Fett für zwei mit sich herumträgt – ob sich das wie ein besonders günstiges Angebot anfühlt. Sie wusste nichts dazu zu sagen, sie lächelte nur.
»Gift ist besser als ein Messer«, sagte Tunley, als ob er sich jetzt doch verteidigen wollte. »Ich bin nicht gut im Zustechen, und es hätte mir wehgetan, dem Tier dabei in die Augen zu sehen.«
Mir fiel plötzlich ein, dass ich den Hund in seinen ersten Lebensstunden gesehen hatte, ein kleines nasses Ding, das nach Malz roch und die Augen kaum geöffnet hatte. Man hatte es in meine Handflächen gelegt, ein atmendes Bündel Fleisch.
Ich wollte Tunley davon erzählen. »Als Mary Grant den Hund oben auf dem Weg nach Oak Hill fand, brachte sie ihn zu mir. Er war keinen Tag alt und der einzige Überlebende aus seinem Wurf. Sie fragte mich, ob ich ihn segnen und dann ersticken könne. Ich überredete sie, ihn zu behalten – das muss vor sechs oder sieben Jahren gewesen sein.«
»Und seitdem hat er nicht aufgehört mit seinem Geheule.«
»Und jetzt ist damit Schluss.«
»Und dafür danken wir dem Herrn«, sagte er.
Unwillkürlich fragte ich ihn: »Starb er dort, wo er gefressen hat?«
»Sie streunen dann noch ein bisschen herum.« Seine Stimme signalisierte ausgeprägtes Desinteresse und eine Spur Ungeduld, nun, da er gesagt hatte, was er hatte sagen wollen. »Ich habe ihn dort vergiftet, wo er angeleint war, und dann habe ich ihn losgebunden, damit er sich einen Platz zum Sterben suchen konnte.«
»Weißt du, wo das war?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Kann es sein, dass er es bis zum Birkenhain unten am Weg nach West Fields geschafft hat?«
»Kann sein – es dauert ein paar Stunden, ehe man an Eisenhut gestorben ist. Und es musste sieben Jahre Gefangenschaft gutmachen, das arme Tier. Wahrscheinlich waren es die besten Stunden seines Lebens.«
»Unten im Hain liegt jedenfalls ein toter Hund.«
»Dann muss man nicht besonders gut im Kopfrechnen sein, um eins und eins zusammenzuzählen.«
Wenn ich ihm gesagt hätte, dass ich in der vorangegangenen Nacht gesehen hatte, wie etwas oder jemand die Straße hinuntergerannt war, hätte das wenig gebracht. Tunley brauchte davon nichts zu wissen, und es wäre ihm auch gleichgültig gewesen. Aber bis zu diesem Augenblick hatte ich nicht an das schwarze Etwas gedacht, das durch den nächtlichen Nebel an mir vorbeigehetzt war. Ich hatte es mit der Angst zu tun bekommen, hatte es für einen Geist gehalten und war fortgerannt. Dabei war es vielleicht nur Mary Grants Hund mit einer Dosis Eisenhut in den Eingeweiden.
»Sie sind so schweigsam, Pater, sind Sie tot?«
»Wenn es so wäre«, sagte ich, »dann sähe der Tod sehr nach Leben aus.« Er lachte, und ich sagte: »Von deinem Haus draußen am Bach bis zu dem Hain ist es ein weiter Weg.«
»Wem sagen Sie das. Vom Bach aus ist der Weg überallhin weit.«
Ein langer Weg und ein nasser Weg, denn der Bach tritt bei Regen über die Ufer, und die Bewohner der beiden einzigen Häuser auf der anderen Seite, Robert Tunley und Mary Grant, müssen durch das Wasser waten. Tunley macht das trotz seines kaputten Beins, aber Mary Grant bekommen wir oft wochenlang nicht zu Gesicht. Tunley hält sie bestimmt auf Trab, sagen die Leute mit einem Zwinkern, aber allein die Vorstellung seiner üppigen Lippen auf ihren knochigen Rippen lässt die meisten ihre Anspielung sofort bereuen.
»Dann gehe ich mal wieder«, sagte er. »Ich habe heute viel zu tun, Pater, so gern ich mich auch weiter über den Tod eines Hundes unterhalten würde.«
Er sagt dem Priester an Fastnacht, dass er viel zu tun hat. Das Bemerkenswerte an Tunley ist seine grenzenlose Selbstverliebtheit. Ich hatte auch zu tun. Die Absolution ist nichts, was man nebenbei erteilt, bloß weil jemand dahergelaufen kommt. Dazu bedarf es der Genauigkeit. Seine Buße war haarklein nach seinen Absichten zu bemessen – ob er den Hund vor allem umgebracht hat, um sich von seinem eigenen Elend zu befreien, und nur ein wenig, um das Tier von dessen Elend zu befreien – oder umgekehrt. Und ob und wie viel er damit Mary Grant bestrafen wollte, und wenn ja, wie lange diese Absicht sich schon in ihm zusammengebraut hatte. Wie durchdacht, wie boshaft sie war, nach welchen Gesichtspunkten er das Gift gewählt hatte – ob es dabei um den schnell eintretenden Tod oder den dramatischen Effekt ging. All das musste ich ihm entlocken, mit der gleichen Präzision, wie ein Bogenschütze Pfeil und Bogen präpariert. Aber Tunley war schon schnaufend aufgestanden und hatte den Vorhang geöffnet. Er hatte nicht einmal auf die Vergebung gewartet; wieder einmal dachte ich, dass er mich wie einen Abort benutzte – sich setzte, seiner Last entledigte und ging.
»Gestehe Mary Grant deine Tat und entschuldige dich bei ihr«, sagte ich. »Hacke den Rest des Jahres das Holz für sie. Begrabe den Hund und sprich drei Ave-Maria an der Stelle, wo er starb.«
Ich sagte es nur zu meinem eigenen Nutz und Frommen. Tunley war schon fort.
Ich starrte eine daumengroße abgeplatzte Stelle in der Wand vor mir an, die wie das aufgerichtete Geschlechtsteil eines Mannes aussah. Ich hatte einmal daran herumgekratzt, um sie wie den Höcker eines Kamels aussehen zu lassen. Das Kamel verkörpert Besonnenheit, aber ich hatte noch nie eins gesehen, und so war meine Nachbildung nicht besser als die eines Kindes und konnte die obszöne Form nicht verbergen.
Ich musste noch einmal in den Hain. Zumindest, um mich zu vergewissern, dass der Hund fortgetragen und beerdigt und nicht den Falken oder Habichten zum Fraß überlassen worden war. Ich stand auf und trat gegen die Wand, um meine eingeschlafenen Füße zu wecken, aber dann hörte ich Stimmen, irgendeine Aufregung im Kirchenschiff und schlurfende Schritte, die sich mir eilig näherten.
»Reve.«
Ich setzte mich. Herr, sagte ich lautlos. Du hast diesen Menschen erschaffen; hilf mir, mit ihm umzugehen.
Und da war er, auf der anderen Seite des Gitters, unser lauter Flüsterer aus der Ferne, unser fahrender Schwarzmaler, unser durchreisender Kleinigkeitskrämer. Unser kleiner Landdekan, der seine Sheriffpflichten erfüllte, der Streife durch Oakham lief. Ohne Eile nahm ich das Schultertuch vom Kopf und schob die Trennwand beiseite.
»Auf ein Wort, Reve.« Er lächelte, als er das sagte, und deutete eine höfliche Verbeugung an. »Wenn ich Sie nicht störe.«
»Nein, nein«, sagte ich und sah auf die länger werdende Warteschlange im Kirchenschiff. »Ich habe überhaupt nichts zu tun.«
Mein Drang, zu ihm zu eilen und mit ihm zu sprechen, war jetzt, wo er da war, wie weggeblasen. Ganz im Gegenteil: Jetzt wünschte ich, dass ich schon mit ihm fertig wäre, dass ich ihn auf seiner Stute davonreiten sähe, auf Nimmerwiedersehen. Er huschte durch das Mittelschiff zum Nordtor der Kirche. Die Wartenden wandten ihren Blick von mir ab und ihm zu. Ich hoffte, sie wussten, wem meine Treue galt – nicht ihm, der sich hinterhältig in unsere Angelegenheiten einmischte, sondern ihnen, unserer Gemeinde, zu der auch ich zählte. Als wir ins Freie traten, peitschte uns der Wind mit der ganzen Feindseligkeit des Spätwinters, ein letztes Niedersausen seines Schweifs. Aus der Richtung von New Cross wehte Musik herüber, und Rauchwolken stiegen von dem Haus auf, wo Robert Guy, unser mürrischer Vogt, wohnte: tänzerisch verschlungene Rauchwolken, die den Geruch nach Hammelfett und Schinkenspeck mit sich trugen.
Der Dekan ging einige Schritte voraus und war in einen leichten Trab verfallen. Ich hatte noch nie einen erwachsenen Menschen so gehen sehen. Hatte er körperliche Schwierigkeiten, wurde sein Fahrgestell durch irgendetwas beeinträchtigt? Wenn nicht, dann blieb nur die Möglichkeit, dass er Gelassenheit vortäuschen wollte, Ungezwungenheit trotz der unangenehmen Neuigkeiten, die er mir zweifellos unterbreiten wollte. Ich versuchte gar nicht erst, mit ihm Schritt zu halten, ich verlangsamte sogar absichtlich meinen Gang, und schließlich blieb er stehen und wartete.
»Ich habe auf ein Vieraugengespräch gehofft«, sagte er.
»Nur die Kirchenmauern können uns hören.«
Er sah an den frischen, weichen, gelblichen Mauern hoch, als ob er nach einer Bestätigung suchte, die er aber, seinem Stirnrunzeln nach zu urteilen, nicht bekam. »Es waren schwere Tage für Ihre Gemeinde, John«, flüsterte er verschwörerisch. John! Bis eben hatte er mich noch mit »Reve« angeredet – Menschen werden immer dann besonders freundlich, wenn sie etwas von einem wollen und nicht wissen, ob sie es bekommen werden. Sein kleines, scharf geschnittenes Gesicht lebte auf vor lauter Tücke. »Wie läuft die Beichte heute?«
»Ein Heiterkeitsausbruch nach dem anderen«, sagte ich.
»Ich sah einen dieser Stallburschen. Was hatte der zu sagen?«
»Dass er verliebt ist.«
»Ach ja? Wer ist die Glückliche?«
»Das ist kaum von Belang.«
»Liebe ist immer von Belang, wenn es um ungeklärte Todesfälle geht. Liebe ist immer« – er hielt kurz inne – »eine Komplizin.«
Ich schnaubte. Manchmal glaubte ich, wenn ich etwas nur unvermittelt genug tat – ein Geräusch von mir gab, eine Bewegung machte –, dass der Albtraum enden und der Dekan verschwinden könnte.
»Es war Annie, meine Schwester. Der Junge heißt Ralf Drake. Nur eine vorübergehende Schwärmerei.«
Er gab ein kurzes Pff von sich. Was sollte das bedeuten? Ich hätte ihm am liebsten gar nichts erzählt, mit keinem Wort angedeutet, was Ralf mir während der Beichte anvertraut hatte. Aber das war nun nicht mehr zu ändern, wir hatten es so ausgemacht, als ich ihm noch vertraut und geglaubt hatte, er wolle uns wirklich helfen.
Der Dekan war in einen qualvoll langsamen Schlenderschritt verfallen und sah mich mit einem intensiven, hilfesuchenden Ausdruck an. Er ergriff mein Handgelenk. »Ein Wort der Warnung«, sagte er. »Sie wissen, dass die, die wirklich etwas zu verbergen haben, Ihnen wunderschöne Lügengeschichten auftischen werden. Deswegen müssen Sie klug und gewieft vorgehen und heraushören, was sie Ihnen verschweigen.« Er neigte sein Haupt, und es war, als ob selbst die Luft schrill vor ihm zurückschreckte. »Und – hat Oliver Townshend schon gebeichtet?«
Er hielt mein Handgelenk, so wie ich vorhin den Hartriegel in der Hand gehalten hatte – ohne wirklich zu wissen, was er damit sollte, aber doch in dem Versuch, die Geste jetzt, wo er es schon einmal hielt, bedeutungsvoll aussehen zu lassen. Ich antwortete: »Nein, Townshend habe ich nicht gesehen.«
»Ist denn irgendetwas Mörderisches ans Licht gekommen?«
Ich löste mein Handgelenk aus seinem Griff und ging weiter. »Robert Tunley hat einen Hund getötet.«
»Oh.« Er streckte die Hände aus. »Hat er sich auf ihn gesetzt?« Ein seltener Anflug von Humor bei unserem Dekan.
»Er hat ihn vergiftet.«
Das Wort »Gift« hob erkennbar seine Stimmung – ein kurzes Verlangsamen des Schrittes, ein kleines triumphierendes Lächeln in den Mundwinkeln. »Womit hat er ihn vergiftet?«
»Eisenhut.«
»Eisenhut? Verstehe. Eisenhut also. Aber da muss ich doch fragen: Woher hat er ihn?« Er bewunderte seine Frage, als wäre sie eine Goldmünze, die er zutage gefördert hatte. »Eisenhut wächst in den letzten Sommertagen, wir haben Februar.«
»Er blüht in den letzten Sommertagen. Ich denke, seine Wurzeln wachsen das ganze Jahr über.«
Der Dekan fragte mit verkniffenem Gesicht: »Woher wusste er, wo er ihn finden konnte?«
»Er wächst einige Felder weit entfernt von dem Bach, an dem Tunley und Mary Grant leben. Unten am Fuß des Bergkamms, da ist es feucht und schattig. Jeder im Dorf weiß das. Wir haben viele Schafe verloren, als wir sie dort noch weiden ließen.«
Ich war verärgert und machte mir nicht die Mühe, es zu verbergen. Was wusste er schon über unser Dorf? Er stellte die falschen Fragen. Es war kein Geheimnis, wie man einen Hund mit Eisenhut zu jeder beliebigen Jahreszeit töten konnte, ein Wurzelstück, groß wie der Fingernagel eines Kindes, bringt selbst einen ausgewachsenen Mann um. Man musste bloß ein Fitzelchen Wurzel abschneiden und es, als würde man einen Samen säen, in die Pampe aus Innereien fallen lassen, die der Hund zu fressen bekam. Seine Fragen waren anzüglich wie der Klatsch eines alten Weibes; ihm war nicht einmal in den Sinn gekommen zu fragen, wem der Hund gehörte oder warum Tunley ihn umbringen wollte. Er hatte bloß das Wort »Gift« gehört, und die Schlange in ihm hatte sich aufgerichtet.
»Wir wissen also, dass Tunley zum Zeitpunkt von Thomas Newmans Tod über Gift verfügte«, sagte er, und ich erwiderte: »Wir alle können über Gift verfügen, wann immer wir wollen. Es wächst überall.«
Eisenhut, Bilsenkraut, Belladonna, Nieswurz, ganz zu schweigen von den Pilzen, deren warzige Hüte und perlweiße Milch einen erst berauschen und dann töten können. Jeder, der hier aufgewachsen ist und Land bewirtschaftet hat, jeder, der auch nur eine Erdkrume unter den Fingernägeln gehabt hat, weiß, dass es um uns herum viele trügerische Dinge gibt, die töten können und mit denen man töten kann. Jeder – ob Mann, Frau oder Kind. Das gehört bei uns zum gesunden Menschenverstand, etwas, das dem Dekan völlig abging.
Widerwillig sah er ein, dass das Thema sich erschöpft hatte, und sagte: »Ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas über den Mord an einem Menschen berichten, nicht an einem Hund.« Und er verstummte.
Es hätte durchaus Gründe gegeben, Tunley zu verdächtigen, immerhin war er es gewesen, der am Samstagmorgen als Erster berichtet hate, einen Toten im Fluss gesehen zu haben, und er war den ganzen Freitagabend fort gewesen, ohne dass jemand hätte sagen können, was er getan hatte. Aber Tunley war ein Mann, der über solche Vorwürfe erhaben war; ich fand es bemerkenswert, dass selbst der Dekan das erkannt hatte. Ein so freimütiger und argloser Mensch, dass ihn kein Verdacht treffen konnte. Oder auch ein so streitlustiger Mensch, dass man ihn lieber nicht beschuldigte.
Während wir die Kirche umrundeten, stand mein ruheloser Schritt in ständigem Widerstreit mit dem nervösen Schlurfen des Dekans. Ich spürte immer noch den inneren Drang, nach dem toten Hund zu sehen, er strömte förmlich durch meine Beine und Arme. Wieder einmal fiel mir auf, wie unsympathisch das Gesicht meines Begleiters wirkte. Ich hatte versucht, es zu mögen, aber mit seiner gräulichen Farbe, ausgezehrt und mit verdrießlich herabgezogenen Mundwinkeln widerstand es all meinen Bemühungen.
»Wussten Sie«, fragte er, »dass letztes Jahr an Fastnachtsdienstag in Italien ein Mann gestorben ist, weil er bei einem sogenannten ›Karneval‹ mit Orangen beworfen wurde? Man hat ihn auf der Straße überrannt und totgetrampelt, und als die Feiernden sich nachts zerstreuten, kamen die Wölfe, angelockt von der Süße der Orangen, und rissen seine Leiche in Stücke. Nur seine Augen blieben auf dem Pflaster zurück.«
Der Wind schlug uns entgegen, als wir um die Ecke zur Ostseite der Kirche bogen. »Mögen Wölfe keine Augen?«
Er sah mich an, dann reckte er sein Kinn in die Höhe, um seine unsinnige Geschichte besser fortsetzen zu können. »Und was die Franzosen an Mardi Gras tun – da wendet selbst Gott sich schaudernd ab.« Passend zu diesem Stichwort wandte er sich ab, eine kleine, dramatische Geste. »Es ist wichtig«, sagte er, »dass wir uns hier, in unserem gemäßigteren Land, an unsere eigenen Gebräuche und die ernste Frömmigkeit erinnern, die bei diesem Ereignis angebracht sind. Natürlich dürfen wir uns vergnügen. Aber wir dürfen uns nicht wie sittenlose Wilde aufführen.«
Wusste der Dekan überhaupt, was Sittenlosigkeit war? Sittenlosigkeit ist, wenn man am Todestag eines Mannes in dessen Haus einzieht, sich mit seiner Seife wäscht, sich mit seiner Klinge rasiert und es sich auf seiner Daunenmatratze bequem macht.
»Als ich im Dorf war, fiel mir auf, dass die Feierlichkeiten in New Cross schon recht ausgelassen sind. Viele Betrunkene. Zu viel vom Muntermacher, was? So nennt man das hier doch, nicht wahr? Engelstrank, Drachenmilch. Und wir haben gerade erst Mittag.« Schnellpisser, dachte ich; so nennt man das bei uns, aber das geht dich gar nichts an. Er sah zu mir hoch, sein Gesichtsausdruck sollte wohl Sympathie und Komplizenschaft signalisieren. »Ja, John, es waren schwierige Tage für Ihre Gemeinde, aber das entschuldigt kein Fehlverhalten.«
Er hatte keine Frage gestellt, also schwieg ich.
»Ich verlasse mich darauf, dass Ihre Gemeinde sich nicht wie die Italiener aufführt, von denen ich sprach. Oder, schlimmer noch, wie die Franzosen.«
Wir hatten das Südtor erreicht, und ich blieb davor stehen. »Ich denke, das wird uns erspart bleiben, die meisten hier haben noch nie eine Orange gesehen«, sagte ich.
Ich umfasste seine Hände und drückte sie sanft, dann ließ ich sie los. Er betrachtete mich beunruhigt: Ich hatte offenbar nicht getan oder gesagt, was ich seiner Meinung nach hätte tun oder sagen sollen. Dann umfasste er mein Gesicht mit den Händen, je eine Hand umschloss liebevoll eine Wange, und sagte: »Jetzt sieh sich einer diese breiten Wangenknochen an, diese erhabene Nase, diese Augen, graubraun wie ein Folterkäfig, rauchig wie ein Scheiterhaufen. Ich würde sagen, in Ihnen steckt auch etwas von einem Franzosen. Darauf müssen wir achtgeben.«
Sein Blick kündete von zaghafter Boshaftigkeit: der Blick eines Menschen, dem die Bösartigkeit der Macht neu ist und der sich ihrer noch nicht mit Gewissheit bedient. Ich blieb stumm, und er presste seine Daumen in die hohlen Stellen hinter meinem Kiefer. Fast an meinem Hals, aber nicht ganz. Weiche Stellen, die selbst ich nie mit den Daumen erspürt hatte. Es war eine Geste von halbherziger Brutalität, und dann sanken seine Arme herab.
»Ich vermute, ich neige zu sehr zum Grübeln, Reve«, sagte er und massierte die Stelle zwischen seinen Augen, wie um die Last all dieser Grübelei zu veranschaulichen. »Einige meiner Überlegungen kann man übergehen, andere nicht, und bei wieder anderen bin ich mir nicht sicher. Wenn zum Beispiel Newmans Leiche drei Tage nach seinem Ertrinken bei West Fields an einem umgestürzten Baum gefunden wird und sein Hemd ein Stück weiter in einem Röhricht, warum ist das Hemd weiter getrieben als der Mann? Wie hat das Hemd sich überhaupt von ihm gelöst? Erreichte es die Stelle zur selben Zeit wie die Leiche, war es mit dem Körper verbunden? Oder ist es einen Tag, zwei Tage, drei Tage vorher dort angekommen? In diesem Fall wäre es ein seltsamer Zufall, dass beide nur einen Steinwurf voneinander entfernt angespült wurden. Obwohl solche Zufälle natürlich vorkommen.«
Er bewegte sich von mir fort, die Hände hielt er dabei hinter dem Rücken verschränkt, sie schlugen sanft gegen sein Hinterteil in der engen Robe. Er hatte den Dolch seines Argwohns gezückt und wieder in die Scheide zurückgesteckt.
»Newman hat Townshends Land aufgekauft, nicht wahr?«, fragte er und drehte sich wieder zu mir um.
»Wenn ich mich recht erinnere, haben wir darüber schon mehrmals gesprochen, und die Antwort ist Ihnen bekannt.«
»Ich weiß, ich weiß. Ich strapaziere Ihre Geduld. Aber je öfter wir darüber sprechen, desto weniger geht es mir aus dem Kopf. Newman hat … wie viel? … zwei Drittel von Townshends Land gekauft? Newman wurde reicher, Townshend wurde ärmer. Townshend hatte allen Grund, ihm den Tod zu wünschen.«
Er zuckte die Schultern und sah einen Moment beiseite, dann drehte er sich um und schlurfte, in seine zu enge Robe eingewickelt, davon, wobei er mit wedelnden Armen wütend eine Krähe verscheuchte, die ihm nicht einmal im Weg war.
Der Dekan ist ein Mensch, dessen Schuhe zu klein geworden sind und den deshalb die Füße zwacken. Wir haben zurzeit keinen Bischof, der Erzdiakon ist mit anderen Dingen beschäftigt, und so steht er verblüffenderweise an der Spitze des Haufens.
Vor allem haben die Mönche des Klosters in Bruton ihre gierigen Blicke auf Oakham geworfen. Der Dekan hat mich gewarnt, und er ist besorgt. Je mehr es werden, desto mehr Land brauchen sie. Also halten sie Ausschau, aber alles, was sie zu sehen bekommen, sind Schafweiden und kein Ackerland weit und breit. Dann verharrt ihr Blick bei uns, mit Tausenden schafloser, urbarer Furlongs (mehr als jeder andere Ort im Umkreis von hundert Meilen), und sie sehen, dass unsere Gemeinde an ihre grenzt und sie ein gutes Auskommen hätten, wenn sie uns übernähmen und Oakham zu ihrem Gehöft machten.
Hinzu kommt, dass der Bischof im Gefängnis sitzt, weil er versucht hat, einem Prätendenten zur Krone zu verhelfen. Der Dekan meint, dass er es nicht mehr lange machen wird. Der Erzdiakon ist vollauf mit seinen Sorgen beschäftigt und mit all der Arbeit, die der Bischof verrichten würde, wenn er nicht im Gefängnis säße. Wer gibt in diesem Chaos auf uns acht, die wir hier in unserer kleinen Gemeinde zwischen Wald und Fluss leben, mit unserer unbedeutenden Kirche, unseren hundert kleinen Leben und ihren Freuden und Tücken, mit unseren Schweinen, Kühen, Hühnern, unserer Gerste und unserem Holz? Unserer unvollendeten Brücke? Wer hält uns die Mönche vom Hals und die sprichwörtlichen Wölfe? Die Antwort lautet: niemand – niemand außer dem Dekan. Und wie viel Anteil nimmt der? Er muss erst einmal seine eigene Haut retten. Er rennt herum, um dem Erzdiakon Gefälligkeiten zu erweisen, weil er sich davon … ja, was erhofft er sich eigentlich davon? Gunst? Macht? Er verzehrt sich danach, dem Erzdiakon einen Mörder vor die Füße zu legen, wie eine Katze – zitternd vor Stolz – ihrem Herrn einen Vogel bringt.
Zwei Jahre zuvor hatte ich eine Unterhaltung mit Newman. Er erzählte mir damals, dass man in Rom große Kästen eigens zum Beichten baut – Beichtstühle. Man kniet nicht im Dämmerlicht des Kirchenschiffs vor dem Priester nieder, sondern betritt einen zweigeteilten Schrank, mit dem Beichtkind auf der einen und dem Priester auf der anderen Seite. Eine kleine dunkle Kiste. Diese Vorstellung hatte für mich etwas Schönes und Geheimnisvolles. Die Kiste erschien mir wie eine Miniaturkirche, eine Kirche in der Kirche – die Seite des Priesters war der Altarraum, die des Beichtkindes das Kirchenschiff, und die Abschirmung dazwischen trennte die beiden weniger voneinander, als dass sie sie vereinte und miteinander ins Gespräch brachte. Der normale Mensch, durch die Trennwand geschützt, berichtet dem Priester von den Dingen, die er auf der Seele hat, auf dass der Priester sie Gott berichte und ihn dem Himmel näher bringe. Die Trennwand ist kein Hindernis, sondern eine Fläche, auf der sich das heilige Mysterium abspielt.
Eigentlich hätte für uns keine Hoffnung auf eine solche Kiste bestanden. Wäre unser Bischof nicht für den Versuch bestraft worden, die Thronfolge zu ändern, wäre unser Erzdiakon nicht so überaus beschäftigt gewesen, wäre unser Dekan nicht verantwortlich gewesen oder hätte er eine andere Persönlichkeit gehabt – nein, dann gäbe es diese Kiste nicht. Als er, der Dekan, uns vor über einem Jahr zu Winterbeginn besuchte, versuchte ich ihm die Idee schmackhaft zu machen. Die Kirche in der Kirche, die Abschirmung, die nicht trennt, sondern vereint, das Spiel des heiligen Mysteriums et cetera. Er war bestenfalls desinteressiert, schlimmstenfalls wütend. Er murmelte etwas über Italiener und hing wie eine dunkle Regenwolke über meinen Hoffnungen.
Aber der Winter schritt voran. Winter können grausam und gewalttätig sein. Wir haben in jenem Winter viel verloren – Saat an die Flut, Tiere an den Schnee, Männer, Frauen und Kinder an Krankheit und Hunger. Ich tat mein Bestes, so wie alle anderen auch, aber wenn die Zeiten verzweifelt sind, handeln auch die Menschen verzweifelt: Sie stehlen, sie lügen, sie betrügen, sie resignieren, sie gehen nicht zur Messe, sie suchen Zuflucht in fremden Betten.
Wenn die Zeiten verzweifelt sind, begehen Menschen Taten der Verzweiflung, von denen sie ihrem Priester, der auch ihr Nachbar ist, lieber nichts sagen. Vielleicht ist es ja das Brot des Priesters, das sie stehlen. Vielleicht ist es die Frau eines Freundes des Priesters, mit der sie ins Bett gehen. Vielleicht ist es sogar die Schwester des Priesters. Damals kam nur das halbe Dorf in den Tagen vor der Fastenzeit zur Beichte. Ich sagte es ihnen täglich in der Messe: Ihr müsst beichten, ihr könnt die Hostie nicht ohne Beichte nehmen. Sie kamen trotzdem nicht. Dann bemerkte ich ein großes Kommen und Gehen bei Four Ways, wo die Straße sich in vier Richtungen gabelt – nach Oak Hill, Bourne, Bruton und Fox Hole –, und als ich jemandem folgte (ganz beiläufig, als ob ich einen Spaziergang machen würde), bestätigte sich mein Verdacht: dass meine Pfarrbewohner sich eine Meile vor dem Dorf mit einem Wandermönch trafen, der ihnen am Straßenrand, mit tief über den Kopf gezogener Kapuze, die Beichte abnahm. Er konnte sie sehen, aber er kannte sie nicht, und sie mussten ihm nicht in die Augen schauen, nicht einmal wenn sie die Münzen in seinen Geldbeutel steckten.
Ich berichtete davon dem Dekan: dass das Geld, das für Zehntabgaben und Spenden im Dorf verbleiben sollte, in den Geldbeutel eines Mönchs wanderte, damit die Beichte unerkannt abgelegt werden konnte. Wir sind ein kleines Dorf mit einem Fluss, der genauso gut eine Mauer sein könnte, denn er hält die Außenwelt von uns fern. Wir wären ruiniert, wenn dieses Bezahlen von Wandermönchen zur Gewohnheit würde – das sagte ich ihm, und es war die Wahrheit. Geld ist ein Konzept, das der Dekan versteht, nicht weil er durchtrieben oder besonders opportunistisch wäre, sondern weil er, je mehr Zeit vergeht, desto verzweifelter wird. Die Gemeinden, die ihm unterstellt sind, litten in jenem Winter, und wem waren diese Leiden zuzuschreiben, wenn nicht – wenigstens zum Teil – ihm? Wenn sich nicht genug Menschen um Land und Vieh kümmern, wenn die Hälfte der Tiere stirbt, dann hungert das Dorf, und wenn das Dorf hungert, dann richten die Leute den Blick auf mich, und ich richte den Blick auf den Dekan, und er richtet den Blick auf den Erzdiakon und dieser auf den Bischof, nur um festzustellen, dass da keiner ist. Und die Menschen verlieren ihren Glauben, weil ihre Beschützer sie nicht beschützt haben, und Gott verliert seinen Glauben an die Beschützer, die er berufen hat, damit sie den Glauben an ihn in den Herzen der Menschen wachhalten. Und sobald der Herr dir nicht mehr vertraut, bist du wie ein einbeiniger Schwimmer, der gegen die Strömung schwimmt.
Da waren wir also – zwei Männer, die wenig füreinander übrighatten und von denen einer das Glück hatte, zufällig auf den absonderlichsten Hass des anderen gestoßen zu sein: Für den Dekan waren Wandermönche allenfalls Händler oder Trödler, mit genauso wenig geistlicher Befugnis. Oder sie waren Diebe und Strolche. Es habe da einen gegeben, sagte er, der halb Mensch, halb Tier gewesen sei und den Körper eines Bären gehabt habe. Wir setzten uns ans Feuer, ich tischte dem Dekan ein Ale und Lammbraten auf – es war kurz nach Ostern – und hörte mir seine Ansichten an. Als ich seiner seltsam leidenschaftslosen Hasstirade lauschte, fühlte es sich an, als ob mir kaltes Wasser auf die Füße tropfen würde. Danach schüttelten wir uns halbherzig die Hände und machten unsere Zugeständnisse – er stimmte zu, dass wir eine Zeit lang einen Beichtstuhl erprobten, und ich, dass ich diesen ohne zusätzliche Kosten beschaffen würde.
Im letzten Winter wurde die breite Eichentür am Nordeingang gegen eine neue ausgetauscht; wir lehnten die alte Tür an die Südwestecke der Kirche und bildeten damit einen dreieckigen Raum, in dem ich sitzen konnte. Philip, der drüben in Old Cross lebt, sägte ein Loch hinein, und seine Frau Avvy flocht ein ganz ordentliches Gitter aus Haselholz, durch das man seine Sünden beichten kann. Ein Vorhang auf der anderen Seite schirmt das Beichtkind ab, das zwischen Vorhang und Tür kniet. Die ganze Vorrichtung ist unausgereift und eigentlich kindisch. Ich weiß nicht, was ein Italiener davon halten würde. Für ihn würde es wohl eher wie der Bau eines Tieres aussehen oder wie ein Ort, an dem Darm und Blase ihr Werk tun – nicht wie ein Ort, an dem Gott sein Werk tut.
Oakham, das kleine und unbedeutende Oakham, das eingezwängt zwischen Fluss und Bergkamm liegt, verfügt über den einzigen Beichtstuhl Englands – zumindest soweit wir wissen. Vielleicht existieren andere Oakhams. Wir haben nie von ihnen gehört. Jeder Bischof in diesem Land würde anordnen, das Ding herauszureißen – jeder Bischof außer dem einen, der im Gefängnis sitzt und seit Jahren nicht mehr an etwas anderes als sich selbst gedacht hat und daran, wie er seine Haut retten kann.
Es kann von Vorteil sein, wenn einen die Welt vergessen hat. Der Beichtstuhl führte dazu, dass wir uns als Gemeinde nach innen gewandt haben, zu uns selbst – wie Primeln, die in dichten Büscheln beieinanderstehen. Die Kirche platzt vor Spenden aus allen Nähten: zwei neue Abendmahlkelche zusätzlich zu den beiden, die wir vorher schon hatten; drei neue Garnituren Messgewänder und Soutanen; ein neues Vortragekreuz; ein dunkelpurpurner Fastenschleier; ein Weihwassertopf; vier große vielarmige Kerzenleuchter und ungezählte der schlichteren Sorte, Weihrauch, eine schöne geschnitzte Holzabdeckung für den Taufstein; bestickte Banner; ein zusätzlicher Rosenkranz für das Kirchenportal; ein Kissen zum Niederknien im Beichtstuhl; eine Laterne; Gemälde von der heiligen Katharina, dem heiligen Erasmus und der heiligen Barbara (um den Tod abzuwehren); ein ungelenk bebilderter Psalter und jedes erdenkliche Marienbild oder Gebet an die Heilige Jungfrau: eine Kopie des Obsecro te, des schönsten Mariengebets, das es gibt, und von dem Lied »Ich künde von einer Magd«; außerdem ein Kupferstich der Mutter der Barmherzigkeit, ein Holzstich der Mutter der Barmherzigkeit, ein laienhaftes Wandbild der Mutter der Barmherzigkeit, ein Elfenbeinfigürchen der Mutter der Barmherzigkeit; wir haben ein Vesperbild, auf dem die Augen der Gottesmutter verschleiert sind und tieftraurig dreinschauen und der Christus auf ihrem Schoß bereits totenstarr ist. Dann haben wir noch das seltsame und fragwürdige Vesperbild über Newmans Altar, bei dem die Augen der Jungfrau fragend auf uns gerichtet sind und der verwundete Christus mit schockierend gespreizten Beinen daliegt, zart wie frisches Fleisch. Das Gemälde glüht förmlich von Farben, wie sie nur die Italiener herzustellen wissen. Und dort am Triumphbogen hängt eine Schnitzerei der Mater Dolorosa, die sie in erschütternder Trauer am Fuß des Kreuzes zeigt. Und für jedes gestiftete Bild oder Gebet besitzen wir genug Kerzen, um die Muttergottes für Monate oder sogar Jahre zu beleuchten.
Der Dekan war immer skeptisch; er meint, dass ein Beichtstuhl die Leute nicht davon abhalten werde, zu einem schurkenhaften reisenden Ordensbruder zurückzukehren. Denn ich wisse ja bei den meisten Pfarrbewohnern trotz der Trennwand, wer sie sind, und die meisten wüssten das, und ich wiederum wisse, dass sie das wüssten. Was für eine Art von Diskretion solle das sein? Ich finde, dass der Dekan mit dieser Einschätzung eigentlich nur zeigt, wie fremd ihm Feinheiten sind. Es geht nicht darum, dass ich sie nicht sehe, sondern dass sie mich nicht sehen – versteht er das nicht? Ich habe meine schrecklichsten Bürden zu Füßen Gottes abgelegt, weil ich ihn nicht sehen kann. Warum sonst würde jemand, der so groß ist, unsichtbar bleiben? Wenn ich dem Herrn in die Augen hätte sehen können, hätte ich vielleicht ein oder zwei gebeichtet und die schlimmsten für mich behalten. Mein Herz hätte sich verschlossen, um sich selbst zu schützen. Anders gesagt: Selbst ein friedlicher Hund knurrt und stellt das Fell auf, wenn man ihm direkt in die Augen schaut. Nein, unsere Seelen offenbaren wir am besten blind, und wenn man den Dekan davon überzeugen muss, dann soll er doch selbst zur Beichte kommen und mir, dem Unsichtbaren, seine dunkelsten und schlimmsten Sünden bekennen.
Der Dekan hat niemanden, dem er seine Sorgen anvertrauen kann. Ich sah, dass er sich Sorgen über Oakham machte, dass er befürchtete, wir könnten aufsässig werden und uns schlechte Angewohnheiten zulegen, wie etwa das Trinken zur Mittagsstunde und das Ertrinken durch fremde Einwirkung – und dass der Priester in seiner kleinen dunklen Kiste selbst ein Rebell war, der die Befehle Gottes zu kühn und lax auslegen könnte. Ich wusste, dass er sich vorstellte, wie ein Heer von Mönchen zu uns vorrückte, um unser Land in Besitz zu nehmen, das unter seiner Obhut stand. Er war in Newmans Haus eingezogen, als wir noch damit beschäftigt waren, den Boden mit blassen, getrockneten Veilchen zu bestreuen. Wir verstreuten die Veilchen für den Fall, dass Newmans Leiche gefunden und zu Hause aufgebahrt würde; nun mussten wir sie um die Füße des Dekans herum verstreuen.
Von dort aus beobachtete er uns. Ein schrecklicher Unfall habe Thomas Newman ereilt, hatte er gesagt; ein Unfall, der die Zukunft unseres Dorfes bedrohe. Er sagte, dass er uns beschützen werde. Aber er ist ein schwacher Mensch, und schwache Menschen lieben es, dort Macht auszuüben, wo nur wenig Widerstand existiert. Er sah eine Gemeinde in Trauer und Unruhe und beschloss, diese Schäfchen in seinen Pferch zu scheuchen. Vielleicht nur deshalb, weil es leicht war, weil er uns unvorbereitet erwischt hatte. Jetzt trug er uns plötzlich auf sanfte, sorgenvolle Art seine Vorstellungen von einem Mord an, damit er den Mörder finden und hängen lassen konnte. So wollte er den Kreislauf aus Schuld und Sühne schließen, der Ordnung in diese dunkle, rätselhafte Welt bringt, und sich als jemand ausweisen, der seine Gemeinden fest im Griff hat. Er fürchtete, dass unser Schiff sinken könnte. Ich mache ihm deshalb keinen Vorwurf; diese Furcht erfasst jeden, der plötzlich feststellt, dass man ihm irrtümlich das Steuerrad anvertraut hat, obwohl er weder Steuermann noch Kapitän ist. Nicht einmal Seemann.